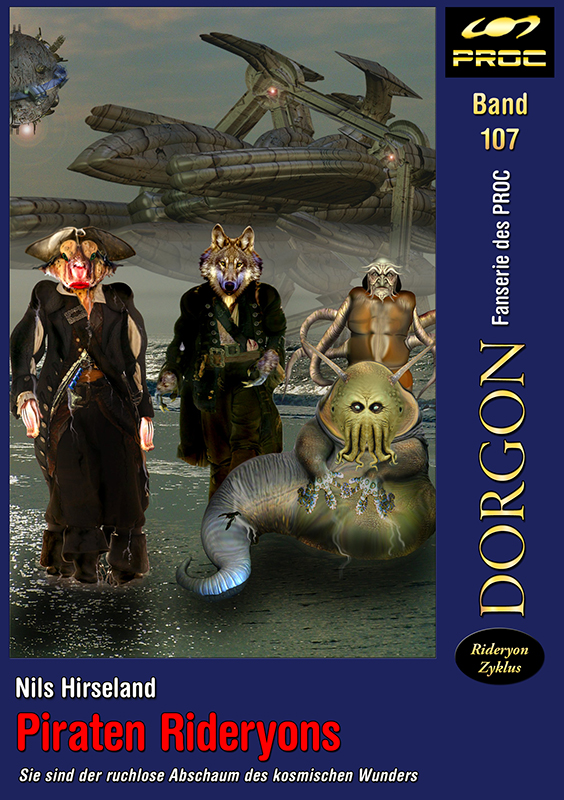Prolog
Kerbeg der Wanderer beobachtete das Spektakel der Gestirne am dunkelblauen Himmel. Er hatte sich schon seit langer Zeit auf den Tanz der Monde gefreut. Von seiner Sichtwarte aus waren die zwei Dutzend Himmelskörper, die sich aufeinander zu bewegten, nicht größer als Murmeln.
Als würden Glühwürmchen im Zeitraffer tanzen, zogen die Satelliten ihre Bahnen am Abendhimmel. Wie von Geisterhand gesteuert, änderten sie ihren Kurs und passierten einander in gebührendem Abstand, ohne zu kollidieren oder ihre Gravitation zu gefährden. Der »Tanz der 24 Wächter« wurde das Schauspiel in seiner Heimat genannt.
Kerbeg war zufrieden. Hier war ein guter Platz zur Rast, fand er und ließ sich nieder. Der Boden war allerdings feucht. Er stand wieder auf, streifte den Rucksack ab und kramte die Decke heraus. Sorgsam breitete er sie aus und stellte links und rechts neben seinem provisorischen Schlafplatz zwei Lampen auf. Sie spendeten nicht nur ein angenehmes grünes Licht, sondern gaben auch Wärme ab.
Kerbeg legte den Rucksack auf die Decke und setzte sich. Der Wanderer stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. So ließen sich die schmerzenden Füße ertragen. Gebannt blickte er gen Himmel. Die Wunder des Kosmos waren mehr als schön, denn sie bestärkten ihn auch in der Erkenntnis, dass das Leben jedes Buuralers erst an Sinn gewann, wenn er seinen Platz im großen Ganzen fand. Dazu musste er fern vom Lärm und vom Gehetze des Alltags die eigene Mitte finden.
Der Buuraler kraulte sich am Bauch. Stille. Nur das Zirpen von Grillen und hier und da Laute aus dem Wald gaben die Begleitmusik zum Mondtanz von Thol, den er gebannt beobachtete. Angesichts des Schauspiels verblassten all die Probleme, vor denen er weggelaufen war.
Er war lange gereist, um allen Wesen aus dem Weg zu gehen, war ein Aussteiger geworden. Er hatte die buuralische Gesellschaft mit ihrem Kommerz einfach satt. Es gab nur Verlierer in dieser hektischen Fließbandgesellschaft. Geld regierte Buural. Sein Leben lang war er sinnlosen Tätigkeiten nachgegangen, die ihn nie ausgefüllt hatten. Sein ganzes Streben hatte nur dem Überleben gedient, dem Bezahlen von Rechnungen für ein kärgliches Heim.
Wie einfach und schön das Leben sein konnte, dachte er behaglich, während er dem Flug der Monde mit stetig wachsender Zufriedenheit zusah. Nun hatte er Zeit, sich den Wundern des Rideryons zu widmen. Den wirklich wichtigen Dingen.
Er hatte von einer abgelegenen Siedlung gehört, in der Leute wie er lebten. Es hatte drei Chroms gedauert, ihren Standort zu finden. Sie war sein Ziel. Er wollte zur entlegenen Siedlung der Aussteiger und sich in ihre Gesellschaft integrieren. Dort wollte er einen Neuanfang machen. Hoffentlich würden sie ihn aufnehmen.
Kerbeg rieb sich die Nasenwurzel, als er einen fauligen Gestank bemerkte, über den sich ein Städter sicher aufgeregt hätte. Den gab es nun mal in der Natur. Er verschränkte die Hände auf dem massigen Bauch und schloss die Augen. Ein wenig Schlaf würde ihm jetzt gut tun. Doch er fühlte sich unbehaglich.
Als er die Augen Sekunden später wieder öffnete, zuckte er zusammen. Vor ihm hockte ein großes Wesen und starrte ihn im fahlen Schein des grünen Lichts an. Das Gesicht war dem eines Buuralers nicht unähnlich: kantig, hohe Wangenknochen, tief liegende schwarze Augen. Der Kopf war haarlos, der Körper schlank, aber trainiert. Es schien keine Kleidung zu tragen.
»Wohin des Weges, Fremder aus Buural?«
Es konnte sprechen!
Und es beherrschte Rideridiom perfekt.
Kerbeg setzte sich auf. Seine Gedanken rasten. Instinktiv hob er die Arme halbhoch, die Hände zu Fäusten geballt. Was war dieses Wesen? Was wusste es? War es hinter ihm her? Vielleicht ein Kopfgeldjäger? Doch wer sollte Interesse daran haben, ihn zurück nach Buural zu bringen? Kerbeg war keine große Nummer gewesen. Wer sollte ihn vermissen?
»Ich bin auf der Durchreise.«
Kerbeg hatte keineswegs vor, dem Fremden sein Ziel mitzuteilen. Der Standort der Siedlung war geheim. Nur wenige wussten davon und sie war schwer zu erreichen.
»Du willst ins Dorf«, stellte der Fremde fest.
Kerbeg erschrak. War das eine Prüfung? Vielleicht wurde seine Suche nach der Siedlung schon lange beobachtet und er wurde nun einem Aufnahmetest unterzogen?
Der Fremde erhob sich und breitete die Arme aus. Kerbegs Herz pochte so schnell, dass es schmerzte. Hinter den Klauen entfalteten sich ledrige Flügel. Der Fremde entblößte sein dolchscharfes Gebiss. Das Gesicht glich dem eines Raubtiers mit bösen, dunklen Augen, die ihn gierig anstarrten.
»Buuraler, ich fürchte, das Dorf wirst du nicht erreichen.«
Kerbeg war unfähig, sich zu bewegen. Von Angst paralysiert, starrte er in die Horrorfratze seines Gegenübers.
»Buuraler, du hast deinen Wanst in das Jagdgebiet der Ylors gepflanzt. Und ich bin durstig …«
Der Ylors bewegte sich auf Kerbeg zu, packte ihn und schlug die Zähne in seinen Hals. Der gurgelnde Schrei des Buuralers erstickte in seinem Blut, sein Zappeln erstarb, als der Fremde sich auf ihn setzte und mit Händen und Füßen zu Boden drückte. Gierig labte sich der Angreifer an seinem Blut und Fleisch. Der Schmerz wich einer allumfassenden Kälte, als Kerbegs Geist in die Nacht entschwand.
Die DUNKELSTERN
Der mechanische Fisch suchte seinen Weg durch den weißlich schimmernden Nebel. Die DUNKELSTERN schlich mit langsamer Fahrt durch die Wolken und das Gas, welches ihr eine perfekte Tarnung verschaffte. Mit ihrem torpedoförmigen Rumpf, den antennenförmigen Ausbuchtungen und dem scheibenhaften Kopf sah sie aus wie eine Mischung aus einem Hai und einem Rochen.
Michael Rhodan alias Roi Danton saß in dem unbequemen Kommandosessel des ehemaligen Kapitäns des Schiffes. Während Roland Meyers die DUNKELSTERN durch den Nebel manövrierte, studierte Danton aufmerksam die Daten über das gigantische Rideryon.
Die unzähligen Informationen über Kulturen und Regionen auf dem Rideryon faszinierten ihn, doch er musste sie pragmatisch selektieren. Zum Staunen hatte er keine Zeit! Die Frage war: Wo waren sie vor Kapitän Fyntross sicher?
Es gab vier große Regionen, die es zu unterteilen galt. Natürlich gab es eigentlich viel mehr, denn diese Abschnitte waren schon so gigantisch, dass ein Mensch sie kaum zu erfassen vermochte.
Wenn sie eine Nordsüd-Einteilung vornahmen, so war der Norden technologisch und zivilisatorisch am fortschrittlichsten. Dort lagen die Länder der Manjor, Harekuul, Buuraler und Gannel, der Miskatoor-Feen und anderer dominierender Spezies, welche offenbar eine Art Föderation des Rideryons bildeten.
Im Nordwesten und Nordosten erstreckten sich öde Landschaften, karge Gebirgsketten, Vulkanlandschaften und endlose Lavaseen.
In der Mitte des Rideryons lag eine große Wüste, die an einen Ozean grenzte, dem weiter südlich eine dichte Dschungelregion folgte.
Diese Wüste war so groß wie der Jupiter. Die Ausmaße des Riffs waren unfassbar. Alles war hier gigantisch überdimensioniert.
Es gab in alle Himmelsrichtungen natürlich auch Vegetationsänderungen. Ozeane, Seen, Wälder und Gebirge wechselten sich immer wieder ab.
Ein ulkiger Einfall machte sich in Dantons Kopf breit: Die Landschaft des Rideryons war so, als würde man tausende Planeten wie einen Pizzateig ausrollen und miteinander verbinden. Als würde man Terra, Arkon, Plophos, Olymp, Gatas und all die anderen Welten zu einer Scheibe wälzen und zusammenflanschen. Wie viele Welten in der Milchstraße würden auf die Fläche des Rideryons wohl passen? Vermutlich alle wichtigen Welten der ganzen Galaxis. Vereint auf einer gigantischen Landmasse! Danton und seine Crew versuchten, sich einen Überblick zu verschaffen.
Ihr Fokus lag auf jenen Regionen, die an die Schattenseite des Riffs grenzten. Jenem Bereich, dem die Kunstsonnen kein Licht spendeten.
Das war auch ihre Position. Die DUNKELSTERN navigierte zwischen der Schattenseite und dem Nebel, welcher diesen Bereich des Rideryons umgab. Danton hoffte, dass Fyntross auf der VIPER das Hoheitsgebiet der Ylors meiden würde.
Er tippte nachdenklich mit den Fingern auf die Konsole. Perry Rhodans Sohn wusste, dass sie sich nicht ewig verstecken konnten.
Kathys Gedanken
Mein geliebter Aurec,
wer weiß, wann und ob Du jemals diese Zeilen lesen wirst – dass Du sie liest, hoffe ich von ganzem Herzen. Wir sind seit einigen Monaten – es kommt mir bereits vor wie eine Ewigkeit – in diesem fremden Riff und nur dank Rois Geschick sind wir noch am Leben.
Es wimmelt hier nur so vor Gefahren. Ehrlose Raumpiraten, finstere Kuttenwesen und dann noch die Vampire mit dem Namen Ylors. Ich verwünsche diese dummen Entropen jeden Tag aufs Neue! Wieso haben sie uns hergebracht? Es macht doch jetzt keinen Sinn mehr! Es machte eigentlich nie Sinn! Wie sollten wir das Riff vernichten? Noch immer rätsele ich, wieso wir hier sind.
Auch wenn Perry Rhodans Sohn eine Macke hat, bin ich froh, dass er hier ist. Ebenso schön ist es, dass Nataly hier ist. Wir haben uns wirklich ziemlich eng angefreundet. Na ja, wir haben in den letzten zwei Jahren auch fast die ganze Zeit miteinander verbracht. Da wächst man schon zusammen. Das hätte ich früher auch nicht gedacht, insbesondere, wie grässlich sie mich damals behandelt hat, als ich aus dem Heim ausgebrochen war.
Aber das gehört der Vergangenheit an. Inzwischen ist Deine labile Freundin zu einer starken Frau herangewachsen. Ich hoffe, Du bist stolz auf mich. Aber denke jetzt bitte nicht, dass ich die ganze Zeit stark bin. Es gibt viele Momente, da fühle ich mich grässlich einsam und völlig verloren. Ich sehne mich nach Dir und bete jeden Tag, dass wir bald wieder vereint sind.
Ich liebe Dich, Deine Kathy!
Ende Juli 1307 NGZ
*
Kathy legte den altmodischen Stift beiseite, streckte sich und las den Brief noch einmal durch. Es ging ihr etwas besser, nachdem sie diese Zeilen geschrieben hatte, obwohl es beinahe unmöglich war, dass Aurec jemals diesen oder die ganzen anderen Briefe erhalten würde.
Sie seufzte und blickte sich in ihrer und Natalys tristen Kabine um. Die Wände waren wohl früher mal weiß gewesen, jetzt war es ein schmieriges Gelbbraun. Zwei Betten, ein großer, grauer Tisch in der Mitte mit zwei Stühlen, dazu in der Ecke zwei Spinds. An der Wand zwischen den Betten hing schräg ein großer Monitor. Das war von der Kabine übrig, nachdem sie gereinigt worden war. Sämtliche persönliche Sachen ihrer Vorgänger hatten sie in den Konverter geworfen. Wohnlich war es hier jedenfalls nicht.
Ein lautes Poltern lenkte Kathy vom Weiterlesen ab. Nataly Andrews stürmte wutentbrannt in die karge Kabine, hinter ihr Roi Danton.
Nataly hatte ihr blondes Haar zu einem Zopf zusammengeknotet, was ihr einen strengen Eindruck verlieh. Danton in seiner verschlissenen Freibeuteruniform wirkte ruchlos und abenteuerlich wie eh und je.
»Es ist ja wohl nicht wahr, dass ich ständig hinter euch herräumen muss. Überall Dreck und Schmutz! Ich glaube, ich spinne! Ich bin doch nicht eure Putze, das sag ich euch!«
Nataly guckte im Moment wieder besonders giftig und bösartig. Würde Kathy sie nicht besser kennen, hätte sie vermuten können, dass ihre Freundin Roi am liebsten erwürgt hätte. Der wirkte wenig beeindruckt.
»Das hier ist ein Piratenraumschiff. Hier ist es eben dreckig. Ich kann doch auch nichts dafür, dass die nicht jeden Tag putzen. Die sind das eben so gewohnt, ma chérie!«
»Ich bin nicht dein chérie!«
Danton grinste anzüglich.
»Dem könnten wir bestimmt abhelfen.«
Nataly starrte ihn finster an.
»Versuch’s doch mal!«
Danton wandte sich ab und murmelte etwas von »humorloser Emanze« und verließ den Raum. Bei Szenen dieser Art war Kathy sich nie sicher, ob Danton nun eine Rolle spielte oder es ernst meinte. Michael Rhodan war ein relativ Unsterblicher mit einem Zellaktivator und hatte viele Lebenszeiten hinter sich. Als Freibeuterkönig Roi Danton hatte er gelebt, als Rhodans trotziger Sohn, als Gänger des Netzes, als gefallener Torric und nun als ruchloser Weltraumpirat. Zweifellos auf eine gewisse Art und Weise ein Schauspiel. Kathy glaubte fest daran, dass ein Rhodan in Danton steckte. Er hatte das Herz am rechten Fleck. Da verzieh sie ihm auch seine Macken und Marotten.
Wenn es denn welche waren.
Wenn er denn wirklich nur Charade spielte.
Sie blickte Nataly betont spöttisch an.
»Ich will diesen Ort doch nur wohnlicher gestalten, wenn wir hier noch Monate drauf leben müssen. Ein paar Pflanzen, sauberer Boden und Sitzgelegenheiten sind ja nicht zu viel verlangt«, ereiferte sich Nataly. Sie setzte sich auf einen grauen, angerosteten Stuhl und zündete sich erst einmal eine Zigarette an.
Nataly hatte nicht unrecht. Seit fast drei Monaten befanden sie sich auf dem Rideryon und versteckten sich seit Wochen vor der VIPER unter dem Kommando von Kapitän Fyntross. Der war ein berüchtigter Battunus, dessen knallrote Lippen, Stilaugen und Körperbau ihm bei Danton die Spitznamen »Fischstäbchen« und »Backfisch« eingebracht hatte – die er zum Glück nicht verstand.
Aber vermutlich waren auch diese unheimlichen Ylors und die Jaycuul hinter ihnen her, denn Roi Danton hatte ja unbedingt das Abbild der Ajinah stehlen müssen! Er vermied es, in den freien Raum vorzustoßen, sondern tingelte auf der »Unterseite« des Rideryons durch den Nebel.
Lang genug war es ja.
Die Landmasse selbst war etwa 40 Millionen Kilometer lang, etwa 20,1 Millionen Kilometer hoch und 10,4 Millionen Kilometer breit.
40 Millionen Kilometer Länge! Würde man einmal um die Erde spazieren, so hätte man über 40.000 Kilometer zurückgelegt. Der größte Planet des Solsystems, der Jupiter, hatte einen Umfang von etwa 450.000 Kilometern. Das hieß, Danton müsste eintausend Mal die Erde am Äquator entlang wandern, um vom Anfang bis zum Ende des Riffs zu gelangen. Doch das Rideryon war nicht rund. Danton überschlug im Kopf die genaue Quadratkilometerzahl. Diese Weltrauminsel, die den üblichen physikalischen Gegebenheiten spottete, war gigantisch. Das Rideryon bot unermesslich viel mehr Lebensraum als Terra.
Zwei Kunstsonnen zogen ihre Bahnen um eine Seite der Landmasse. Ihr Kurs glich dabei einer Acht. Wie konnte das sein? Und es gab so viel anderes, das unerklärlich war. Da existierten so viele erdenkliche Regionen und Lebensformen. Die Flora und Fauna war mannigfaltig jenseits der menschlichen Vorstellungskraft.
Doch wie kamen sie hin? Kathy hatte bereits vorgeschlagen, dass sie einfach durch die Barriere fliegen sollten, doch Roi war der Weg zu gefährlich: sie wussten nicht, ob die DUNKELSTERN das heil überstand.
Die Crew tat ihr Übriges. Kathy schmunzelte. Ja, sie waren eine illustre Truppe. Roi Danton als selbsternannter Piratenkapitän, Nataly und sie, der Pararealist Sato Ambush, dann Roland Meyers als einzig vertrauenerweckender Mensch neben Ambush und Nataly, sowie die seltsame Maya ki Toushi.
Die Krönung waren jedoch die Arawakpiraten selbst. Hakkh, der Rideryon-Zwerg, Craasp, der fette Manjor und der grazile, aber hirnlose Fithuul Zerzu waren sofort zu Danton übergelaufen. Inzwischen hatten sich ihm sieben der dreißig Gefangenen ebenfalls angeschlossen. Kathy traute keinem Einzigen von ihnen.
Nataly rauchte auf, warf die Putzutensilien in die Ecke und verließ den Raum mit den Worten: »Bin dann mal weg.«
Kathy blickte ihr nachdenklich hinterher.
Die Bürde des Kommandanten
Roi Danton saß in der Kajüte des Kapitäns und starrte auf seine Flasche Schnaps. Diese Riffplörre würde seine Innereien wegätzen, wenn er mehr davon trank. Auf der anderen Seite gab es nichts anderes auf dem Schiff außer Wasser.
Die Damen an Bord der DUNKELSTERN hatten zwar einen Weg gefunden, das Wasser mit Kohlensäure zu versetzen, aber für Danton war das auf Dauer nichts. Während Kathy und Nataly eine Seltersdiät machten, wünschte sich Roi eine Flasche Vurguzz herbei. Aber sie hatten weitaus größere Probleme als fehlender von Schnaps. Obgleich dies, wie er sich beim Betrachten der Flasche dachte, ein gewichtiges Problem war.
Fyntross lag ihnen im Nacken. Einige Wochen hatte das Katz-und-Maus-Spiel funktioniert, aber wie lange noch? Sie konnten sich nicht ewig verstecken! Das war auch gar nicht Dantons Absicht. Er wollte mehr über das Rideryon herausfinden, hinter sein Geheimnis kommen. Bis heute hatten sie viele Informationen über die Geographie und Beschaffenheit des Riffs in Erfahrung gebracht. Seine Struktur entsprach offenbar der eines normalen Planeten. Es gab Gebirge, Wälder, Ozeane und Wüsten aus Eis oder Sand. Zwei Kunstsonnen spendeten auf der »Oberseite« Licht. Die »Unterseite« des Riffs war in komplette Dunkelheit gehüllt. Dort lebten die Ylors.
Seltsam war, dass sie die innere Struktur des Riffs nicht abtasten konnten. Nach 183.000 Kilometern wurde eine Barriere angezeigt, die anscheinend die Ortungsgrenze darstellte. Sobald sie mit Tiefenscannern den Zentrumsbereich erforschen wollten, wurde das Signal gestört und abgeblockt. Gab es dafür eine natürliche Ursache oder wollte jemand nicht, dass sie tiefer gruben?
Die Artenvielfalt des Rideryons war überwältigend, es wimmelte nur so von Leben. Und doch gab es auch viele weite Landstriche, in denen sie nur vereinzelte Siedlungen vorfanden. Sato Ambush hatte sich daran gemacht, das Rideryon zu katalogisieren.
Was Roi Danton am meisten verwunderte, war die Tatsache, dass es offenbar keine einheitliche Regierung gab. Politisch gesehen herrschte offensichtlich ein Chaos. Und doch gab es Behörden wie die Hohepriesterschaft des Nistant und polizeiliche Organisationen, die überall agierten. Sie jagten auch die Riffpiraten.
Der Gott Nistant schien die Staatsreligion des Rideryons zu verkörpern. Vermutlich eine Gemeinsamkeit, die alle Völker miteinander verband, denn bisher hatte jeder Rideryone, den sie trafen, voller Ehrfurcht von Nistant gesprochen. Dieses Wesen musste daher eine bedeutende Rolle für die Einheimischen spielen. Cul’Arc hatte von Nistant gesprochen. Es gab die Hohepriesterschaft des Nistant und selbst der Backfisch-Pirat Fyntross hatte sich nicht getraut, Witze über ihren potenziellen Gott zu machen. Allerdings hatte er sich dann doch unverfroren als Kunsträuber an einem heiligen Gegenstand betätigt.
Ein schrilles Klingeln ließ Danton aus seinen Überlegungen hochschrecken. Im Gegensatz zu den sanften Klingeltönen der LFT-Raumschiffe klang diese Türglocke wie eine Alarmsirene.
»Herein …?«
Sato Ambush betrat gemessenen Schrittes die Kabine. Der kahlköpfige Terraner japanischer Herkunft verneigte sich in gewohnt höflicher Weise.
»Roi-San, wir haben ein Problem.«
»Der Schnaps ist alle?«
»Nein, aber die übrigen Vorräte neigen sich dem Ende zu. Wir müssen uns neue Nahrung beschaffen.«
Danton lehnte sich erleichtert zurück. Gott sei Dank, der Schnaps war nicht alle. Es bestand also kein Grund zur Panik. Doch ohne Essen würden sie auch nicht lange durchhalten. Und die Frauen würden furchtbar zickig sein, wenn sie kein Wasser mehr hatten.
»Wir müssten uns im Riff umschauen. Hast du schon eine passende Siedlung gefunden?«
Der Pararealist bestätigte mit einem Nicken.
»Hai! Sie befindet sich etwa siebeneinhalbtausend Kilometer von unserem derzeitigen Standpunkt entfernt.«
Ambush war ein treuer Gefährte seit ihren Abenteuern um die Endlose Armada vor fast tausend Jahren. Nachdem sie Monos besiegt hatten, war er in mehrere Paralleluniversen verschlagen worden, hatte sich mit seinem alternativen Ich Embuscade auseinandersetzen müssen. Durch den Tod seines Alter Ego war ihr Ambush zu einem Zellaktivator gelangt. Dank der Intervention eines namenlosen Alyskers und der saggittonischen Superintelligenz SAGGITTORA war er dann wieder in ihr Universum zurückgekehrt.
Roi mochte Ambush aufrichtig. Der Japaner war ein Ruhepol, gab mit seiner bescheidenen und sachlichen Art Rückhalt in brenzligen Situationen. Als Nexialist hatte er außerdem einen reichhaltigen Fundus an Wissen.
Ambush ging an den Tisch und aktivierte per Knopfdruck die Holographie einer Karte des zungenförmigen Rideryon. Dann zoomte er näher an die Unterseite und deutete auf den Punkt, an dem sie sich befanden.
Als Nächstes zog er mit dem Finger die dreidimensionale Karte des Rideryons bis zu einem bestimmten Punkt. Es war ein Übergang zwischen der finsteren Seite und der Seite, an der die Sonnen ihre Bahnen zogen. Der Zoom wurde um den Faktor 100 vergrößert. Die Region war nicht länger ein kaum zu realisierender Fleck in der gigantischen Landschaft des Riffs. Sie wirkte jetzt realer.
Dann sah Danton, worauf der Japaner zeigte. Umgeben von Gebirgen, Wäldern, Seen und Tälern mit üppiger Vegetation lag eine Siedlung.
»Wir sind hier in der Dunkelzone. Das Dorf liegt hinter einem Gebirge auf der hellen Seite des Riffs nahe der Grenze zur Finsternis. Das Interessante an ihm ist, dass es recht abgeschieden liegt. Die nächste Ansiedlung liegt 700 Kilometer entfernt.«
Im Umkreis von 700 Kilometern gab es keine Dörfer, Stationen und Städte! Das war, als würde es zwischen Kiel und München nichts als unbesiedelte Natur geben. So etwas wäre auf Terra und anderen großen Planeten wegen der Bevölkerungsdichte raumfahrender Zivilisationen kaum möglich gewesen. Auf einer Landmasse mit einer Länge von knapp 40 Millionen Kilometer schon – da waren 700 Kilometer nicht sehr viel. Für ihr Anliegen war das Dorf jedenfalls ideal.
»Dort würden wir wenig Aufsehen erregen. Sehr gut. Aber können die Leute dort uns weiterhelfen?«
»Hai, Roi-San! Wir haben Bauernhöfe, einen großen Süßwassersee und reichlich tierische Vegetation geortet. Nun, wir sind sechzehn Crewmitglieder und zwanzig Gefangene. Wir könnten uns sicherlich für einen Monat gut versorgen.«
»Wenn wir die Gefangenen loswerden, sogar noch länger …«, murmelte Danton.
»Was hast du vor?«
»Wir könnten sie irgendwo aussetzen, wo sie Nahrung und Ressourcen finden, um gut durchzukommen. Dann sind wir eine Sorge und zwanzig hungrige Mäuler los.«
Ambush begrüßte diese Idee. Sein Lächeln signalisierte, dass sie frisch ans Werk gehen sollten. Danton rief Roland Meyers zu sich, damit er einen sicheren Plan ausarbeiten konnte, um die Inhaftierten abzusetzen.
»Die DUNKELSTERN hat zwei Beiboote. Roland und Maya kümmern sich um die Gefangenen. Sato, Kathy und ich werden zu diesem Dorf fliegen, um Nahrung und Trinkwasser zu besorgen. Nataly erhält bis Meyers Rückkehr das Kommando. Die armen Teufel an Bord …«
»Sie wird mit eiserner Hand regieren«, vollendete Ambush den Satz.
Meyers bedachte ihn mit einem bösen Blick. Dann verließ er die Kapitänskajüte. Danton sah ihm irritiert nach.
»Etwas seltsam drauf, der Junge. Ist wohl das Fernweh.«
»Das glaube ich nicht«, antwortete Sato mit einem Unterton, der Unheil ahnen ließ. Er vertraute seiner Menschenkenntnis.
Neue Liebschaften
Roland Meyers bereitete sich auf den Abtransport der Gefangenen vor. Gewissenhaft hatte er alle erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen und sie bereits dreimal geprüft. Zum vierten Mal kontrollierte er seinen Thermostrahler.
Da hörte er die leisen Schritte hinter sich und spannte die Muskeln. War es einer der ehemaligen Piraten? Hatten sie Wind von ihrem Unterfangen bekommen und wollten ihre Kameraden befreien?
Der holzige Geruch von Zigarettenqualm drang in seine Nase. Erleichtert verzog Roland die Lippen zu einem Schmunzeln. Langsam er drehte sich um, zielte mit dem gesicherten Strahler auf Nataly Andrews und wartete ihre Reaktion ab.
Sie wirkte unbeeindruckt, zog an der glimmenden Zigarette und stieß den Rauch aus.
»Wann geht es los?«, wollte sie wissen.
»In zwei Stunden.«
Sie nahm einen weiteren Zug. Roland betrachtete sie von oben bis unten, bewunderte ihre Formen.
»Mach endlich das Ding aus«, forderte er ungeduldig.
Sie warf die Kippe auf den Boden und trat sie aus. Aus kühlen blauen Augen blickte sie ihn finster an. Dann legte sie die wenigen Schritte zurück, die sie trennten, umschlang ihn und er spürte ihre Lippen auf seinem Mund. Sie presste sich an ihn. Er griff ihren Hintern, packte fest zu. Hastig wanderten seine Hände höher, ihren Rücken entlang und von dort nach vorn. Er knetete ihre Brüste. Sie schubste ihn zurück. Was war denn nun? Er war doch gerade in Stimmung.
Aber Nataly grinste ihn schelmisch an. Sie streifte ihr Shirt ab. Er verstand das Signal und setzte sich aufs Bett. Sie drückte ihn auf die Matratze, setzte sich auf ihn und küsste ihn leidenschaftlich. Er hoffte, das würde niemals aufhören.
Seit einer Woche trieb Nataly ihn schon in den Wahnsinn. Es hatte auf einmal gefunkt. Er wusste, sie war verheiratet, doch das war ihm egal. Er wollte sie! Sie macht ihn rasend.
Die Bewegungen wurden hastiger, intensiver. Sie öffnete seine Hose und zog sie herunter. Ihre Zunge ließ ihn neue Höhen erreichen.
Plötzlich schrillte die Türklinge. Roland erschrak. Nataly sah ihn überrascht an. So schnell sie konnten, zogen sie sich an. Währenddessen rief Meyers: »Moment, gleich.«
Nataly richtete ihr Haar und setzte sich in einen Sessel. Er bat den Besucher einzutreten. Es war Roi Danton. Natürlich der! Wer sonst würde jetzt stören? Mit schunkelnden Schritten betrat er die Kabine.
»Ah, ich störe wohl. Nun, meine Gruppe ist bereit. Seid ihr noch etwas beschäftigt?«
Meyers räusperte sich.
»Was soll denn der Schwachsinn?«, fauchte Nataly. »Wir haben die Übergabe gemacht. Ich muss ja schließlich wissen, was ich zu beachten habe, während ihr alle weg seid. Natürlich dauert das!«
»Richtig«, bestätigte Roland betont sachlich.
»Natürlich«, erwiderte Danton. Er wandte sich von ihnen ab, nur um sich noch einmal theatralisch umzudrehen. Mit dem Finger deutete auf die Terranerin. »Oh, ich glaube, du hast da was am Kinn, Nataly.«
»Was?«
Hastig fuhr sie sich mit dem Finger über ihre untere Gesichtspartie. Meyers erschrak. Das konnte gar nicht sein, denn soweit waren sie gar nicht gewesen.
»Nur ein kleiner Streich«, antwortete Danton mit einem anzüglichen Lächeln. »Aber eine interessante Reaktion.«
Nachdem er die Kabine verlassen hatte, sprang Nataly mit einem Schrei auf und warf den Sessel um.
»Dieser Mistkerl! Was fällt dem denn ein? Das geht ihn doch überhaupt nichts an. Es ist meine Entscheidung!«
»Unsere …«, warf Roland ein.
Immerhin musste er nun damit leben, ein Betrüger zu sein. Alles, was er von diesem Jonathan Andrews bisher gehört hatte, war durchweg positiv gewesen. Er war ein Held. Fast tat es ihm leid, dass er mit seiner Frau vögelte. Aber auch nur fast. Sie hatte erzählt, dass ihre Liebe zu ihm erloschen war, weil Jonathan nur seiner Mission folgte und dem Ritter der Tiefe Gal’Arn hörig war.
Nataly blickte ihn verständnislos an und schüttelte den Kopf.
»Hättest du nicht vorsichtiger sein können?«
Sie rannte aus der Kabine und ließ ihren Liebhaber verdutzt zurück.
Das Dorf
Danton wiederum dachte nicht viel über die offensichtliche Affäre von Nataly und Meyers nach.
Sato Ambush steuerte die zehn Meter durchmessende linsenförmige Raumfähre mit den Bullaugen an der Seite. Sie bot für gerade drei Personen Platz. Meyers kam in den Genuss des größeren Beibootes, da er die Gefangenen aussetzen sollte.
Die DUNKELSTERN verblieb in der dunklen Zone, um sich vor Fyntross zu verstecken.
Kathy starrte aus dem Cockpit und betrachtete die Umgebung. An sich sah es hier recht gemütlich aus. Regelrecht idyllisch sogar. Hinter der Bergkette erstreckte sich ein großer, blaugrüner See. Daran grenzte ein dichter Wald aus violetten Nadelbäumen, der die Siedlung ringförmig umschloss und sich bis an den Fuß des Gebirges erstreckte. Es gab keine Straße, die durch den Wald, keinen größeren Pfad, der Reisende über das Gebirge führte.
Am See existierte kein Hafen. Trotz der Größe des Gewässers gab es auch kein Schiffsverkehr. Nur zwei Fischerboote juckelten friedlich auf dem Wasser. Ein kleiner Bootssteg lag am Rand des Dorfes. Die gesamte Region war tatsächlich von der Außenwelt isoliert.
Danton sah sich die Ergebnisse der Ortung an. 312 intelligente Lebewesen bewohnten das Dorf. Dazu einige Kühe, Schweine, Pferde und Hühner, sowie Hunde und Katzen. Oder zumindest Wesen, die man von der Art her als solche bezeichnen konnte.
»Wir landen nahe dem Gebirge und gehen den Rest zu Fuß. Wir wollen doch die Einwohner nicht erschrecken, n’est-ce pas?«
Er verwendete mal wieder das Wort, welches aus dem terranischen Französisch stammte und »nicht wahr?« bedeutete.
Sato steuerte das kleine Raumschiff hinter einen Hügel, so dass sie nicht gleich bemerkt wurden. Sanft setzte die Fähre auf dem steinigen Boden auf. Danton ließ es sich nicht nehmen, als erster Terraner den Fuß auf den Boden der hellen Seite des Riffs zu setzen. Genau genommen war er sogar der erste Terraner gewesen, der jemals das Riff betreten hatte. Kathy Scolar war nun offiziell die erste Terranerin und Sato Ambush der erste Japaner auf dem Rideryon. Die Luft war kalt, aber angenehm frisch.
Zwischen den Grashalmen erhoben sich die Kelche wilder Blumen, die ihm ungewohnt vorkamen. An die Wiese grenzte ein Wäldchen. Auch die Bäume wirkten anders, als er es kannte.
Fasziniert betrachtete Danton das blaue Pferd, welches zutraulich näherkam. Das Tier wanderte auf sechs kräftigen Beinen durch das Gras. Es machte den Hals lang, um an ihm zu schnuppern, und begann an seinem Ärmel zu knabbern. Dabei entblößte es große goldene Zähne.
Dann senkte das Tier den Kopf, um friedlich zu grasen. Kleine, putzige Fohlen trabten tapsig durch die blühende Wiese, sie fanden sich zum Frühstück bei ihrer Mutter ein.
Sie gingen weiter und genossen die kleine Wanderung. Dann blieb Kathy abrupt stehen und zeigte auf eine Stelle im Gras. Die Halme bewegten sich. Danton zog seinen Säbel und zielte ihn bereit.
Ambush schob sich sanft an den beiden vorbei und hielt seinen Stock an die Stelle. Ein Tausendfüßler krabbelte auf die Spitze, schien uninteressiert und ließ sich wieder zurück ins Gras fallen.
»Igitt. Aber wartet, seht mal dort.«
Kathy zeigte auf den kleinen Pfad.
»Mademoiselle et Monsieur, puis-je demander?«
»Was?«, fragte Kathy.
Danton verdrehte die Augen.
»Es mag ja verständlich sein, wenn einem Terraner primitive Dialekte nicht mehr geläufig sind, aber die Sprache der Liebe sollte man doch kennen, nicht wahr, ma chérie?«
»Ich bin nicht dein Liebes!«
»Ah, du sprichst ja doch französisch«, triumphierte er.
»Wären wir nun so gütig, den Pfad zum Tal einzuschlagen?«, fragte Sato Ambush sehr höflich.
Danton nickte. Kathy bedachte ihn mit einem bösen Blick. Er würde es wohl niemals schaffen, die brünette Schönheit von sich zu überzeugen. Dabei wäre sie doch in seinem Bett deutlich besser aufgehoben als in dem von Aurec, der sich ziemlich wenig um sie zu kümmern schien.
Oh, wenn Rois Vater dies hörte, dann würde sein Alter ihm eine Standpauke halten. Aber er war nun einmal nicht wie sein Vater. Allenfalls die etwas verruchtere Version. Zumindest von Zeit zu Zeit.
Das allerdings war er mit einer ausgeprägten Freude. Natürlich kämpfte er auch für die Gerechtigkeit, aber eben auf seine Art, und er wollte etwas mehr Spaß dabei haben, wollte nicht so ein moralischer Spießer sein wie sein Vater.
Die Unsterblichkeit war lang und konnte schnell langweilig werden. Würde man immer dasselbe virtuelle Spiel zocken, so würde es öde werden. Spielte man unterschiedliche Spiele und tauchte in neue Welten als neuer Charakter ein, blieb es spannend. Und so war es auch mit dem Leben eines relativ Unsterblichen. War die Veränderung der Persönlichkeit nicht ein Schutz vor dem Wahnsinn des ewigen Lebens?
Michael Rhodan, Roi Danton, eher unfreiwillig Torric. Er hatte schon so einige Masken getragen.
Kathy lief vor ihm her und das war gut so, denn so konnte er ihr knackiges Hinterteil ausgiebig begutachten, welches in der schwarzen, engen Hose besonders plastisch aussah.
Der Weg war schmal. Danton ließ seinen Blick von Kathys Allerwertesten und betrachtete die Vegetation. Ein grauschwarzer Falter flatterte über einen dornigen Busch mit orangefarbigen Knospen. Kaum hatte er sich niedergelassen, schnellte etwas auf ihn und verschlang ihn. Er konnte den weißen Vogel im Wegfliegen flüchtig erkennen. Roi staunte, denn der Vogel besaß neben seinen Füßen auch noch ein Greifarmpaar.
Kathy stieß einen erstickten Schrei aus.
»Schon wieder so ein Kriechtier«, fluchte sie, als vor ihren Füßen ein handgroßer, blau schimmernder Käfer mit großen, borstigen Haaren auf acht Beinen an ihr vorbei krabbelte. Sein gewölbter Rückenpanzer wies ein Muster auf, welches wie der Buchstabe S aussah.
»Wir sollten uns von den Sträuchern fernhalten«, riet Ambush.
»Wieso?«
Der Japaner blieb stehen, hob seinen Stock und raschelte damit in dem dornigen Gebüsch. Seine hellgrünen Knospen sonderten auf die Berührung hin ein ebenso grünes Gas aus.
»Verstehe!«, sagte Danton. »Gehen wir geschwind weiter.«
Nach einer Viertelstunde über den steinigen Pfad, den Kriechgewächse mit gelben Knoten überwuchsen, hatten sie das Tal erreicht. Sie blieben stehen und genossen den Anblick.
Es war hübsch hier. Das Dorf lag knapp zwei Kilometer von ihnen entfernt. Dazwischen gab es üppig bestellte Felder und vereinzelte Scheunen, die offenbar für das Vieh vorgesehen waren. Hinter dem Dorf erstreckte sich von Osten nach Westen der riesige Wald mit seinen hohen Bäumen, bei denen dunkles Grün und Violett abwechselten und eine gewisse Bedrohlichkeit ausstrahlten. Im Nordosten vor dem düsteren Wald lag der See. Die Siedlung grenzte an das Gewässer.
Sato ging voran und murmelte etwas. Kathy blieb einen Moment lang stehen, als sie den ersten Bauern sah. Sie deutete auf ihn.
Der Bauer trug eine weißbraune Kombination und sah im Grunde genommen genau so aus, wie man Leute seines Berufs von alten Trividdokumentationen aus der vorindustriellen Zeit Terras kannte. Er sah einem Menschen sehr ähnlich. Einzig die stark pigmentierte Haut und das grüne filzige Haar unterschieden ihn deutlich von einem Terraner. Er erinnerte Roi an einen Landwirt aus der Zeit, deren Mode er trug.
Verblüfft ließ der Mann seine Mistgabel fallen, als er die drei erblickte. Seine Züge waren grob. Eine große Knollennase prägte sein Gesicht. Zögerlich schritten sie auf ihn zu. Als sie bis auf wenige Meter herangekommen waren, hob er die Forke wieder auf und streckte sie ihnen drohend entgegen.
Sato verneigte sich in asiatischer Tradition, Kathy schenkte ihm ein lächelndes »Hi«. Danton stakste auf ihn zu und blieb dicht vor ihm stehen, immer die Augen auf die bedrohlich spitze Mistgabel gerichtet.
»Bonjour, erlauchter Landbesteller, wir sind Fremde auf der Suche nach Nahrung. Im Buch für intergalaktische Kulinarik steht ihr ganz oben auf der Liste. Darf ich euren Bürgermeister sprechen?«, sagte er auf Rideryonisch. Sie hatten inzwischen genug Zeit gehabt, diese Sprache zu erlernen. Er hoffte, dass dieser Bauer keinen Dialekt sprach.
»Ihr seid von außerhalb? Nistant sei uns gnädig!«
»Wir kommen in Frieden«, versicherte Kathy freundlich.
»Diese Frau trägt lästerliche Kleidung. Ihr bringt Verderben in unser tugendhaftes Dorf!«
Sie begutachteten Kathys Outfit prüfend, doch Danton fand nicht, dass ihre Sachen lasterhaft waren. Eher sexy, und für Mann und Frau sehr schön anzuschauen.
Offenbar gestalteten sich die Verhandlungen zäh, also zog er einen Trumpf aus dem Ärmel. Er besaß etwas, womit man mit jeder vernünftigen Person verhandeln konnte. Aus seiner Tasche kramte er eine Flasche Riffplörre hervor und zeigte sie dem misstrauischen Bauern.
»Gutes Zeug«, meinte er, schraubte sie auf und nahm einen kräftigen Schluck. Dann reichte er sie dem Mann.
Zögerlich ergriff der Bauer die Flasche, schnupperte daran und trank einen tiefen Zug. Als er absetzte, stieß er einen herzhaften Rülpser aus und lachte zum ersten Mal.
»Das ist gut!«
»Sie ist dein. Habt ihr auch so was?«
»Schnaps? Natürlich. Mein Vetter ist Besitzer der Brauerei.«
Roi atmete erleichtert auf.
»Nun guter Mann, wie ist dein Name?«
»Ich bin Kroll, der Bauer.«
»Kannst du uns zu deinem Häuptling bringen?«
Kroll brummelte etwas vor sich hin und deutete mit der Mistforke auf das Dorf.
»Nach dir«, sagte Danton misstrauisch.
Mit der Schnapsflasche in der Hand trabte Kroll voraus. Kathy warf Roi einen vielsagenden Blick zu, dann folgten sie ihm.
Nach einem kleinen Fußmarsch hatten sie das Dorf erreicht. Alles wirkte hier so friedlich und harmonisch – und ebenso primitiv. Roi entschied sich für den Begriff romantisch.
Die runden, mit Stroh gedeckten Häuser aus dunkelrotem Stein und braunem Holz wirkten schlicht. Danton schätzte den technologischen Stand der Bewohner auf das Ende des terranischen 19. Jahrhunderts.
Es gab in diesem Dorf offenbar alles, was das Herz begehrte. Eine Schmiede, Gaststätten, eine Schlachterei und alles, was nötig war, um zu überleben. Dieses Dorf bildete eine kleine Welt für sich. Seine Bewohner lebten isoliert in dieser Idylle.
Nichts für ihn! So schön der Gedanke an dieses beschauliche Leben war, so würde ihm persönlich etwas fehlen: die Ferne. Seine Neugier würde ihn zwangsläufig aus dieser heilen Welt treiben, um das Unbekannte zu erforschen.
Die Bewohner des Dorfes betrachteten die drei misstrauisch. Das hatte Roi nicht anders erwartet. Schließlich waren sie Fremde, und sicherlich hatten die meisten von ihnen selten Besuch von außerhalb.
»Igitt«, entfuhr es Kathy. »Da liegt ja überall Mist auf dem Weg.«
In der Tat verdiente die Straße die Bezeichnung nicht. Es war vielmehr ein markierter Weg aus Dreck und Schlamm. Der Nachteil einer primitiveren Kultur, denn ungehinderte Fortbewegung war ein Luxus der Zivilisation. Was für die Terraner selbstverständlich war, galt oftmals nicht auf anderen Welten.
Sie erreichten ein großes Gebäude. Wie alle anderen war es rund, es unterschied sich jedoch nicht nur aufgrund der Größe von den anderen Häusern, sondern auch in der Form des Dachs: Es hatte einen spitzen Giebel, während die anderen Bauten Flachdächer besaßen.
Das Gebäude schien eine Art Rathaus zu sein. Zwei Männer traten heraus. Kroll ging auf sie zu. Danton verstand nicht, was er mit ihnen besprach. Sie sahen während des Gesprächs mehrmals zu ihnen herüber.
Immer mehr Einheimische umringten sie. Ihre Blicke sprachen für sich: Man musste kein Kosmopsychologe sein, um zu verstehen, dass sie nicht willkommen waren. Dann ging einer der Männer auf die drei zu. Er war hochgewachsen und trug einen Vollbart.
»Ich bin Hurtel, der Bürgermeister dieser Gemeinde. Ich gehöre dem Rat der Ältesten, den Gründern des Dorfes, an. Ihr seid Fremde!«
Wie scharfsinnig! Natürlich waren sie Fremde. Doch Roi machte artig eine Verbeugung und stellte sich und seine Begleiter vor.
»Wir sind Reisende zwischen den Sternen und brauchen neue Vorräte. Wir haben gedacht, dass wir von euch etwas kaufen könnten. Oder tauschen?«
Hurtel brummte.
»Ihr kennt doch Handel, oder? Erwerb? Gewinn? Oder verschenkt ihr alles aus Herzensgüte?«
»Wir schätzen Fremde nicht. Sie bringen Leid und Tod. Hinter den Hügeln leben die Finsteren, jenseits der See die Piraten und hinter den Wäldern die Verdorbenen.«
»Mit finsteren Gestalten und Piraten haben wir auch unsere Probleme«, sagte Kathy lächelnd. Sie trat näher. »Wir wollen wirklich keinen Ärger machen, sondern brauchen Lebensmittel und Getränke. Dieses Dorf haben wir ausgewählt, weil die Menschen hier aufrichtig wirken, und weil es so isoliert ist. Auch wir möchten wenig Aufmerksamkeit erregen.«
Hurtel gab vier Männern ein Zeichen. Sie richteten ihre Mistgabeln auf die drei.
»Folgt mir zum Rat der Ältesten. Sie werden über euer Schicksal richten!«
*
Roi Danton musterte die zehn Würdenträger, zu denen man sie geführt hatte. Bürgermeister Hurtel hatte immerhin die Freundlichkeit, sie vorzustellen. Da war zum einen der Arzt Brinkel, ein dickbäuchiger Mann mit wenigen Haaren auf dem von Mitessern und Flecken übersäten Kopf. Der Polizist Hynrich musterte sie argwöhnisch aus braunen Knopfaugen. Der grobschlächtige Schmied Jork spannte mit auffälligen Bewegungen seine Muskeln, wobei er sicherlich die besten Zeiten bereits hinter sich hatte.
Der Fischer Krydemann war dick, alt und runzelig. Von ihm würde Danton niemals Fisch kaufen. Der bärtige Postmann Lytga blickte sie teilnahmslos an. Postmann? Wozu man wohl einen Postmann in diesem kleinen Dorf brauchte? Feuerwehrmann Kulle schleppte einen dicken Bierbauch mit sich rum und stopfte sich gerade eine Wurst in den Rachen. Daneben stand ein Humpen Bier oder ein ähnliches Gebräu. Trunkenheit im Dienst war hier wohl erlaubt.
Der Wirt Pelzrak schnarchte vor sich hin. Immerhin war das ein Zeichen, dass er noch lebte, ansonsten hätte er bei dem mumienhaften Wesen auf das Gegenteil getippt. Der Bauer Kroll war ihnen schon bekannt und wirkte als einziger freundlich. Der Glaubensmann Spruggel flüsterte Pelzrak etwas ins Ohr. Wie in Zeitlupe öffnete dieser die Augen, um kurz zu nicken und dann weiterzuschlafen.
Das war also der Rat der Ältesten. Immerhin passte der Name wie die Faust aufs Auge.
Glaubensmann Spruggel stand auf.
»Bei Nistant, dem Herrn, gepriesen sei sein Name.«
Die anderen sprachen ihm nach, bis auf Pelzrak, der weiterschlief. Inzwischen perlte sich ein Sabberfaden aus dem halbgeöffneten Mund. Spruggel wandte sich an die Besucher und wurde lauter:
»Ihr seid Ketzer! Die Finsteren haben euch als Spione geschickt. Ich bin dafür, sie auf den Grund des Meeres zu versenken und dann zu verbrennen.«
Wie sollte das vom Ablauf her funktionieren? Danton verkniff sich eine spöttische Bemerkung, denn dafür war die Lage zu ernst. Nur eins war wichtig: Spruggel war kein Verbündeter.
»Hören wir uns an, was sie zu sagen haben«, gebot Hurtel.
»Genau, hören wir ihnen zu! Die haben guten Schnaps«, nuschelte Kroll.
Danton stand auf, verneigte sich höflich vor den Alten und erzählte die Geschichte erneut. Er erklärte, dass sie nur Nahrung wollten und dafür auch bezahlen würden.
»Bezahlung ist gut«, meinte Lytga, der Postmann.
»Nistant sagt, Gier ist Laster! Wir wollen kein Geschäft. Wir haben keine Banken, keine Versicherungen, nichts dergleichen. Vergesst nicht, wieso wir dieses Schicksal auserwählt haben, Freunde«, mahnte Spruggel.
Die anderen dachten über seine Worte nach – falls sie dachten und nicht nur glasig ins Leere starrten. Kulle stieß einen herzhaften Rülpser aus.
»Ischs findd dsch jute Idde mi koffm«, meinte er.
Was zum Teufel hatte er gesagt?
Die Ältesten diskutierten lebhaft. Nur Pelzrak schnarchte weiter vor sich hin und sabberte auf seine Hose. Kathy zupfte ungeduldig an ihrer Kleidung. Sato schien sich auf seinen Atem zu konzentrieren, er wirkte wie immer völlig entspannt.
Roi stand schließlich auf. Er wanderte gelangweilt durch den Raum und betrachtete die karge Einrichtung des Rathauses. In den Vitrinen stand bemaltes Geschirr. Es gab hier keine Urkunden, keine Pokale, keine Reliquien, die an vergangene Epochen erinnerten. Nur schlichtes, handbemaltes Porzellan. An der Wand hingen vier Zeichnungen vom Dorf, dem See und dem Wald.
Endlich erhob sich Hurtel.
»Wir sind zu keiner Entscheidung gekommen. Bis eine fällt, steht ihr unter Arrest!«
Der Bürgermeister gab den zwei Wächtern ein Zeichen. Sie forderten die drei auf, mit ihnen zu kommen.
*
Die Verärgerung war mit Ausnahme des Japaners jedem ins Gesicht geschrieben. Sehr weit waren sie mit ihren Verhandlungen nicht gekommen! Wieder einmal saßen sie in einem Gefängnis. Das wurde langsam zur Gewohnheit auf dem Riff: lebende Gefängniszellen, stinkende Kerker oder nun diese einfache Hütte.
Danton lehnte sich an die Wand und verschränkte die Hände im Nacken. Er hätte ein Buch über Gefängnisse auf dem Rideryon schreiben können. Dann könnte sein Vater, die Leseratte, sich vielleicht doch einmal mit seinem Leben beschäftigen, überlegte er grimmig. Welch pubertärer Gedanke! Das Herumsitzen ging ihm auf den Geist.
Während Sato Ambush im Schneidersitz meditierte, tigerte Kathy nervös auf und ab. Roi blieb gelassen. Diese Bauern würden bestimmt nicht ihr Leben gefährden. Er hatte schon so viel überstanden, dass er wohl kaum von solch einfachen Leuten abgemurkst werden würde.
Schließlich kam es, wie er vermutet hatte. Die Tür der Hütte öffnete sich und Hurtel trat ein. Er blickte die drei mit strengem Gesicht an, ehe er verkündete: »Wir haben entschieden, dass wir euch nicht hinrichten werden. Aber ihr steht unter Beobachtung und werdet vom Rat der Ältesten verhört.«
Der Bürgermeister legte eine dramatische Pause ein. Wartete er auf eine Reaktion? Erweckten seine Worte die gewünschte Wirkung? Roi fragte sich, ob er vielleicht vom alten Wirt Pelzrak verhört werden würde. Dann würde er bestimmt einen Monolog führen.
Hurtel fuhr fort: »Wie es der Brauch vorschreibt, werdet ihr getrennt. Jeder erhält eine Gastfamilie. Diese drei Familien sind natürlich im Rat der Ältesten vertreten und werden euch beobachten. Stellen wir fest, dass ihr vertrauenswürdig seid, werden wir mit euch handeln.«
»Und falls ihr zu einem gegenteiligen Entschluss kommt?«
»Dann werden wir euch entweder im See ertränken, von den Bergen stürzen oder im Wald aussetzen, wo ihr von den Wesen der Finsternis grausam gemeuchelt werdet.«
»Ah.«
*
Roi Danton hatte die zweifelhafte Ehre, im Haus von Hurtel untergebracht zu werden. Er hätte sich lieber einen Aufenthalt beim schläfrigen Wirt Pelzrak gewünscht. Kathy sollte beim Schmied Jork wohnen, während Sato Ambush zum garstigen Fischer Krydemann gebracht wurde.
Der bärtige Bürgermeister führte ihn in sein Heim. Holzfußboden, schlichte Tapete an den Wänden und einfache Möbel aus Holz deuteten nicht gerade auf einen pompösen Lebensstil hin. Offenbar lebten die Bewohner des Dorfes in absoluter Bescheidenheit.
»Füße abtreten!«, forderte Hurtel.
Danton tat, wie ihm befohlen. Er sah sich um. Hier wirkte schon alles etwas bieder auf ihn. Aber auch richtig urig, denn solch eine Einrichtung kannte er auf Terra höchstens noch in den Alpengebieten, wo man Häuser dieser Art unterhielt, um den Touristen ein Gefühl des präastronautischen Lebens zu vermitteln.
»Komm!«
Hurtel winkte ihn herbei. Langsam trat er in das Wohnzimmer ein. Das Feuer loderte romantisch im Kamin. Zwei junge Frauen traten auf ihn zu. Die eine war groß gewachsen, hatte blaue Augen und blondes Haar. Sie ähnelte einer terranischen Nordeuropäerin. Die zweite war kleiner, trug ihr gelocktes, rotes Haar nackenlang. Sie hielt einen Gehstock in der Hand. Warum das denn?
Bei näherem Hinsehen bemerkte er den starren Ausdruck ihrer hellblauen Augen. Das arme Kind war wohl blind, was auch ihren Stock erklärte. Aber sie hatte, gelinde gesagt, eine gute Figur, etwas üppig und sehr anziehend. Die vielen Sommersprossen im Gesicht und auf der Haut störten gar nicht. Nun war er doch froh, nicht bei Pelzrak wohnen zu müssen!
»Das sind Pyla und Carah, meine beiden Töchter.«

Beide kicherten albern. Sehr albern. Waren sie altersgemäß entwickelt?
»Ich sehe deine Farbe. Aber ich sage sie dir nicht«, krähte Carah und lachte. Sie wedelte mit ihrem Stock und traf Pyla am Kopf.
»Pass doch auf, blöde Kuh!«
»Oh, das tut mir leid, meine geliebte Schwester. Du weißt, ich würde dich nie absichtlich verletzen. Ich liebe dich doch.«
Pyla lachte nun auch.
»Ich habe dich doch auch lieb, Schwesterherz.«
Die beiden umarmten sich und gaben sich einen Kuss auf die Lippen. Ihr Verhalten war dumm, aber auch nett. Roi fand es hier von Minute zu Minute gemütlicher. Doch als Carah wieder mit ihrem Blindenstock umher fuchtelte, hielt er lieber einen Sicherheitsabstand ein. Dabei stieß er an die Türöffnung und hielt sich fest. Die Blinde trat auf ihn zu. Natürlich, sie hörte ihn.
»Woher kommst du, Fremder?«, fragte sie. Sie tastete nach ihm, bekam seinen Arm zu fassen. Ihr Vater und ihre Schwester, die ihm vielsagend zublinzelte, verschwanden in der Küche. Offenbar wollten sie das Essen zubereiten.
Carah nahm ihn bei der Hand und führte ihn zu einem Sofa, in das sie sich setzte. Er nahm neben ihr Platz.
»Darf ich dich berühren?«
Er grinste.
»Natürlich darfst du das …«
Nur eine Sekunde später hatte sie ihm auf die Nase gehauen. Der stechende Schmerz trieb ihm die Tränen in die Augen.
»Ups, tut mir leid.«
Sie nahm einen zweiten Anlauf und tastete mit ihren zarten Händen sein Gesicht ab. Diesmal piekste sie in sein Auge. Mit einem unterdrückten Schrei zog er den Kopf zurück.
»Oh nein! Ich bin wirklich ein Tollpatsch!«
»Oui …«
Sie legte ihre Hände in den Schoss und senkte den Kopf. Nun tat sie ihm leid. Er wollte freundlich sein.
»Nicht so schlimm. Du bist also Carah, Tochter des Bürgermeisters. Tja, mein Vater ist auch eine Art Bürgermeister …«
»Wirklich? Er regiert eine Stadt?«
»Meistens. Manchmal auch aus einem Raumschiff heraus …«
»Was ist ein Raumschiff?«
Es war wirklich gut gewesen, die Raumfähre vor diesen Menschen zu verstecken. Sie kannten in der Tat keine Raumfahrt, er musste also bei seinen Erzählungen achtgeben. Das gäbe sonst einen kulturellen Schock und unnötige Konflikte. Obgleich Hurtel vorhin nichts gesagt hatte, als Roi erklärte, sie seien Reisende zwischen den Sternen. Vielleicht hatte der Bürgermeister ihn auch nicht verstanden.
»Ein Raumschiff ist ein besonderes Schiff. Damit umsegeln wir die Inseln. Weil zwischen denen so viel Raum ist, heißt es Raumschiff«, umschrieb er es elegant.
»Von wo kommst du her, Sohn eines Bürgermeisters?«
Sie wandte ihm ihr fragendes Gesicht zu. Das sah niedlich aus. Carah war eine schlichte, natürliche Schönheit vom Lande.
»Im Grunde genommen bin ich heimatlos und drifte zwischen den Reichen hin und her auf der Suche nach Abenteuern.«
»Das klingt gefährlich. Aber auch wir haben Abenteuer. Die Mutigen stellen sich an den Rand des Waldes. Da ist es gefährlich. Besonders in der Dunkelheit.«
»Ah …«
»Bist du verheiratet, Roi Danton?«
»Nein.«
Sie kicherte verlegen. War sie auf der Suche nach einem Partner? Viel Auswahl hatte sie in dieser kleinen Siedlung wohl nicht. Nun, er hatte sicherlich nicht die Absicht, dieses Mädchen zu heiraten.
Praktischerweise kamen Pyla und Hurtel aus der Küche, was ihn einer Antwort enthob. Sie trugen Schalen und Teller mit wohlduftendem Essen.
Die blonde Tochter setzte sich ihm gegenüber. Sie wirkte kühl und zurückhaltend. Doch während Hurtel zum Gebet einstimmte, um Nistant zu huldigen, spürte Danton Pylas Fuß, wie er an seinem Unterschenkel hochwanderte und sich ziemlich schnell seinem Schritt näherte. Er rutschte eilig zurück und stieß dabei sein Glas Wein um. Der Bürgermeister wurde dunkelrot vor Zorn.
»Wie kann man es als Fremder wagen, ein Gebet an Nistant zu stören?«, ereiferte sich Hurtel. »Ich befürchte langsam, dass Ihr ein Dämon seid, der von den Finsteren geschickt wurde.«
»Die Finsteren«, wiederholten Carah und Pyla ehrfürchtig.
Roi entschied sich, nichts von Pylas umtriebigem Fuß zu erzählen, und entschuldigte sich artig.
Nachdem sie das Gebet an Nistant beendet hatten, wünschte Hurtel seinen beiden Töchtern und dem Gast eine gesegnete Mahlzeit. Roi betrachtete die Köstlichkeit. Sie sah aus wie Kartoffeln mit Bratensauce, Gemüse und Hackfleisch und schmeckte auch ähnlich gut.
»Wer sind die Finsteren?«, fragte er schließlich.
»Die Finsteren …«, sagten Pyla und Carah ehrfürchtig.
»Ja …! Nun?«
Hurtel blickte seinen Besucher streng an. Nachdem er den ersten Bissen aufgekaut hatte und einen Schluck aus dem Bierglas genommen hatte, antwortete er: »Sie sind die Ungeheuer aus dem Wald, im Gebirge und in der See. Selbst wenn wir wollten, würden wir niemals zur nächsten Stadt gelangen, denn die Finsteren töten jeden, der eine der drei Passagen überquert.«
»Die Finsteren sind grausame Monster mit reißenden Zähnen«, behauptete Pyla.
»Woher weiß man das, wenn sie jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt?«
Die drei zögerten.
»Die Finsteren kommen zuweilen sogar ins Dorf, wenn sie durstig sind oder uns bestrafen wollen. Daher kennen wir ihr Aussehen. Doch der letzte Besuch ist lange her. Wenn wir sie nicht herausfordern, lassen sie uns in Ruhe.«
Tatsächlich war das Dorf also eine fast völlig abgeschottete Welt. Es gab keinerlei Kontakt zur Außenwelt, und offenbar hatte kein lebender Dorfbewohner jemals diese Region von wenigen Quadratkilometern verlassen.
Sie würden hier sicherlich keine Informationen über die Struktur des Riffs erhalten, aber zumindest Nahrung. Also lenkte Roi wieder auf den Grund ihres Besuchs.
»Das Essen ist vorzüglich. Deshalb wären wir froh, wenn wir mit Ihnen Handel treiben dürften. Wenn Sie uns erlauben, Vorräte für ein bis zwei Monate von Ihnen zu kaufen, würden wir uns sehr erkenntlich zeigen.«
Hurtel lehnte sich zurück, er wirkte gelangweilt.
»Was können Sie uns schon geben? Wir haben alles, was man zum Leben benötigt.«
Danton war überrascht.
»Haben Sie das? Was ist mit Luxusgütern? Trivid? Musikanlagen? Spielekonsolen? Schmuck, Kleider und Schminke für die Frauen?«
»Hokuspokus, der den Buuraler verdirbt. Wir brauchen das nicht.«
»Wirklich? Wie sieht es mit Medizin aus? Medizin, die ihrer Tochter das Augenlicht wiederschenkt?«
Carah zuckte überrascht zusammen und bewegte sich nervös. Hurtel blickte Roi wütend an. Offenbar hatte er einen wunden Punkt getroffen. Nun war er im Vorteil.
»Ist das wirklich möglich?«, fragte Carah schließlich. Ihr Vater brauste auf.
»Humbug! So etwas könnte nur Gott Nistant. Ihr wollt Euch doch nicht etwa mit ihm gleichsetzen, Ketzer?«
Hurtels Gesicht und Hals nahmen die dunkelrote Färbung an, die Roi nun schon kannte. Deshalb beachtete er ihn nicht, sondern wandte sich an Carah. Er nahm ihre Hand und sagte sanft: »Auch in unserer modernen Welt ist es manchmal schwierig, doch in der Regel kann Blindheit geheilt werden.«
»Es reicht!«, brüllte Hurtel und stand auf. Er eilte zur Wand, nahm sein Schrotgewehr, lud es und richtete es auf ihn.
»Ich dulde es nicht, dass Ihr meiner Tochter Flausen ins Ohr setzt. Sie ist blind und wird es immer bleiben. Das ist ihr Schicksal, wie der erhabene Nistant es beschloss. Basta! Geht jetzt in Euer Zimmer! Pyla, begleite ihn und achte darauf, dass er keine Dummheiten anstellt!«
Die Blondine stand auf und nahm seine Hand.
»Komm«, flüsterte sie und zog leicht an seiner Hand. Als sie sein Zimmer erreichten, schmiegte sie sich an ihn. Roi ahnte, was jetzt kam. Sie säuselte ihm ins Ohr. »In einer Stunde werde ich auf der Terrasse auf dich warten.«
Sie kicherte und blickte ihn aus blauen Augen unschuldig an. Dann gab sie ihm einen Kuss auf die Wange und eilte schmunzelnd davon. Roi blickte dem Mädchen nachdenklich hinterher. Auf der anderen Seite, wieso eigentlich nicht? Etwas Zerstreuung tat sicherlich gut nach dem Disput mit Hurtel. Welch eine Gesellschaft! Wie es wohl Kathy und Sato erging?
*
»Eine Pararealität ist eine Surrealität in Kontrast zu unserem Universum. Doch vom Standpunkt des anderen Universums aus betrachtet ist es Normalität«, erklärte Sato Ambush. Seine Zuhörer liefen ihm nicht davon, weil ihre Stühle rund um den Küchentisch standen. Das Abendessen dauerte an diesem Tag schon sehr lange.
Krydemann stopfte sich noch etwas von dem gegrillten Fisch in den Rachen, während seine beleibte Frau Lachsee gelangweilt strickte. Nur der junge Paddy lachte freudig. Dabei sabberte er etwas vor sich hin, doch das störte Sato nicht.
»Paddy Paraversum. Findet lustig.«
Der Sohn des Fischers kicherte und klatschte mehrmals in die Hände. Ambush schenkte ihm ein gütiges Lächeln und fuhr fort: »Die Pararealistik sehe ich als einen Seitenweg der fünfdimensionalen Kosmologie. Die Wirklichkeit ist rein subjektiv.«
Krydemann fing an zu husten.
»Was ist das für ein Schwachsinn, Mann? Die Wirklichkeit ist wahr! Ist dieser Grillfisch hier vielleicht nicht wahr?«
Der Japaner schenkte dem Fischer ein mildes Lächeln.
»Krydemann-San, ist das wirklich so? Ich empfinde die Realität als eine von unendlich vielen Ausdrucksformen der Natur. Unter bestimmten Umständen, etwa durch die Einwirkung eines psionischen Feldes, kann die bekannte Wirklichkeit durch eine Ausdrucksform abgelöst werden, die dem Menschen als unwirklich erscheinen kann. Für den Pararealisten hat aber diese Wirklichkeit genauso viel Realität.«
Krydemann lutschte die Gräten ab und griff nach dem Brot. Er kaute.
Paddy starrte ihn fragend an. Das wunderte ihn bei genauerem Nachdenken nicht. Er hatte sich hinreißen lassen. Es war vielleicht zu viel verlangt, dass der Junge die Zusammenhänge der Pararealistik verstand. Auch Fischer Krydemann und seine Frau Lachsee blickten ihn unter gesenkten Lidern ungläubig an.
»Nun, die Pararealistik ist eine friedliche Wissenschaft. Wie auch wir friedlich sind. Alles, was wir möchten, ist, unsere Nahrungsreserven aufzufrischen. Dann reisen wir wieder ab«, erklärte er.
»Solange Sie dann verschwinden, soll es mir recht sein«, nörgelte Lachsee. »Sie verderben noch unseren Jungen!«
Der Japaner lächelte geduldig. Das war die typische Einstellung von Lebewesen, deren Kultur wenig mit Wissenschaft zu tun hatte. Sie fürchten ganz offensichtlich das Neue. Nun, er bedauerte dies, aber wenn seine Erklärung half, dass sie ihnen die Nahrungsmittel zur Verfügung stellten, hatte sie doch einen Nutzen.
Er setzte sich im Schneidersitz vor Paddy und sah den Behinderten an.
»Eine weitere Weisheit ist das Ki!«
»Das Ki?«, fragte Paddy.
Er nickte.
»Das Ki ist eine Kraft, die Körper und Geist verbindet. Sie könnte auch dir helfen, besser mit dir und deiner Umwelt umzugehen.«
Vielleicht war er tatsächlich in der Lage, dem eingeschränkten Paddy ein wenig zu helfen. Womöglich gelang es dem Jungen, seine Behinderung zu verstehen und damit besser zu leben.
Es klopfte an der Tür. Seufzend wuchtete sich Lachsee von ihrem Stuhl und ging zur Tür.
»Klopf, Klopf!«, lachte Paddy.
Lachsee kehrte in Begleitung einer hochgewachsenen Blondine zurück.
»Pyla! Pyla!«, rief Paddy und klatschte in die Hände.
»Paddylein! Heute ist doch die Feier in der Dorfscheune. Kommst du mit? Jock ist auch da. Und ich natürlich!«
Paddy lachte schrill.
»Darf Paddy?«
»Na, wenn es sein muss«, meinte Krydemann und griff sich den nächsten Fisch. Allmählich leerte sich die Platte. Pyla starrte Sato Ambush an, der sich freundlich verneigte.
»Du bist auch so ein Fremder. Ihr seid nett. Ich mag euch. Besonders den Roi. Der kommt …«
Pyla schwieg plötzlich und sah zu Lachsee und Krydemann herüber. Dann beugte sie sich zu Sato und flüsterte ihm ins Ohr, dass Danton auch an der Feier teilnehmen würde. Das überraschte ihn keineswegs, denn bei dieser Begleitung würde Rhodans unternehmungslustiger Sohn sicher nicht zuhause bleiben. Er hoffte, Danton würde keine Dummheiten begehen.
»Jock holt dich nachher ab, Paddylein! Bis bald!«
Pyla winkte und Paddy wedelte lachend zurück. Immerhin erfüllte es Sato mit Freude, dass die Dorfbewohner sich so rührend um den Zurückgebliebenen kümmerten. Er beschloss, vor der Veranstaltung ein wenig zu ruhen.
*
Kathy gingen die lüsternen Blicke des Beaus Jock langsam auf die Nerven. Der Sohn des Schmiedes Jork grinste sie permanent an. Zwar wurde sie hier gut behandelt, doch sie kam nicht weiter. Sie musste bei allem, was sie sagte, vorsichtig sein. Um zumindest Jock den Wind aus den Segeln zu nehmen, erzählte sie von ihrem Verlobten Aurec. Sie bemerkte, dass er nicht begeistert war, dass sie einen Freund hatte. Aber vielleicht kapierte er so am schnellsten, dass sie kein Interesse an ihm hatte.
Immerhin war die Familie des Schmiedes ihr wohlgesonnen. Das konnte ein Vorteil sein. Sie waren nicht abgeneigt, dem Handel mit den Vorräten zuzustimmen, und hatten offenbar einen guten Eindruck von ihr bekommen. Kathy vermutete, dass es Sato Ambush ähnlich erging. Bei Roi war sie sich jedoch nicht so sicher.
Jock ließ sie allein. Endlich war sie seine Blicke los. Doch nach wenigen Minuten kam er wieder.
»Willst du mit mir auf eine Feier gehen? Alle sind dort. Die ganze Dorfjugend. Wir feiern den Erntesegen.«
Wenn Jock hoffte, sie abzuschleppen, hatte er sich aber gewaltig geschnitten. Dennoch wollte sie mitkommen. Es schadete nichts, sich mit den Dorfbewohnern anzufreunden. Schließlich wollten sie etwas von ihnen.
Nachdem Jock sie erneut allein ließ, stöberte Kathy in ihrem Zimmer herum, fand aber nichts von Bedeutung.
Nach einer Weile klopfte ihr neuer Verehrer an ihre Tür. Es wurde Zeit für die Feier.
Die Meditation
Sato Ambush bevorzugte es, der Feierlichkeit fernzubleiben. Er suchte die Ruhe der Pararealität. Dazu verweilte er im Schneidersitz auf dem geflickten Teppich vor seinem Bett. Die Augen geschlossen, öffnete er seinen Geist und fühlte in die unbekannte Welt hinein. Vor seinem geistigen Auge bauten sich tausende potenzieller Welten mit ihren Möglichkeiten auf. Ein Wirrwarr aus Zeit, Raum, Phantasie, Realität und Lug und Trug huschten an seinem Verstand vorbei. Er prüfte keine der Pararealitäten, vielmehr lauschte er aus seinem Abstand heraus auf ihre Melodie. Er wusste nicht, wonach er suchte. Doch er würde es erkennen.
Sein Bewusstsein schien durch die Zeiten und den Raum zu fliegen. Sanft wie eine Feder im Wind wurde er durch die Realitäten getragen. Ein wohliges Gefühl der Freiheit und des Friedens machte sich in ihm breit. Er flog durch weiße Wolken. Hier und da brachen sie auf, zeigten in roter, blaue, grüner oder goldener Farbe Portale zu den Parawelten.
Plötzlich riss ihn etwas aus der Harmonie. Verzweiflung! Tod! Schicksal! Sato hielt inne und verharrte gleich einem Vogel auf der Stelle. Der Riss leuchtete dunkelrot. Alles in ihm rief: Geh nicht hinein. Doch er hatte keine Wahl. Das Leid, welches in grimmigen Wellen aus der Öffnung der Pararealität strömte, zog ihn an. Er spürte etwas Vertrautes dort. Es war ein bekanntes Leid.
Perry Rhodan?
Sato tauchte durch das rote Leuchten. Sein Astralkörper schwebte über eine idyllische Landschaft im US-Bundesstaat Connecticut. Unter ihm erkannte er die St. James Kirche in ihrer weißen Pracht. Er sank hinab, bis er vor der Kirche stand.
Er sah sich um. Es war ein kalter Herbsttag, Wind trieb das Laub über die Straße. Von rechts kam ein hochgewachsener Mann mit bleichem Teint und pechschwarzem Haar, welches zum Pferdeschwanz gebunden war. Die Kleidung wirkte altmodisch.
Doch was wusste Ambush schon? Wann war er? Er war auf Terra, doch in welcher Epoche? Er sah sich um, erkannte Autos. Auf einem Schild wurde Franklin D. Roosevelt vorgestellt. Es war ein Wahlwerbeplakat. Es warb für die dritte Amtszeit von Roosevelt. Demnach musste es 1940 sein.
Eine große Tür öffnete sich. Er blickte zurück zur Kirche mit dem hohen Turm und sah, wie Besucher einer Predigt die Kirche verließen. Intuitiv starrte Ambush auf die vierköpfige Familie. Mann, Frau, ihre Tochter und ihr Sohn. Der Kleine blieb stehen, sah zu dem nobel gekleideten Mann mit dem pechschwarzen Haar. Seine Mutter rügte ihn. »Träum nicht, Perry!«
Perry! Perry Rhodan!
Der Bleiche schob sich durch die Menge. Er blieb vor den Rhodans stehen.
»Können wir Ihnen helfen, Sir?«, fragte Jakob Edgar Rhodan.
»Ein passender Ort, finden Sie nicht?«, erwiderte der Fremde.
»Wofür?«
»Für euer Begräbnis. Ihr müsst nicht weit transportiert werden.«
Der Fremde stieß einen Schrei aus. Sein Gesicht veränderte sich, mutierte zu einer grässlichen Fratze mit dolchscharfen Zähnen. Flügel traten aus dem Rücken hervor und zerfetzten den Frack. Die Bestie packte Jakob und drehte den Kopf herum. Das Genick zerbrach.
Ambush war wie gelähmt. Perry, nein! Er wollte eingreifen, rannte auf den Angreifer zu, doch er lief einfach durch ihn hindurch. Sein Astralkörper hatte hier keine Macht.
Die Menschen schrien, wollten weglaufen. Rhodans Mutter Mary sackte zu Boden. Blut spritzte aus ihrem Hals. Der Fremde griff nach Deborah und Perry, zog sie mit in den Himmel, fünfzig Meter, einhundert Meter hoch. Die Kinder schrien um Hilfe. Dann ließ er sie los. Sato wandte den Blick ab, als sie auf dem Asphalt aufschlugen.
Perry Rhodan war tot. Tot! 1940. Unmöglich! Alles würde sich ändern.
Die Kreatur drehte in der Luft und steuerte direkt auf Sato zu. Aber wie war das möglich?
Du wirst es nicht aufhalten können, flüsterte eine Stimme in seinen Gedanken. Instinktiv wich er zurück, blickte in die schwarzen Augen des Wesens und spürte die Krallen des Fremden in seiner Brust. Er war wehrlos, empfand Schmerz. Doch er war doch nur Astralkörper? Wie war das möglich?
Sato Ambush schreckte hoch. Schweiß rann von seiner Stirn. Er saß verkrampft auf dem geflickten Teppich, das Kerzenlicht loderte schwach in der Lampe. Sato war wieder auf dem Rideryon. Er kam sich vor, als sei er aus einem Alptraum erwacht. Ratlos fasste er sich an die Stirn. Wie konnte er dieses Erlebnis in der Pararealität einordnen? Er hatte die Auslöschung der Familie Rhodan im Jahre 1940 erlebt.
Wer war der Fremde mit dem pechschwarzen Haar? Wer war der Mörder von Perry Rhodan?
Die Arawakpiraten
Kapitän Fyntross spitzte die roten Lippen und machte »blubb«. Er lehnte sich tief in den Kommandosessel mit dem schwarzen Lederbezug und betrachtete die runde Zentrale der VIPER. Sie wirkte so gepflegt. So militärisch ordentlich! Rot, Schwarz und Grau regierten das Bild der Brücke. Jedes Pult, jeder Platz war symmetrisch angeordnet. Auf einem Podest stand der Sessel des Kommandanten. Sein Sessel! Direkt davor war der Holoprojektor aufgebaut, der taktische Karten aufzeigte und Aufnahmen der Außenkameras wiedergab.
Die moderne Technik des keilförmigen Raumschiffes mit dem Namen VIPER faszinierte ihn jeden Moment aufs Neue. Die Möglichkeiten, die dieses Raumschiff bot, waren gigantisch!
Wenn nur … ja, wenn es doch nur einwandfrei funktionieren würde. Sie würden Jahre brauchen, um die Technologie der Terraner zu verstehen. Doch es würde ihnen gelingen!
Und dann würde Fyntross zum gefürchtetsten und mächtigsten Piraten im ganzen Resif-Sidera werden.
So glanzvoll und mächtig die achthundert Meter lange VIPER auch war, Fyntross wollte die DUNKELSTERN keinesfalls aufgeben. Es gab drei Dinge, die er wollte: das unbezahlbare Abbild der Ajinah, das technologische Wissen der Terraner und die DUNKELSTERN!
Vor allem das Fehlen des Dritten frustrierte ihn! Niemand durfte ihm sein geliebtes Raumschiff wegnehmen.
Vor siebzehn Chroms hatte er die DUNKELSTERN von Harekuul-Marodeuren auf Thol3120 erbeutet. Ein Meisterstück war es gewesen. Noch heute erinnerte er sich mit Freude an seine Tat. Sie hatten den Überfall lange vorbereitet und geduldig gewartet, bis sich die Umlaufbahnen der Tholmonde 3120, 3121 und 3122 kreuzten.
In dieser Zeit kam es immer zu Interferenzen, Gravitationsstürmen und Erdbeben. Eigentlich eine Periode, in der sich jeder Bewohner dieser Tholmonde verkroch, bis die Monde sich wieder voneinander entfernten. Doch Fyntross und seine Crew hatten den Naturgewalten getrotzt und ohne großen Widerstand die DUNKELSTERN gekapert.
Es war sein Verdienst gewesen, die DUNKELSTERN in dieser turbulenten Phase aus dem Gravitationsbereich der Monde zu steuern. In dieser Zeit hatte sich auch sein Erster Offizier Krash seine Lorbeeren verdient, denn der Manjor war es gewesen, der vorgeschlagen hatte, die Schutzschirme der Marodeurstation auf dem Mond zu deaktivieren. Damit war das Schicksal der Harekuul besiegelt gewesen, denn ihr Unterschlupf war ohne Schutz den Gravitationskräften zum Opfer gefallen.

Damit war die DUNKELSTERN in seinen Besitz übergewechselt. Es hatte keinen mehr gegeben, der das Schiff hätte beanspruchen können.
Seitdem galt Fyntross mit seiner Crew nicht nur als hervorragender Navigator, sondern als gefährlicher und gnadenloser Arawakpirat. Ein Ruf, den der Battunus auch sorgsam pflegte.
Doch nun hatte er neue Widersacher. Dieses hässliche, bleiche Geschöpf mit den Stoppelhaaren im Gesicht und den rötlichen Haaren! Seine Flossen schlackerten beim Gedanken an diesen fremdartigen Terraner.
Dieser Roi Danton war mit allen Wassern gewaschen. Noch nie war er einem gefährlicheren Kontrahenten begegnet. Aber auch er würde sich eines Tages geschlagen geben müssen. Allerdings würde die Auseinandersetzung nicht leicht werden, denn jemand, der den Ylors entkam, war nicht zu unterschätzen.
Dem Battunus war nach etwas Abwechslung. Er watschelte in die Kabine neben der Zentrale, die eigens für den neuen Kommandanten hergerichtet worden war.
Das Licht war gedämpft. So mochte er es. Es war viel zu hell auf der Brücke der VIPER. Leuchtende Wände, viel Licht und Blinken, wie auf einem Jahrmarkt der Gannel. Es fehlte nur noch lärmende Musik und unkontrollierter Tanz. Doch wer wusste schon, was diese seltsamen Terraner so auf ihrer Kommandozentrale zelebrierten? Eigentlich störte ihn, dass es hier so sauber war.
Fyntross betrachte die neu gestaltete Kabine. Die Wände waren nun in einem heimeligen Grün. In der Mitte befand sich ein Becken mit lauwarmem Wasser, dazu viel Schilf und Schmutz. Eigens für ihn eingerichtet. So liebte Fyntross seine Umgebung. Genauso wie zu Hause in den Tiefen des Kuturatsees, in seinem Heimatland Batta.
Das schwüle, warme Klima von Batta fehlte ihm. Er vermisste den ständigen Regen und die wunderbaren Sumpfgebiete. Doch er war ein Außenseiter, ein Verbrecher. Fyntross konnte sich in der Hauptstadt Battoval nicht mehr blicken lassen. Ein Kopfgeld war auf ihn ausgesetzt. Es würde deutlich höher sein, wüssten sie, dass er das Abbild der Ajinah bald wieder in seinem Besitz haben würde.
Während Fyntross in das Becken stieg und die Feuchtigkeit auf sich wirken ließ, dachte er an den bronzefarbenen Schimmer der drei Millionen Metropole, umgegeben vom Kuturatsee. Andere Völker bezeichneten sie aufgrund ihrer Architektonik auch als Stadt der Muschelschalen und Krebspanzer.
Was würde Fyntross für eine triumphale Rückkehr geben. Als Herrscher über Batta, König der Battunus würde er heimkehren. Vielleicht. Eines Tages …
Er tauchte in das Becken, ließ das Nass durch die Kiemen strömen und genoss das wohlige Gefühl. Hier konnte er besser nachdenken.
Wie würde es ihm gelingen, die DUNKELSTERN wieder in seinen Besitz zu bekommen?
Wie könnte er es schaffen, Ajinahs Bildnis zu beschaffen?
Krash stürmte in seine Kabine und signalisierte Fyntross, sein Bad zu beenden. Der schnellte mit einem Sprung aus dem Becken und watschelte triefend auf den sechsarmigen Manjor zu. Krash war gut einen Kopf größer als Fyntross, der es gar nicht mochte, wenn er zu jemand aufsehen musste. Der Erste Offizier nahm Haltung an. Sein graubraunes Fell war filzig. Krash hätte durchaus auch mal ein Bad nötig.
»Was gibt es?«
»Eine Nachricht von Thol2777. Nachfolger von Bullfah ist dessen Vetter Mumdök. Der ist noch ruchloser und fetter als er.«
Mumdök war in der Tat ein ziemlich wuchtiger Persy. Gegen ihn war Bullfah ein Gerippe gewesen. Mumdök gehörte zur Persyallianz, eine der größten Organisationen des Rideryons.
»Mumdök will Euch sprechen, Kapitän. Er ist an der VIPER interessiert.«
Natürlich war er das. Schließlich stellte die fremde Technologie einen neuen, ungeahnten Machtfaktor für alle Arawakpiraten und Mafiafamilien dar. Doch Fyntross wollte das Geheimnis der Macht nicht einfach an Mumdök abgeben.
Er hatte die VIPER erbeutet und sie gehörte ihm!
Dennoch wusste er, dass dieses Raumschiff Reparaturen benötigte und dies nur möglich war, wenn man die Technologie verstand. Er selbst und auch seine Crew waren dazu nicht in der Lage. Mumdök hatte Beziehungen zu den Gannel und den Hamamesch. Beide Völker galten als beste Wissenschaftler Rideryons. Mit ihrer Hilfe könnte er die VIPER reparieren, womit sie das beste Schlachtschiff im gesamten Resif-Sidera wäre.
Die VIPER war unvergleichlich, sah man von den Raumern der Jaycuul-Ritter und der legendären STERNENMEER einmal ab. Doch die STERNENMEER existierte nur in Ammenmärchen. Angeblich war es das Schiff des Gottes Nistant gewesen, welches jederzeit in Nullzeit jeden Ort im Resif-Sidera erreichen konnte. Ihre Feuerkraft stand der einer Raumflotte in nichts nach, und am schlimmsten war der Sternenkalmar. Dieses Ungeheuer aus einer fernen Tiefe namens Hyperraum verschlang ein Raumschiff regelrecht.
Seit unzähligen Chroms kursierten die Gerüchte von dem Ungeheuer aus dem Jenseits, dessen Herr der Gott Nistant war. Kein Lebender hatte es gesehen.
Die Jaycuul galten als einziges Überbleibsel aus der goldenen Zeit des Nistant, welche Millionen von Chroms zurücklag. Es war höchst unwahrscheinlich, dass die STERNENMEER oder der Kalmar jemals wieder auftauchen würden. Um so begehrenswerter war daher die VIPER.
»Stell mir eine Verbindung mit dem Fettsack her. Ich rede mit ihm«, befahl Fyntross.
Krash knurrte grimmig und legte umgehend per Fernsteuerung eine visuelle Kommunikationsverbindung auf den Wandmonitor. Mumdök wurde sichtbar. Das schleimige Gesicht des blubbernden Persy füllte den ganzen Bildschirm aus. Die gelbbraune Haut des Mollusken schimmerte feucht. Der Kopf ging halslos über in den Torso, dessen länglicher Fortsatz für eine Fortbewegung sorgte. Vier Tentakel dienten als Greifwerkzeuge.
In Batta galten Seeschnecken als Grundnahrungsmittel. Die Herausforderung hatte früher darin bestanden, ihre Schale zu knacken. Doch das lag Äonen zurück. Das war eine Zeit gewesen, in der die Battunus noch nicht einmal von den Tholmonden träumten. Nun waren die Seeschnecken an der Spitze der Nahrungskette. Oder zumindest seinem Volk überlegen. Für den Moment jedenfalls.
»Ehrenwerter Mumdök!«
»Kapitän Fyntross. Wie geht es Ihnen? Meine Gratulation zur Eroberung dieses Raumschiffes. Weniger erfreulich ist das Ableben von Bullfah und der Verlust des Bildnisses der Ajinah. Ihr wisst, dass Ihr mit Euren Beutezahlen im Rückstand seid. Papa Yomoh ist ungehalten.«
Innerlich brauste Fyntross auf, aber er zeigte es nicht. Immer diese Zahleneintreiber! Für sie gab es nichts anderes als Zahlen. Dabei hatte er in der Vergangenheit immer reichlich Beute zur Persyallianz gebracht. Gut, sie hatten ihn fürstlich entlohnt und diverse Verbesserungen und Reparaturen an der DUNKELSTERN bezahlt, doch seiner Meinung nach waren sie quitt. Betont ruhig gab er Antwort:
»Bullfah fiel seiner eigenen Fettleibigkeit zum Opfer. Er war einfach zu unwiderstehlich für die Ylors. Und das Bildnis der Ajinah wie auch die DUNKELSTERN werden bald in meiner Hand sein. Ich werde Roi Danton und seine Leute finden.«
Mumdöks Augäpfel quollen hervor. Der Battunus wusste, dass dies als eine Art böser Blick des Persy zu interpretieren war.
»Wir haben andere Pläne. Vergessen Sie nicht Ihren Beuteplan in diesem Jahr. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie Ihre Ziele erfüllen, damit sie ein produktiver Kopf bleiben.«
Die Männer der Persyallianz waren nichts weiter als hohle Geschäftsmänner. Sie waren niemals an der Front und wussten nichts vom eigentlichen Piratenleben. Bullfah war das beste Beispiel. Wenn mal einer wie er an einem Feldzug teilnahm, sah man ja, wie das endete.
»Mit der VIPER habe ich bereits mein Jahresziel erfüllt. Mit diesem Raumschiff ist uns keine Handelskarawane und keine Resif-Polizei gewachsen, Mumdök!«
»Korrekt. Wir befürchten jedoch, Sie könnten das wertvolle Raumschiff im Kampf gegen Danton wieder verlieren.«
Das war ja wohl die Höhe. Hatten die denn überhaupt kein Vertrauen in seine Fähigkeiten?
»Mit der VIPER kann ich Danton, die DUNKELSTERN und das Bildnis von Ajinah bekommen. Denken Sie doch einmal an den Ruhm, wenn Ihr produktiver Kopf sein Ziel um das Hundertfache überschreitet. Papa Yomoh wäre stolz auf Sie.«
Mumdök atmete schwer. Das gurgelnde Schnauben war ein Anzeichen, dass er angestrengt nachdachte. Fyntross wusste, dass die Gier stärker war als seine Vorsicht. Die Aussicht auf eine so große Beute musste den Geldsack einfach überzeugen.
»Ich möchte mir selbst ein Bild von der VIPER machen. Da Sie offenbar nicht gewillt sind, nach Thol2777 zurückzukehren, werde ich an Bord kommen.«
Auch das noch! Ein weiterer Persy, der an einem Beutefeldzug teilnehmen wollte. Das endete bestimmt mit Mumdöks Tod. Was eigentlich auch nicht schlimm für Fyntross war.
»Ich benötige fähige Wissenschaftler an Bord. Sie sollen die Technik der Terraner studieren. Je eher wir in der Lage sind, die VIPER voll funktionsfähig zu bekommen, desto schneller werden wir erfolgreich sein. Und das ist doch Euer Wunsch?«
Mumdök sabberte grünen Schleim. Das war wohl ein Ja. Fyntross gab seine Koordinaten durch, als Krash ihm ein Zeichen gab. Artig und höflich bedankte sich der Kapitän bei seinem Vorgesetzten und beendete die Verbindung.
»Was ist?«
»Unsere Abtaster haben Signale eines der Beiboote der DUNKELSTERN aufgefangen.«
Eilig begaben sie sich in die Zentrale.
Mit einem Knopfdruck aktivierte der Manjor die Holographie des Resif-Sidera. Zwei Punkte leuchteten auf. Langsam zoomte die Karte näher und zeigte den Standort der Signale.
»Eines kommt aus dem Niemandsland zwischen der Licht- und Dunkelzone. Das andere kommt einhunderttausend Kilometer entfernt aus einer dicht besiedelten Region der Gannel.«
Danton hatte es gut verstanden, die DUNKELSTERN vor ihm zu verstecken. Das war kein Wunder, denn sie besaß das beste Tarnsystem aller Arawakpiratenschiffe. Dass die Beiboote jedoch ein spezielles Signal ausstrahlten, schien ihm entgangen zu sein. Es war ein Transponder. Nur wer wusste, nach welchem Signal er suchte, konnte den Code richtig interpretieren. So war die Crew der DUNKELSTERN in der Lage, ihre Beiboote zu lokalisieren.
Und natürlich wusste Krash den Code und hatte die Ortung der VIPER entsprechend ausgerichtet. Danton hätte eigentlich den Signalausstoß an sich erkennen müssen, auch wenn er ihn nicht hätte interpretieren können.
Ein törichter Fehler war das, den Fyntross bestrafen würde.
»Haltet Kurs auf das zweite Signal.«
Fyntross nahm in seinem bequemen Sessel Platz und triumphierte. Bald würde er seinen Besitz zurückholen.
Das seltsame Dorf
Die Stunde war vergangen. Es war inzwischen dunkel. Roi stieg aus dem Fenster und kletterte an dem knarrenden Regenrohr die Wand herunter. Unten wartete Pyla. Sie hielt eine Flasche Schnaps in der Hand und grinste ihn an.
Das Mädchen war dick geschminkt, trug eine schulterfreie weiße Bluse und einen rotbraunen Rock. Sein Blick fiel auf ihre Füße. Sie trug braune, absatzlose Sandalen. Auffällig war eine Tätowierung auf dem Fuß. Es waren vier geschwungene Zeichen, die fremdartig wirkten.
Pyla bemerkte seinen Blick.
»Gefallen dir meine Füße?«
Sie kicherte. Ein Hauch von Lüsternheit lag in ihrer Stimme.
»Was bedeutet die Tätowierung auf dem Fußrücken?«
»Das ist mein Name …« Sie hielt kurz inne. »Jeder im Dorf hat seinen Namen eintätowiert. Vater sagt, damit man uns wiedererkennt, sollten wir zu Finsteren werden.«
»Wie kann man denn zu einem Finsteren werden? Und wer sind die Finsteren?«
Sie legte den Finger an die Lippen.
»Psst, jetzt sei still und komm mit.«
Sie gingen ein paar Schritte. Dann hielt sie an, kramte einen Spiegel aus ihrer Tasche und zog den Lippenstift nach.
Er fragte sich, woher sie die Schminke hatte, denn offensichtlich lehnte das Dorf Kosmetikartikel ab, jedenfalls soweit er es mitbekommen hatte. Gab es einen Schwarzmarkt im Dorf der Entlegenen?
»Komm jetzt, wir gehen auf eine Feier der Dorfjugend.«
Das konnte ja heiter werden. Sie griff seine Hand und zog ihn mit sich. Nach etwa hundert Metern auf matschigem Untergrund waren sie an einer schmucklosen Scheune angelangt, aus der Musik kam. Pyla stürmte voran, Roi ging langsam hinterher. Die Musik klang wie eine Mischung aus Toilettenspülung und Türknarren, gemischt mit dem Rhythmus irischer Folklore. Alles in allem sehr seltsam für die Ohren des Zellaktivatorträgers. Aber schon oft hatte er im Laufe seines langen Lebens die eine oder andere eigentümlich klingende Melodie vernommen. Nicht nur bei Extraterrestriern.
Die Scheune war schlicht und so, wie man sich eine Scheune vorstellte. Heuballen türmte sich auf, hier und da hingen Lichter, ein Tresen mit Kästen voll Alkohol war aufgebaut und fauliger Düngergeruch durchzog die Luft.
Die Dorfjugend trank und tanzte ausgelassen. Das war wohl überall gleich im Universum. Der Drang nach Unterhaltung war von Spezies zu Spezies gegeben. Die Art und Weise, wie diese Unterhaltung auskleidet wurde, war freilich sehr unterschiedlich.
Danton ging durch die Scheune und betrachtete die Besucher. Sie alle stammten vom sehr menschenähnlichen Volk der Buuraler ab. Er stockte, als er die schöne Brünette erkannte.
»Kathy!«
Der bullige Schönling neben ihr musterte ihn misstrauisch. »Macht der Typ Probleme?«
»Manchmal«, gab Kathy lächelnd zurück.
Roi schaute zu dem um zwei Köpfe größeren Dorfbewohner hoch. Der würde doch wohl jetzt keine Dummheiten machen?
»Aber er ist ein guter Freund. Er ist unser Anführer und heißt Roi Danton.«
Der solchermaßen Vorgestellte vollzog eine elegante Verbeugung vor dem verdutzten Dorfbewohner.
»Und mit wem habe ich das fragwürdige Vergnügen?«
»Das ist Jock, der Sohn des Schmieds Jork, in dessen Familie ich im Moment gastiere. Jock wollte mir die Dorfparty zeigen.«
»Entzückend. Die Tochter des Bürgermeisters hatte den gleichen Gedanken. Wo ist sie eigentlich?«
Danton sah sich suchend um. Nach ihrer Anmache hatte er von Pyla mehr Nähe erwartet. Nach einer Weile kam die Dorfschönheit auf die drei zu. Vielmehr schwankte sie. Sie torkelte an Roi vorbei, ohne ihn zu beachten, und warf sich Jock an den Hals. Das war ja reizend!
»Wer ist denn deine Freundin da?«, lallte Pyla, die offenbar recht schnell den Schnaps in sich hineingeschüttet hatte. »Habt ihr zwei Lust auf etwas Liebemachen auf dem Heuboden?«
Kathy prustete los, während Jock Pylas Vorschlag offenbar recht interessant fand. Die Terranerin packte Roi am Arm und zog ihn ein paar Schritte zur Seite.
»Wir kommen keinen Meter voran. Jork ist von mir angetan, so wie sein Sohn. Aber seine Frau Elsbetha mag mich nicht. Wir sind in ihren Augen eine Gefahr«, erklärte Kathy.
»Bei mir nicht anders. Die Töchter sind mir offenbar zugetan, aber der Vater mag mich nicht. Wobei unsere betrunkene Schönheit hier ihren Fuß an meiner Männlichkeit reiben wollte und ihre Schwester dringend einen Mann sucht.«
Kathys Blick sprach Bände.
»Ich war gänzlich unschuldig an dieser Situation. Quasi ein Opfer meines eigenen Charmes.«
Sie zog eine Augenbraue hoch.
»Haben wir eine reale Chance, von denen Nahrung zu bekommen? Wenn nicht, sollten wir schnell zurückfliegen und vielleicht den nächsten zivilisierten Supermarkt aufsuchen.«
Manchmal konnte Kathy richtig zickig sein! Sie musste etwas mehr Geduld zeigen. Es brauchte Zeit, um diese Leute von ihrer Friedfertigkeit zu überzeugen. Immerhin schienen die jungen Menschen vertrauensvoller zu sein als die alten.
»Hallo«, rief einer der Dorfbewohner. Der Mann mit den langen, filzigen Haaren zupfte an Rois Kleidung. Speichel rann aus seinem Mund. Er stand schwankend vor Roi und zerrte immer wieder an seiner Jacke.
»Hallo! Hallo! Hallo!«
Nun lachte er. Roi beschloss, ihn zu beachten.
»Bonjour. Und wer bist du nun?«
»Ich Paddy! Ich Paddy! Ich Paddy! Paddy ich!«
Er freute sich wie ein kleines Kind und hüpfte auf und ab. Roi begriff schnell, dass sein neuer Bekannter einen Dachschaden hatte. Armer Kerl! Immerhin schien man sich um ihn zu kümmern und ihn zu akzeptieren. Manchmal wurden Behinderte in primitiveren wie auch industrialisierten Kulturen wie Aussätzige behandelt.
Das Mitgefühl gegenüber Schwächeren machte ihm die Dorfbewohner nun wieder sympathisch und bewies ihm, dass die Buuraler nicht so primitiv waren, wie er angenommen hatte. Der wahre Wert einer Gesellschaft zeigte sich immer im Umgang mit ihren schwächsten Mitgliedern.
»Sei lieb zu unseren Gästen, Paddy«, ermahnte Jock. »Er ist der Sohn vom Fischer. Seit frühester Kindheit ist er so, nachdem er als kleines Kind in den Wald lief und die Finsteren gesehen hatte.«
»Die Finsteren«, krächzte Pyla erschrocken.
»Paddy hat Finstere gesehen. Mit Zähnen aus Blut. So groß und lang! Paddy hat Angst vor ihnen, dass sie kommen und ihn fressen!«
»Ist schon gut«, säuselte Pyla und nahm ihn in den Arm. Der Geisteskranke kicherte.
»Pyla gut. Sie so lieb. Macht Paddy glücklich mit Mund.«
Sie stieß ihn von sich.
»Das sollst du doch nicht sagen!«
Kathy warf Roi einen vielsagenden Blick zu. Er vermutete, dass es ihr hier von Minute zu Minute weniger gut gefiel.
»Was Paddy gefällt, könnte doch auch dem fremden Roi Danton gut gefallen, oder?«, meinte Pyla und schmiegte sich an ihn. »Oder von mir aus auch allen? Wir fünf könnten einen riesigen Spaß haben.«
»Mademoiselle, Ihr seid mir entschieden zu gierig. Ich bevorzuge ein Rendezvous in trauter Zweisamkeit und keine Massenorgie, n’est-ce pas?«
»Nes was?«
»Nicht so wichtig.«
Pyla kicherte, nahm Paddy und Jock bei der Hand und ging mit ihnen auf die Tanzfläche. Roi atmete tief durch. Kathy hatte leider recht. Sie waren weit von ihrem eigentlichen Ziel entfernt. Sie hatten nicht die Zeit, um sich mit Teenagern herumzuschlagen.
Er beobachtete das ausgelassene Feiern. Pyla kehrte torkelnd zurück. Mit jedem Schritt verschüttete sie mehr von ihrem Getränk. Als sie ihn schließlich erreichte, umarmte sie ihn. Kathy verdrehte die Augen und ging zum nächsten Tresen.
»Roi! Du bist der Roi«, nuschelte die Betrunkene leise.
Beeindruckend, sie hatte seinen Namen behalten. Nun kicherte sie wieder und setzte sich auf einen Strohballen. Er nahm daneben Platz und leerte seinen Schnaps. Anders konnte er das hier nicht ertragen. Pyla verschüttete derweil ihr Getränk auf ihrem Rock. Die Dorfschönheit schien das nicht einmal zu bemerken.
»Hasch du eine Schigaredde?«
»Ich habe nicht so recht verstanden.«
Sie machte eine Geste, dass sie rauchen möchte. Es gab also auch Zigaretten hier! Ziemlich lasterhaft für ein Dorf im Paradies. Er hatte keine und meinte, dass Kathy sicherlich eine hätte. Pyla erhob sich schwankend. Zur Sicherheit nahm er ihr Glas. Sie torkelte zu Kathy und brabbelte etwas. Scolar warf ihm einen finsteren Blick zu und gab ihr eine Kippe.
Fröhlich tapste die Buuralerin zu ihm zurück und ließ sich nieder. Sie nahm einen kräftigen Schluck aus ihrem Glas, schaute ihn lüstern an und spuckte dann die Flüssigkeit in sein Gesicht.
Er überlegte, ob sie das jetzt tatsächlich getan hatte oder ob er träumte, während die Flüssigkeit von seinem Gesicht perlte. Irritiert starrte er Pyla an und wischte sich den Schnaps und ihren Speichel ab. Sie kramte einen hellbraunen Leinenpullover aus ihrer Tasche, grinste verlegen und reichte ihm das Kleidungsstück.
»Oh, tut mir leid. Ich bin etwas betrunken. Hier …«
Er verzichtete dankend. Die Rolle des braven Bürgermeistertöchterchens war offenbar nur eine Fassade.
»Ich gebe dir dafür ein neues Bier aus. Einver… einverstanden?«
Er nickte wie in Trance. Sie stand kichernd auf und schwankte Richtung Tresen. Kathy setzte sich zu ihm und bedachte ihn mit einem hämischen Grinsen.
»Sie hat mich bespuckt …«
»Süß.«
Frauen konnten manchmal so grausam sein.
Pyla kehrte mit ihrem Bier zurück und gab es Roi. Dann setzte sie sich hin, lehnte sich zurück und öffnete den Mund.
»Flöße es mir ein …«
Verlangte die das jetzt allen Ernstes? Nun, den Gepflogenheiten der Gastgeber sollte man nicht widersprechen. Behutsam hielt er den Kopf der Flasche an ihre Lippen und ließ das Bier eintröpfeln. Sie schien das irgendwie zu erregen.
Er spürte Kathys Blick auf sich ruhen, drehte sich um und sah sie verlegen an.
»Sag jetzt bitte nichts.«
Kathy sagte nichts.
»Jetzt bist du dran …«, lallte Pyla und nahm die Flasche. Da hatte er etwas dagegen.
»Dein Umgang mit dem Bier ist nicht so vertrauenswürdig. Danke, aber nein. Nimm mal lieber noch einen kräftigen Zug. Und nicht vergessen: schlucken, nicht spucken.«
Roi stand auf und wandte sich Kathy zu, deren Laune sichtlich im Keller war.
»Schlage vor, wir gehen wieder zu unseren Gastfamilien, bevor wir noch Ärger kriegen.«
Kathy stimmte zu. Er verabschiedete sich mit einer knappen Verbeugung von Pyla, die ihn ziemlich böse anblickte. Die beiden Terraner verließen die Dorfscheune und gingen den schlammigen Weg zurück. Nebel zog am Boden entlang. Es war kalt. Eine gespenstische Atmosphäre.
»Schon etwas von Sato gehört?«
»Nein«, antwortete die Terranerin.
Roi brachte Kathy zum Haus des Schmieds und wünschte ihr eine gute Nacht. Diesmal unterließ er jegliche Annäherungsversuche. Es würde sowieso nichts bringen, da sie Aurec absolut treu war. Außerdem war ihm nicht danach. Er hatte genug für heute.
Das Gekicher zweier Dorfbewohner ließ ihn seinen Weg zu Hurtels Haus unterbrechen. Es waren wohl Pyla und Paddy, die laut lachend aus der Scheune in Richtung Wald stürmten. Ihn packte die Neugier und er folgte ihnen. Er wollte keineswegs spannen, doch es wunderte ihn, dass sich die beiden an den Rand des Waldes trauten.
Das Wetter schlug plötzlich um. Dunkle Wolken zogen über das Dorf und es fing innerhalb weniger Sekunden an zu regnen. Roi hielt sicheren Abstand zu den beiden. Pyla tanzte freudig im Regen und Paddy klatschte in die Hände.
»Wollen wir es im Wald treiben?«, fragte Pyla lüstern.
Wenn das ihr konservativer Vater wüsste! Die Jugend ließ sich nur selten beschränken und fand immer irgendwie einen Weg.
»Nein! Paddy hat Angst! Die Finsteren. Wir gehen in Hütte.«
Pyla schüttelte den Kopf und schubste den mental geschädigten Dorfbewohner zu Boden.
»Feigling«, brüllte sie unvermittelt los. »Glaubst du, dass ich Liebe mit einem Feigling mache?«
Paddy fing an zu weinen. Was war auf einmal mit ihr los? Pyla hielt inne, nahm ihn in den Arm und streichelte ihn. Dann öffnete sie ihre Bluse und entblößte ihre Brüste. Paddy fing an, gierig daran zu nuckeln. Roi sah verstohlen zu Boden. Nach einer Weile blickte er doch wieder hin. Pyla saß auf einem Kasten und küsste Paddy wild. Der Regen und der Sturm schienen die beiden nicht zu stören. Während sie langsam zur Sache kamen, huschte ein Schatten links aus dem Wald. Es sah aus wie ein Hund oder ein Wolf. Bildete Roi sich das ein? Er rieb sich die Augen.
Die beiden hatten den Schatten offenbar nicht bemerkt. Aber Roi hatte ein ungutes Gefühl. Hätte er doch nur eine Waffe dabei! Auf einmal war der Unbekannte wieder da. Es war in der Tat ein riesiger Wolf, der sich den beiden von links näherte.
Plötzlich erhob sich der Wolf auf die Hinterläufe. Er entpuppte sich als eine humanoide Kreatur mit einem Raubtiergebiss.
Ein Ylors!
»Vorsicht«, rief Danton laut und rannte los.
Pyla und Paddy bemerkten den Ylors nun auch. Der Dorftrottel lief schreiend davon und stürzte nach wenigen Metern. Pyla bewegte sich langsam und … es war unfassbar. Sie bot sich dem Ylors an.
»Halt! Lauf weg!«
Sie hörte nicht auf ihn. Der Ylors packte ihren Kopf und biss in ihren Hals. Jetzt schrie Pyla laut auf. Danton nahm einen Stein und warf ihn auf den Angreifer, traf ihn am Kopf. Sofort ließ das Wesen Pyla los, die auf den Kasten sackte, und konzentrierte sich auf den neuen Gegner.
Was nun? Was tat man gegen einen Vampir? Roi nahm zwei Äste vom Boden und kreuzte sie. Der Ylors sah ihn verständnislos an. Wieso sollte so was auch auf dem Rideryon funktionieren, der Vampirähnliche kannte doch überhaupt keine christliche Symbolik. Also schleuderte Roi einen Ast nach ihm. Mühelos wischte der Ylors das anfliegende Holz mit einer Hand weg. Pyla plumpste vom Kasten auf den nassen Boden. Der Ylors entblößte sein blutiges Gebiss und knurrte gefährlich.
»Komm nur her, dummer Dorfbewohner! Dein Blut werde ich nicht trinken. Ich werde dein Fleisch fressen!«
»Keine gute Idee. Könnten wir nicht bei einem Cognac darüber reden?«
Die Antwort des Ylors kam in Form eines lauten Brüllens. Er nahm Anlauf und sprang auf Roi zu. Danton hielt ihm das zweite Stück Holz entgegen und rammte es ihm mit dem spitzen Ende in die Brust. Kreischend taumelte die Bestie zurück und sank mit einem Knie auf den Boden.
Dann hörte er Schüsse. Einige Dorfbewohner rannten vor und feuerten mit Projektilwaffen auf das Ungetüm. Der Ylors rappelte sich auf und rannte in den Wald zurück. Ächzend stand Roi auf und schleppte sich zu Pyla. Sie hatte viel Blut verloren, war aber noch am Leben. Er hob sie auf und trug sie zu Hurtel. Der starrte fassungslos auf seine blutverschmierte Tochter.
»Was …«
»Ein Ylors hat sie und Paddy angegriffen. Sie stirbt, wenn wir sie nicht behandeln. Eine Bluttransfusion! Kennt jemand ihre Blutgruppe?«
»Nein«, antwortete Jock.
»Holt Sato Ambush. Sofort! Wo ist das Krankenhaus?«
»Der Arzt wohnt dort«, sagte der Dorfschmied verstört und deutete auf ein Gemäuer zweihundert Meter entfernt. Roi nahm all seine Kraft zusammen, um Pyla dorthin zu tragen. Der Japaner eilte ihm entgegen und begutachtete die Verletzte. Sato wusste als Wissenschaftler am besten, was in einem solchen Fall zu tun war. Kathy kam ebenfalls dazu.
»Wir brauchen die Notausrüstung aus dem Beiboot, denn ich befürchte, mit den primitiven Mitteln können wir weder die Blutgruppe bestimmen noch eine Transfusion durchführen.«
»Ich hole sie«, meinte Kathy. Sie forderte Hurtel auf, ihnen ihre Waffen auszuhändigen und bat um Eskorte.
Hurtel zögerte.
»Es geht um das Leben deiner Tochter! Ohne Roi wäre sie tot, und wenn du uns nicht helfen lässt, wird sie sterben. Willst du das?«
Hurtel schüttelte den Kopf.
»Bringt ihnen ihre Waffen. Jock, du begleitest die Frau.«
*
Die Bluttransfusion verlief mit dem Medokit des Beibootes problemlos. Sato besaß genügend medizinisches Wissen, um Pylas Leben zu retten. Inzwischen wurde auch Paddy gefunden. Er war am Leben, stand aber unter Schock.
Das waren also die sogenannten Finsteren! Jetzt verstand Roi durchaus, wieso die Dorfbewohner den Wald mieden. Es war kein Aberglaube, sondern die Furcht vor den Ylors.
»Wie oft greifen die Ylors euch an?«
»Wenn sie in Angriffslaune sind. Einmal im Monat. Wir opfern ihnen lebende Tiere, und so verschonen sie uns. Ist aber jemand zu nahe am Wald, geschieht ein Unglück.«
Er seufzte.
»Pyla hatte zu viel getrunken. Sie wollte sich was beweisen. Ich alter Narr hätte auf sie aufpassen sollen.«
Roi legte seine Hand auf Hurtels Schulter.
»Ihr könnt euch nicht völlig abschotten. Pyla und die anderen Jugendlichen wollen die Welt da draußen kennenlernen. Je mehr Verbote ihr aussprecht, desto unbändiger wird ihr Wille sein, diese zu brechen.«
Hurtel starrte ihn überrascht an. Dann nickte er.
»Es gibt noch etwas, was Ihr wissen müsst, Hurtel. Das Überleben des Dorfes hängt vom guten Willen der Ylors ab. Sie könnten innerhalb weniger Minuten euch alle töten. Ihr seid wehrlos und ihnen komplett ausgeliefert.«
»Ich hatte gehofft, wenn die Leute vom Wald fernblieben, würde alles gut werden. Doch tief in meinem Herzen weiß ich, dass Ihr recht habt, Danton. Was soll ich tun?«
Hurtel fragte ihn tatsächlich um Rat! Nun waren sie ein gutes Stück weiter, denn offenbar hatte der Bürgermeister des Dorfes Vertrauen zu ihm gefasst.
»Der beste Rat wäre, in eine Region umzusiedeln, in der die Ylors keinen Einzug halten. Ihr lebt an der Randzone zwischen Licht und Dunkelheit. Hier jagen die Ylors am liebsten.«
Hurtel lachte bitter.
»Zurück in die Zivilisation? Als ich jung war, sind wir geflohen, um Mord und Korruption in den Städten zu entrinnen und so zu leben, wie Nistant es gewollt hätte. In Frieden und Harmonie.«
Jetzt wurde es interessant. Hurtel erzählte von dem Land Buural. Es wurde von reichen Fürsten regiert, die viel für sich und wenig für das Volk taten. Sie waren technologisch weit entwickelt und reisten zu den Tholmonden.
Doch Verbrechen, Korruption und Laster beherrschten die Gesellschaft von Buural. Die Hohepriesterschaft des Nistant besaß keinen Einfluss auf dieses Land und scherte sich auch seit Generationen nicht mehr darum. So konnten die Fürsten schalten und walten, wie sie wollten.
Um diesen Irrsinn zu entrinnen, waren vor vielen Chroms knapp zweihundert Buuraler aufgebrochen, um ein neues Leben zu beginnen. Sie hatten dieses idyllische Plätzchen gefunden, welches fruchtbar war und sie vom Rest des Riffs abschottete.
Die Jugend kannte das Geheimnis des Dorfes nicht. Nur die 200 Gründerväter, von denen noch 83 am Leben waren, wussten davon.
Sie hatten Gesetze erlassen, um die Bevölkerung vor den Ylors zu schützen und um zu verhindern, dass sie jemals wieder nach Buural zurückkehrten, denn dort wartete der sichere Tod auf sie.
Diese Informationen waren wertvoll, denn sie bestätigten Roi Dantons Vermutung, dass das Rideryon keiner einheitlichen Regierung unterstand. Es gab viele Parteien und viele regionale Regenten. Offenbar war das Rideryon viel zu groß, um es komplett zu kontrollieren.
Die beiden mächtigsten Rassen schienen die Manjor, das waren treue Diener von Nistant, und die Ylors zu sein. Sie bildeten Licht und Schatten des Riffs. Dazwischen gab es viele Grautöne, wie die Arawakpiraten und die Buuraler.
Dieser gigantische Haufen Erde und Fels im Weltall war wirklich faszinierend. Noch nie hatte Roi so etwas erlebt oder für möglich gehalten. Und doch gab es einen Vergleich, überlegte er. Die Tiefe, welche Atlan und der Ritter der Tiefe Jen Salik vor fast tausend Jahren bereist hatten, war noch gigantischer und schien eine ähnliche Struktur aufzuweisen wie das Rideryon.
Ob das Rideryon etwas mit den Kosmokraten zu tun hatte? Wer sonst hätte so etwas Gewaltiges erschaffen können? Das legte die Vermutung nahe, dass Nistant ein Kosmokrat war. Doch dann wäre er nicht tot. Oder ließ er die Rideryonen nur im Glauben, er sei gestorben? Fragen über Fragen, deren Antworten Danton noch nicht kannte.
Zuerst galt es jedoch, den Dorfbewohnern zu helfen. Mit kleinen Mitteln war man dazu bereits in der Lage.
»Hurtel, ich werde euch helfen«, versprach Rhodans Sohn. »Wenn ihr uns mit den Lebensmitteln helft …«
Hurtel blickte ihn ernst an. Dann sah er zu Pyla, die inzwischen friedlich schlief.
»Euer Raumschiff. Ihr segelt tatsächlich zwischen den Sternen! Ihr hättet uns auch zwingen können, euch Nahrung zu geben. Daher vertraue ich euch. Ich bin einverstanden.«
Jagd auf die DUNKELSTERN
Das flache, rechteckige Raumschiff des Beutebereichsleiters hatte die VIPER erreicht. Eine Raumfähre brachte den Persy Mumdök an Bord der VIPER. Fyntross hatte keine Zeit, den Schwabbeligen persönlich zu begrüßen. Er wartete auf Meldung von Krash. Der Manjor saß an den Ortungskontrollen und scannte die Region, in der sie das Signal eines der Beiboote der DUNKELSTERN aufgefangen hatten.
Fyntross war nervös. Das Signal war vor einigen Stunden erloschen. Hatten die anderen den Sender entdeckt? Oder war das Raumschiff wieder zur DUNKELSTERN zurückgekehrt? Doch dann hätten sie den Kurs nachverfolgen können. Dem war aber nicht so. Der Impuls war urplötzlich erloschen.
»Kapitän, unsere Männer haben etwas gefunden. Zwanzig unserer Leute wurden in der Stadt Carohn ausgesetzt.«
»Bringt sie an Bord.«
Vielleicht konnten sie ihm den Standort der DUNKELSTERN mitteilen. Inzwischen … mit einem Laut, als ob man den Boden wischte, erreichte Mumdök die Brücke. Der Unterschied zwischen dem Persy und einem Wischmopp bestand jedoch darin, dass der Fettmolch den Boden mit seiner Schleimspur verunreinigte.
»Erfolge?«, fragte Mumdök ohne Begrüßung.
»Wir haben eine Spur«, gab Fyntross ebenso knapp zurück und blubberte unzufrieden. Am liebsten hätte er das feiste Dreckstück von Bord geworfen. Aber er wollte es sich nicht mit der Persyallianz verscherzen. Sie war sein bester Auftraggeber.
Nach einigen Minuten kehrte die Space-Jet, wie die Terraner dieses Beiboot nannten, an Bord der VIPER zurück. Der Dychoo Maritor hatte insgesamt zwanzig Besatzungsmitglieder gefunden.
Telepathisch teilte das kopflose Wesen dem Kapitän mit, dass die Crew nicht wisse, wo sich die DUNKELSTERN befand, denn man habe sie im Unklaren über die Position gelassen. Offenbar bestand ein Nahrungsproblem an Bord der DUNKELSTERN, die insgesamt sechzehn Besatzungsmitglieder umfasste, darunter Hakkh, Zerzu, Craasp und sieben weitere Deserteure. Ausgerechnet diese Opportunisten, dachte er. Einer von ihnen hat uns aus Angst verraten. Er hat die Terraner über den Peilsender informiert, meldete Maritor telepathisch.
Wer?
Boslund.
Fyntross Blick fiel auf den Persy. Wie er dieses Volk verabscheute! Feiglinge! Er betrachtete Mumdök und blubberte vergnügt.
»Herr Boslund, Verräter und Dummschwätzer benötige ich an Bord der VIPER nicht. Wisst Ihr, was das ist?«
Boslund schüttelte sich. Das bedeutete wohl nein.
»Das nennt man einen Desintegrator.« Fyntross zeigte dem Persy die Waffe und entsicherte sie, indem er einen Regler nach oben schob. Dann richtete er sie auf Boslund. »Das Beste an diesem Strahler ist, dass es keine Leiche gibt und somit ersparen wir Putzmeister Tütüül jede Menge Arbeit.«
Boslund schrie auf, als Fyntross abdrückte. Dann löste sich der Körper des Persy auf. Es blieb nur die Schleimspur zurück, die er beim Betreten der Brücke gezogen hatte.
»Naja, fast keine Spuren«, meinte Fyntross und wies den vielgliedrigen Vessyl Tütüül an sauberzumachen.
»Ihre disziplinarischen Maßnahmen sprechen für sich«, gab Mumdök zu. Am liebsten hätte Fyntross auch ihn desintegriert. Doch dass der Persy ihm ein Lob ausgesprochen hatte, war ihm erst einmal ausreichend Genugtuung.
»Somit sind die Terraner gewarnt. Dennoch fliegen wir die Position des anderen Schiffes an. Vielleicht kann uns dort jemand sagen, wo wir die DUNKELSTERN finden. Krash, setzen Sie Kurs!«
Der Manjor knurrte zustimmend. Fyntross ließ sich ächzend auf den Kommandosessel nieder und betrachtete die Karte. Der Standort des Signals befand sich zwischen dem Land der Ylors und dem Fürstentum Buural. Es war eine entlegene Region, in der es kaum Siedlungen auf tausenden Quadratkilometern gab. Unberührte Natur, große Seen, endlose Wälder und Gebirge.
Kein Wesen traute sich aus Furcht vor den Ylors dorthin. Was wollte Danton dort?
Abschied
Hurtel hatte sein Versprechen gehalten. Die Dorfbewohner hatten ihnen so viele Lebensmittel und so viel Wasser zur Verfügung gestellt, wie in das Beiboot passten. Roi Danton hatte sogar eine Kiste Schnaps geschenkt bekommen.
Pyla war auf dem Wege der Besserung. Und nun war der Tag des Abschieds gekommen. Doch es würde ein Wiedersehen geben.
Alle dreihundertzwölf Dorfbewohner hatten sich vor dem Beiboot der DUNKELSTERN versammelt. Carah hatte Blumen für Roi gepflückt und überreichte sie ihm schüchtern.
Sato und Kathy waren dabei, die letzten Kisten zu verstauen und die Maschinen zu starten. Roi wandte sich an Hurtel.
»Vielen Dank für Euer Vertrauen, Bürgermeister. Wir kehren zurück und werden das Dorf mit moderner Technologie ausrüsten. Medizin und Defensivwaffen, die euch vor den Ylors schützen werden.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob es nötig ist. Doch vielleicht bin ich ja auch nur ein närrischer alter Mann. Daher freue ich mich auf Eure Rückkehr, Freund!«
Die beiden reichten sich die Hände. Danton machte eine Verbeugung und ging in das Raumschiff. Die Luke fuhr hoch, und ehe er in der Zentrale war, hatte das Beiboot bereits abgehoben.
*
Nach zwei Stunden hatte das Beiboot die DUNKELSTERN erreicht, die sich immer noch auf der Schattenseite des Riffs befand. Die drei wurden von Roland Meyers, Maya ki Toushi und Nataly Andrews empfangen.
»Gut, dass ihr unversehrt zurückgekehrt seid«, begrüßte Meyers sie. »An Bord des Beibootes befindet sich nämlich ein Peilsender. Ich befürchte, dass Fyntross das Signal zu unserer Position zurückverfolgen kann.«
»Was? Wieso sagst du uns das erst jetzt?«, fragte Danton entrüstet.
Meyers blieb gelassen.
»Kein Grund zur Sorge. Wir wechseln einfach unsere Position. Ich hielt es nicht für nötig, ein unnötiges Risiko einzugehen, um Funkkontakt mit dir herzustellen.«
Offenbar wusste Meyers nicht, worauf er hinauswollte.
»Und die Dorfbewohner? Wenn die Piraten unser Signal lokalisieren konnten, wissen sie, wo wir waren. Wenn sie hier nichts finden, werden sie zum Dorf fliegen, um an Informationen zu kommen!«
Meyers stieß einen Pfiff aus.
»Bedauerlich für die Dorfbewohner, aber sie wissen doch nichts, oder? Fyntross wird uns nicht finden können.«
Roi war enttäuscht von Meyers’ Haltung. Dachte er überhaupt nicht an das Leben der Dorfbewohner? Er hatte versprochen, ihnen zu helfen. Nun schwebten sie dank Meyers in Lebensgefahr. Er sah Kathy und Sato an. Sie wirkten genauso betrübt.
»Wir müssen Hurtels Leuten helfen«, sagte Kathy schließlich.
»Was? Spinnst du? Wir haben genügend Nahrung und können vor Fyntross fliehen. Und das sollten wir auch tun, sach ich«, mischte sich Nataly ein.
»Dem stimme ich zu. Das Schicksal der Dorfbewohner ist sicherlich bedauerlich, aber wir müssen an unsere Haut denken«, fand Maya ki Toushi.
Meyers stimmte den beiden zu.
»Solltest du recht haben und die VIPER zum Dorf fliegen, können wir ihnen sowieso nicht helfen, denn die DUNKELSTERN wird einen direkten Kampf gegen die VIPER wohl nicht überstehen.«
So einfach wollte Danton nicht aufgeben. Er hatte Hurtel ein Funkgerät geschenkt. Sato sollte sofort versuchen, den Bürgermeister zu warnen. Die Dorfbewohner sollten fliehen.
»Wenn die VIPER tatsächlich zuerst zur jetzigen Position unseres Schiffes fliegt, haben wir etwas Zeit. Wir müssen die Dorfbewohner aufnehmen und wem es nicht passt, der kann gern die DUNKELSTERN verlassen.«
»Das hast du gar nicht zu bestimmen, sach ich«, meckerte Nataly.
»Was soll das? Du bist in den letzten Wochen unausstehlich. Reiß dich doch mal zusammen«, wies Kathy ihre Freundin zurück.
»Ihr seid doch alles Arschlöcher! Sach ich!«, schimpfte Nataly und rannte aus der Zentrale.
Meyers seufzte.
»Sie hat unrecht. Du bist der Kommandant. Deine Befehle?«
Danton merkte, dass Meyers zwar nicht seine Ansicht teilte, doch er tat, was ihm befohlen wurde. Ein Soldat durch und durch.
»Kurs zum Dorf. Ich weiß, dass uns die VIPER vermutlich orten kann, aber wir müssen das Risiko eingehen.«
Er war fest entschlossen, das Leben der Dorfbewohner zu retten. Hoffentlich kamen sie nicht zu spät.
Fyntross Raubzug
Die Jagd nach der DUNKELSTERN nahm eine interessante Wendung. Während die VIPER Kurs auf den Standort des Signals nahm, flammte dieses wieder auf. Das Beiboot flog zur Schattenseite und verschwand im Reich der Ylors. Die Ortung verlor sich, da die Ylors in ihrem gesamten Reich Störfelder benutzten.
»Was tun wir jetzt, Kapitän?«, fragte Krash.
»Ja, genau! Was gedenken Sie jetzt zu tun?«, wollte Mumdök wissen und wabbelte vor sich hin.
Fyntross erhob sich mit einem »Blubb«. Er fing an, durch das struwwelige Fell des Manjor zu streicheln. Der sonst so furchteinflößende Krash ließ es geschehen.
»Die DUNKELSTERN befindet sich vermutlich im Reich der Ylors und versteckt sich dort. Es wird schwer sein, sie dort zu finden. Außerdem laufen wir Gefahr, auf Ylors zu treffen.«
Fyntross stieß ein zweites »Blubb« aus und ließ vom Fell des Manjor ab.
»Wir fliegen zu den Koordinaten, von denen das Raumschiff gestartet ist. Es muss dort etwas geben, was Danton braucht.«
»Aye«, knurrte Krash.
Die VIPER flog mit voller Geschwindigkeit zur unbesiedelten Region. Zu Fyntross Überraschung gab es allerdings doch Leben. Ein Dorf mit über dreihundert Einwohnern. Genau an der Quelle des Signals. Wenn das kein Zufall war?
»Neue Ortungsergebnisse. Die DUNKELSTERN hat das Ylorsreich verlassen. Vermutlicher Kurs: das Dorf«, meldete Krash.
Fyntross lachte.
»Herrlich! Die Beute kommt zum Jäger!«
»Wieso tun die das?«, fragte Mumdök verständnislos.
Fyntross warf sich dynamisch in den Kommandosessel und lehnte sich tief hinein.
»Nun, ich vermute, sie wissen von dem Peilsender. Ah. Ja, so muss es sein! Danton will das Leben der Dorfbewohner schützen. Er ist so edelmütig!«
Fyntross wandte sich an seinen besten Mann.
»Krash, ein paar Warnschüsse auf die Felder.«
Der Manjor jaulte vor Freude. Die VIPER feuerte dreimal. Die Energiestrahlen setzten die Felder der Bauern in Brand, schwarzer Rauch stieg in den Himmel. Fyntross’ Raumschiff war nun direkt über dem Dorf. Er konnte die fliehenden Buuraler erkennen.
»Warum töten Sie die Bauernlümmel nicht?«, fragte Mumdök.
Fyntross stieß ein verächtliches Glucksen aus.
»Deshalb sind Sie Zahleneintreiber und ich Piratenkapitän. Wir machen Beute und setzen sie gewinnbringend ein. Krash, dieses Gerät namens Fesselfeld aktivieren. Um das gesamte Dorf.«
Der Manjor führte den Befehl aus. Ein grünes Energiegeflecht schnürte die Siedlung ein. Die Dorfbewohner saßen in der Falle. Mit einem Stielauge beobachtete Fyntross den Kurs der DUNKELSTERN: sie hielt immer noch auf ihre Position zu.
»Funkverbindung zur DUNKELSTERN herstellen. Ich will Dantons hässliche Fratze sehen!«
Wenige Sekunden später erschien das für Fyntross abstoßende Gesicht als Holographie direkt vor ihm.
»Lieber Roi. Bonjour, so heißt es doch, richtig?«
»Lass die Dorfbewohner in Ruhe, Käpt’n Iglu. Sie sind unschuldig.«
Sein Witz heiterte ihn genug auf, um seinen Esprit zu beflügeln. Roi grinste in sich hinein, während er an die traditionsreiche terranische Feinkostkette für Nahrungsmittel aus Fischen dachte. Fyntross, der die Anspielung nicht verstand, ignorierte die Anrede.
»Mag ja sein, doch da du so um ihr Leben besorgt bist, schlage ich dir einen Handel vor. Die DUNKELSTERN und das Bildnis der Ajinah gegen das Leben der Bewohner. Klingt doch fair, oder?«
Fyntross war sich sicher, dass Danton auf den Handel eingehen würde. Der Terraner hatte verloren. Er war zwar ein gewiefter Taktiker und in ihm floss das Blut eines echten Freibeuters, doch eines fehlte ihm: Skrupellosigkeit. Und von der besaß Fyntross eine Menge.
Danton schwieg, aber ihm würde keine andere Wahl bleiben. Fyntross genoss diesen Moment. Sicherlich war auch Mumdök beeindruckt.
»Kapitän?«
»Nicht jetzt, Krash!«
Er wollte nicht gestört werden.
»Kapitän, neue Ortungsergebnisse. Es ist ein Jaycuul-Ritter. Er hat uns gefunden.«
Fyntross stieß einen entsetzten »Blubb« aus. Das durfte doch nicht wahr sein! Jetzt im Augenblick des Triumphes?
Er starrte auf die Ortungsergebnisse. Tatsächlich tauchte ein ringförmiges, überall gezacktes Raumschiff zwischen den Wolken auf. Es waren die Jaycuul, jene finsteren Vasallen des Gottes Nistant, die nach dem Herz der Sterne – Ajinah – suchten.
»Oh! Die werden wohl uns beide vernichten, n’est-ce pas?«, fragte Danton. »Nun hast du die Wahl, Fischfresse. Oder eher keine Wahl, n’est-ce pas?«
*
Das ringförmige Raumschiff des Jaycuul-Ritters befand sich direkt zwischen den beiden Raumern. Fyntross starrte mit einem Stielauge auf die Ortung, mit dem anderen auf Dantons Hologramm.
»Jaycuul-Ritter sind nicht zu unterschätzen, Kapitän. Tun Sie etwas! Sofort!«
Mumdök schwabbelte vor Aufregung wie ein Wackelpudding. Aber er hatte nicht unrecht: Jaycuul waren gefährlich. Ein Raumschiff war womöglich imstande, sowohl die VIPER als auch die DUNKELSTERN zu vernichten.
Jaycuul waren Wesen aus der grauen Vorzeit. Sie hatten schon vor dem Goldenen Zeitalter existiert und waren seit Äonen die Diener des Gottes. Nistant hatte sie einst als schuldig am Verlust seiner Geliebten Ajinah erkannt und sie verflucht, solange als Untote durch das All zu geistern, bis sie Ajinah gefunden hatten.
Das Bildnis der Ajinah betrachteten sie offenbar als einen Teil des Herzens der Sterne. Deshalb waren die Jaycuul hinter Fyntross und Danton her.
Gebt das Eigentum des Gottes zurück, hörte Fyntross eine mentale Stimme wispern. Sie gehörte dem Jaycuul.
Händigt Ajinahs Abbild aus oder ihr werdet alle sterben!
Die Gesichter von Mumdök, Krash, Maritor und Tütüül sprachen Bände. Auch sie hatten die Stimme des Jaycuul in ihrem Kopf gehört.
»Stellt eine Funkverbindung her.«
Maritor gab dem Kapitän einen telepathischen Impuls, damit er einen Kanal aktivierte.
»Ehrenwerter Jaycuul, wir sind nicht im Besitz des Abbildes. Wir …« Fyntross hielt inne. Würde er dem Jaycuul erklären, dass Danton es hatte, würde er niemals die DUNKELSTERN zurückbekommen. Auch Ajinahs Marmorbild wäre auf immer dahin.
»Wir haben es vor kurzem an die Ylors verloren und sind bestrebt, es wieder in unseren Besitz zu bekommen.«
Eine krächzende, finstere Stimme erklang aus den Monitoren: »Ich spüre, dass Ihr lügt, Piratenkapitän. Wenn Ihr Euer Leben retten wollt, gebt mir Ajinahs Bild.«
»Ich habe die Wahrheit gesagt, ich habe Ajinahs Bildnis an Fürst Medvecâ verloren.«
Fyntross log nicht einmal. Er verschwieg nur, dass Danton es wiederum dem Ylorsfürsten gestohlen hatte. Doch der Terraner schwieg sich zu dem Thema aus. Was wohl in ihm vorging? Danton war ein Meister des Verwirrspiels, aber wie sollten sie den Jaycuul narren?
Fyntross schalt sich einen Narren … Jetzt dachte er schon an Zusammenarbeit mit Danton, obwohl er ihn vor wenigen Minuten am liebsten noch eigenhändig ausgeweidet hätte. Doch die Jaycuul waren weitaus gefährlicher.
»Der Kapitän irrt«, mischte sich nun zu Fyntross Entsetzen Danton ein. »Wir haben das Bildnis in dem Dorf versteckt und waren gerade im Begriff wieder abzufliegen, als du aufgetaucht bist.«
»Nein!«, rief Fyntross dazwischen. »Eine Lüge!«
»Ich könnte eure beiden Raumschiffe vernichten, doch ich wünsche, die Kommandanten im Dorf zu treffen. Zeigt mir das Versteck des Abbildes und ich schone euer erbärmliches Leben«, zischte der Jaycuul heiser.
Fyntross’ Stielaugen zitterten. Er war genervt von Danton und wünschte dem Terraner nun doch wieder den Tod. Welche Wahl hatte er nun noch?
»Wie Ihr wünscht, Jaycuul-Ritter.«
Fyntross beendete die Verbindung und blickte zu Mumdök. Der feiste Persy schwieg. Das war auch besser so. Auf eine Begegnung mit einem Jaycuul war der Kapitän nicht gefasst gewesen. Und noch viel weniger auf Dantons Reaktion. Was hatte dieser Kerl nur vor?
Der Jaycuul
»Bist du übergeschnappt? Erst willst du die Dorfbewohner retten und nun gefährdest du ihr Leben?«, ereiferte sich Nataly.
»Liebes, weder die VIPER noch das Raumschiff des Jaycuul-Ritters werden das Dorf bombardieren, während wir dort unten sind. Dies gibt uns Zeit, sie zu retten.«
Er las ihre Skepsis in ihren blauen Augen. Nun, er musste zugeben, dass er noch keinen rechten Plan hatte, aber irgendetwas würde ihm schon einfallen.
»Meyers, senden Sie einen Funkspruch auf allen bekannten Frequenzen an Fyntross. Informieren Sie ihn, dass ich ihn gleich im Dorf treffen werde, um ihm Ajinahs Abbild zu zeigen. Vergessen Sie bitte nicht, die Koordinaten mitzuteilen.«
Meyers blickte Roi überrascht an.
»Wozu?«
»Abwarten. Wären Sie zum Denken hier, würden Sie an meiner statt der Kapitän des Raumschiffes sein, was eine höchst absurde und betrübliche Vorstellung wäre, n’est-ce pas?«
Meyers schüttelte den Kopf und führte Dantons Befehl aus. Er sendete auf allen bekannten Frequenzen den Funkspruch. Roi wollte, dass jeder zuhörte. Auch jemand, der nicht auf einem der drei Raumschiffe war.
*
Die Dorfbewohner mussten schreckliche Angst haben, als die drei Raumfähren auf den qualmenden Feldern landeten. Hätte Danton vielleicht überlegter handeln sollen? Durch seine Unachtsamkeit hatte er in der Tat das Leben dieser Wesen in Gefahr gebracht. Doch er durfte sich jetzt nicht mit Gewissensbissen herumplagen. Er konnte es nicht ändern und musste jetzt einen Weg aus dem Schlamassel finden.
Er hatte die Dorfbewohner in verhängnisvoller Weise geschädigt: die DUNKELSTERN hatte zwar die Brände, welche durch die VIPER verursacht wurden, gelöscht, doch die Ernte war dahin.
Kathy Scolar und Sato Ambush begleiteten ihn. Sie waren die Einzigen, denen er wirklich vertraute. Er hatte die Veränderungen bei Nataly bemerkt. Mit Meyers und ki Toushi wurde er nicht so richtig warm. Ein tief verwurzeltes Misstrauen blieb bestehen.
Die Fähre setzte unsanft auf. Umgehend öffnete sich die Luke. In seiner Maskerade als Roi Danton stolzierte er aus der Raumfähre wie ein Pfau und ging in Richtung Dorf. Schließlich musste er seiner Rolle treu bleiben.
Unweit neben ihm landete Fyntross’ Space-Jet. Der Kapitän und ein wabbeliger Persy verließen das terranische Beiboot. Nun senkte sich auch ein flaschenförmiges Beiboot des Jaycuul zu Boden. Roi wartete den Auftritt des Jaycuul nicht ab, da er bereits Hurtel, Jock und Carah auf sich zu laufen sah. Er erkannte die Furcht in ihren Gesichtern.
»Was geht hier vor? Wer sind diese Leute? Sind sie die Hilfe?«, fragte Hurtel aufgeregt.
»Nein, mein Freund. Das sind eher Feinde. Es tut mir leid, dass sie hier sind. Aber vertraue mir, ich löse die Situation in Wohlgefallen auf.«
»Du bist verunsichert, Roi Danton«, sagte Carah. »Ich spüre es an deiner Aura. Ich kann deine Farben sehen. Sie sind durcheinander. Und die Farben der anderen Wesen sind schwarz. Sie bringen den Tod.«
Jock hob seine Mistforke in die Höhe.
»Ich wusste, dass man ihm nicht trauen kann.«
»Wem?«
»Na dir!«
»Oh! Ähm, doch! Keine Sorge. Lasst mich nur machen und tut nichts. Klar?«
Er wandte sich von den Dorfbewohnern wieder ab und drehte sich um. Da stand auch schon der Jaycuul vor ihm.
Was für ein schrecklicher Anblick! Der etwa zwei Meter große Hüne strahlte eine unnatürliche Kälte aus, als ob alles Glück in seiner Umgebung verging. Das Gesicht des Humanoiden war nicht zu erkennen. Sein ganzer Körper war von einer grauschwarzen, löchrigen und zerfetzten Kutte bedeckt. Dazu wirkte das Wesen unvorstellbar alt, wie aus einer längst vergangenen Ära.
Der Jaycuul hätte einem Gruselfilm entspringen können. Vielleicht war die Erscheinung aber auch mit Bedacht gewählt, um abschreckend zu wirken. Seine Stimme klang wie das ferne Rasseln einer Steinlawine.
»Gib mir Ajinahs Abbild!«
Höflichkeit war offenbar nicht seine Stärke. Nun, so rasch wollte Danton das Bildnis nicht wieder hergeben. Er hatte nun die Chance, mit einem offensichtlichen Repräsentanten des Rideryons zu sprechen. Das schwere Atmen des Jaycuul machte ihn jedoch etwas nervös. Es klang wie das Schnauben eines wilden Stiers.
»Du wirst es erhalten, edler Ritter. Doch wo ich herkomme, pflegen wir die Höflichkeit. Also, ich bin Roi Danton, König der Freihändler.«
Er vollzog eine galante Verbeugung.
»Und mit wem habe ich das Vergnügen?«
Der Jaycuul streckte plötzlich den Arm aus. Seine Pranke packte Danton am Hals und drückte zu. Der Terraner rang nach Luft.
»Ich bin Flegorn, Oberster Jaycuul-Ritter! Du – du stammst nicht vom Rideryon und gehörst offenbar zu jenen, die Thol7612 vernichtet haben.«
Flegorn stieß ihn zu Boden. Danton brauchte eine Weile, um wieder zu Atem zu kommen. Das hatte er nicht erwartet. Sato Ambush und Kathy Scolar kümmerten sich um ihn und halfen ihm hoch. Sein Kopf schwirrte, jeder Atemzug verursachte stechende Schmerzen im Hals. Fyntross lehnte gelangweilt an einer Laterne und schien dem Szenario wenig abzugewinnen.
»Wir haben mit der Zerstörung des Tholmondes nichts zu tun. Wir bedauern sie sogar. Cul’Arc hat uns die Flucht von dem Mond ermöglicht. Dann sind wir hier gelandet«, erklärte Kathy, während Roi noch vor sich hin hustete und prustete.
»Der heilige Cul’Arc wird dies dann sicherlich bestätigen, wenn er von seiner Reise zurückkehrt?«, fragte der Jaycuul finster.
»Er lebt noch? Ja! Er wird es bestätigen«, antwortete Kathy.
»Und nun das Abbild von Ajinah«, forderte Flegorn erneute und wandte sich Fyntross zu. Das Fischwesen zeigte auf Danton. »Der hat es!«
Roi war wieder zu Kräften gekommen und er sprang auf.
»Ich? Nein, nein, er!«
Dem Jaycuul schien es zu reichen. Er zog sein kupferfarbenes Schwert, ging mit kräftigen Schritten an Danton und Fyntross vorbei, um Carah zu packen. Er drückte die Klinge an ihre Kehle.
Danton stockte der Atem.
»Wo ist es?«
»Sagte ich schon«, gab Fyntross gleichgültig von sich. Roi war das Leben der blinden Bürgermeistertochter jedoch nicht egal. Es war sinnlos, das Bildnis zu behalten. Es war ohnehin wertlos für sie. Womöglich konnten sie sich mit Flegorn arrangieren und er würde ihnen eine Möglichkeit zeigen, das Riff zu verlassen.
»Das Abbild befindet sich an Bord der DUNKELSTERN. Ich werde es zum Dorf bringen lassen.«
»Allein für die erste Lüge sollte ich diese Frau töten. Jedoch ist sie ein unschuldiges Kind des Gottes Nistant. Es wäre Sünde, ihr Leben zu beenden.«
Der Jaycuul-Ritter ließ Carah los, die weinend Trost in den Armen ihres Vaters suchte. Roi überraschte die Ansicht des Jaycuul. Der Gott Nistant schien überall gegenwärtig zu sein. Bis auf die Ylors respektierte offenbar jeder die Gesetze von Nistant. Selbst so ein finsteres Wesen wie ein Jaycuul schonte das Leben Unschuldiger.
Er nahm sein Interkom und sendete einen Funkspruch an Roland Meyers auf der DUNKELSTERN. Diesmal wollte er keine Tricks anwenden. Meyers sollte die Marmorplatte ins Dorf bringen. Dort würde er sie dem Jaycuul überreichen.
Ein angespanntes Schweigen beherrschte die nächsten Minuten. Fyntross lief unruhig auf und ab, während der Persy immer wieder zitternd vor sich hin waberte. Der Jaycuul-Ritter stand wie eine Statue zwischen den drei Raumschiffen.
Endlich erreichte das zweite Beiboot der DUNKELSTERN das Dorf und landete auf den Feldern. Craasp und Zerzu stiegen aus. Der Manjor und der Fithuul trugen die Marmorplatte mit dem Bild von Ajinah mit sich. Nun endlich bewegte sich Flegorn, als er Ajinahs Bildnis erkannte.
»Siehst du, ich habe Wort gehalten.« Das kümmerte den Jaycuul offenbar wenig. Er schritt auf die beiden zitternden Piraten zu, die zwei Meter vor ihm stehenblieben und ratsuchend in Richtung Danton und Fyntross blickten.
Danton bemerkte erst jetzt, dass es ziemlich finster geworden war. Eine dicke Wolkendecke hatte die Sonne verhüllt. Fyntross watschelte auf ihn zu.
»Das war dein toller Plan? Wir geben kampflos dem Jaycuul das Bildnis und lassen uns Milliarden dafür entgehen?«
»Dafür leben wir noch, Käpt’n Iglo. Das ist mehr wert als Milliarden, nespa?«
Fyntross stieß ein verärgertes »Blubb« aus, bei dem jede Menge Sabber oder Wasser aus seinem Mund schoss.
»Ehrenwerter Ritter. Gibt es nicht einen Finderlohn?«, wollte Fyntross wissen und ging auf den Jaycuul zu. Nun wurde auch der Persy plötzlich aktiv, kroch auf die beiden zu und mischte sich in die Verhandlungen ein. Er trug den Namen Mumdök und war eine Art Manager der Persyallianz. Vermutlich hatte er den Status eines Paten, wie bei der Mafia.
Roi ließ die drei diskutieren und wandte sich Hurtel zu.
»Versammle alle Dorfbewohner in dem Rathaus. Es könnte hier gleich ungemütlich werden.«
Hurtel nickte und gab Jock ein Zeichen. Sanft nahm er Carahs Hand und zog seine Tochter mit sich. Kathy und Sato blickten Roi fragend an.
»Was hast du nun schon wieder ausgeheckt?«, wollte Kathy wissen.
»Die Dunkelheit ist über das Land gezogen. Roi hat die Wesen der Nacht mit seinem Funkspruch über alle Frequenzen angelockt«, erklärte Sato Ambush und nahm Danton damit das Wort aus dem Mund.
Kathy blickte Danton verständnislos an.
»Du rufst diese Vampire? Wieso? Haben wir nicht schon genügend unfreundliche Gesellen hier?«
»Mein Schatz, das ist es ja eben.« Sein vielsagendes Grinsen sollte ihr nur das Nötigste verraten. Sein Plan war sehr riskant. Es galt vor allem, das Leben der Dorfbewohner zu schonen. Hoffentlich gelang es. Ein Sturm braute sich zusammen: das Zeichen für das Auftauchen der Ylors. Nur wenige Minuten später tauchte ein etwa zweihundert Meter großes, keilförmiges Raumschiff über der Bergkette auf.
»Unsere unfreiwillige Kavallerie«, freute sich Danton.
Bisher hatten weder Kathy noch Sato einen Ylors gesehen.
Ohne Warnung eröffnete das Raumschiff das Feuer. Roi packte Kathy und rannte mit ihr ins Dorf. Sato rannte ihnen hinterher. Zwei Energiesalven hüllten die Felder in Flammen. Als sich der Rauch nach einer Weile legte, kam Danton aus seiner Deckung hinter einem der Gebäude. Er konnte Fyntross ausmachen, der sich langsam wieder aufrappelte. Auch Mumdök lebte noch. Die beiden Salven hatten dem Raumschiff des Jaycuul-Ritters gegolten: das Beiboot war in zwei Teile gebrochen und ruhte in einem zehn Meter tiefen Krater.
Ambush, Zerzu und Craasp waren inzwischen auch bei ihnen.
Aber wo waren Flegorn und das Abbild der Ajinah hin?
»Roi?«, rief Kathy.
»Oui?«
Flegorn stand plötzlich hinter ihm. Roi wich automatisch zurück.
»Du hast es gewagt, mich in eine Falle zu locken!«
»Mitnichten, edler Ritter. Keine Ahnung, wo die plötzlich herkommen. Vielleicht ein Ausflug?«
»Seht!«, rief Craasp.
Aus dem Raumschiff flogen sieben Wesen heraus, die an Fledermäuse erinnerten, und hielten direkt auf sie zu. Sie landeten vor dem Krater und verwandelten sich in Ylors.
Roi erkannte den Fürsten Medvecâ und seine rechte Hand Veritor. Während letzterer in seiner martialischen Gestalt wandelte, die an einen Werwolf erinnerte, erschien Medvecâ in Gestalt eines blassen, aber gepflegten Menschen.
Gemessenen Schrittes ging der Fürst auf sie zu. Inzwischen standen auch Mumdök, Fyntross sowie Craasp und Zerzu bei Danton und den übrigen Galaktikern. Roi fiel auf, dass die Energiesalven auch Fyntross’ Beiboot beschädigt hatten.
»Roi-San, wer ist der markante Ylors?«, fragte Sato leise.
Danton blickte ihn an und kniff die Brauen zusammen. Der Japaner sah aus, als hätte er ein Gespenst gesehen.
»Medvecâ«, erwiderte er leise. »Kennst du ihn?«
»Neuerdings, aus einer grauenvollen Pararealität. Ich hielt es für einen unwirklichen, verschrobenen Traum mit einer Fabelgestalt. Doch dieses Wesen war definitiv Teil aus einer Pararealität, die ich erst vor kurzem erlebte.«
Sato klang beunruhigt. Das war ungewöhnlich. Roi wunderte sich.
»Und … was passierte in der Pararealität?«
»Wir haben dafür jetzt keine Zeit, Roi-San! Die Ylors kommen näher.«
Danton verstand und gab Craasp und Zerzu die Anweisung, sich wieder zu ihrem Schiff zu begeben und es startklar zu machen. Flegorn hielt in seiner rechten Hand die Marmorplatte, in seiner linken das Schwert. Während Medvecâ auf sie zuging, spendete er Beifall.
»Grandios! So kommt das Abbild wieder in meine Hände, und seine Diebe noch dazu.«
Veritor knurrte gefährlich.
»Du musst erst einmal an mir vorbei, Ylors!«
Flegorn machte mit dem Schwert eine Ehrenbezeugung und ging dann in Kampfposition.
Medvecâ lachte.
»Sei kein Narr. Dir sollte klar sein, dass deine Unsterblichkeit relativ ist.«
»Ich werde Nistants Schatz mit meinem Leben verteidigen.«
Medvecâ gab Veritor ein Zeichen. Die sechs Ylors stürzten sich auf den Jaycuul. Der schleuderte das Bildnis der Ajinah zu Boden und parierte die Angriffe mit seinem Schwert. Einen Ylors spießte er auf, dem anderen schlug er den Kopf ab. Nun waren es nur noch vier Angreifer. Sie bildeten einen Kreis um den Hünen.
Danton musste jetzt handeln. Doch Fyntross kam ihm zuvor. Die VIPER drehte sich und schoss ein Impulsgeschütz ab. Der konzentrierte Energiestrahl detonierte über den Kämpfenden. Die Wucht der Explosion warf sie zu Boden. Medvecâ wurde in einen Feuerball eingehüllt, doch der Ylors marschierte – geschützt durch ein blaues Leuchten – unbeeindruckt durch die Flammen.
»Jetzt«, rief Roi in seinen Interkom. Das Beiboot startete und hielt direkt auf sie zu. Es feuerte auf Fyntross und Mumdök, während Flegorn zwei weitere Ylors tötete. Roi schnappte sich das Abbild von Ajinah und sprang zusammen mit Kathy und Sato in das knapp einen Meter über dem Boden schwebende Kleinraumschiff.
Fyntross hatte ihre Flucht bemerkt. Wild fluchend fuchtelte er mit seinen Tentakeln.
»Schnell zur DUNKELSTERN, und dann nichts wie weg.«
»Sie werden uns verfolgen«, rief Kathy.
»Genau! Das ist auch mein Plan. Die Dorfbewohner werden sie dann hoffentlich in Ruhe lassen, weil sie mit uns beschäftigt sind.«
Und es geschah, so wie er es erhofft hatte. Die drei Parteien unterbrachen ihre Auseinandersetzung. Zu dumm, dass das Schiff des Jaycuul und auch das von Fyntross nicht mehr funktionierte.
Es entbrannte ein Kampf zwischen Flegorn und den Piraten. Fyntross schickte drei Manjor und zwei Harekuul in das Duell mit dem Jaycuul. Flegorn streckte sie nacheinander in beängstigend kurzer Zeit nieder. Die Ylors kümmerten sich nicht darum. Die geflügelten Wesen hoben vom Boden ab und flogen zu ihrem Raumschiff. Flegorn erreichte derweil das Beiboot der VIPER. Er stieg ein, während die Piraten Abstand hielten. Doch nichts geschah. Danton wusste, dass das Beiboot ebenfalls beschädigt war. Flegorn stieg wieder aus. Fyntross und seine Leute hielten weiterhin gebührend Abstand zu dem Jaycuul-Ritter. Ein Kampf war nicht mehr notwendig. Beide mussten offenbar auf Entsatz warten.
Die Crew der DUNKELSTERN hatte damit etwas Zeit gewonnen. Zumindest ein paar Minuten vielleicht, ehe neue Beiboote die Piraten und den Jaycuul aufnehmen würden.
Inzwischen landete ihre Fähre auf der DUNKELSTERN. Roi befahl allen Männern und Frauen, auf ihre Posten zu gehen. Sato Ambush blieb schweigend sitzen und starrte auf den Boden.
»Sato?«
Er zuckte zusammen. Dann blickte er hoch und nickte. Ambush erhob sich und verließ das Beiboot. Roi blickte ihm nachdenklich hinterher. Der Anblick von Medvecâ hatte den Pararealisten aus der Fassung gebracht. Doch das musste warten. Er rannte in die Zentrale.
Die DUNKELSTERN beschleunigte mit hohen Werten, aber nicht schnell genug, um die Verfolger abzuschütteln. Das war auch gar nicht beabsichtigt.
Das Ylorsraumschiff nahm als erstes die Verfolgung auf. Wenige Minuten später folgte das Mutterschiff der Jaycuul-Ritter und zuletzt die VIPER. Alle drei Raumschiffe rasten hinter der DUNKELSTERN her, welche in das Nebelgebiet flog. Der weiße Nebel umgab die untere Seite des Rideryons, jenes Gebiet, in dem ewige Nacht herrschte und wo die Ylors herrschten. Und dann geschah genau das, was er bezweckte: die drei Schiffe bekämpften sich gegenseitig.
Schließlich suchte die VIPER als erstes das Weite. Medvecâs Raumschiff und das des Jaycuul-Ritters waren inzwischen so miteinander beschäftigt, dass der DUNKELSTERN die Flucht gelang.
Roi setzte sich auf seinen Kommandosessel und atmete erst einmal tief durch.
Sein Plan hatte funktioniert. Er war immer noch im Besitz des Abbildes der Ajinah und hatte sowohl Fyntross als auch Flegorn und Medvecâ überlistet. Dafür hatte er jetzt aber auch jede Menge neue Feinde. Besser, sie würden ihn nicht finden.
Die Rückkehr eines Gottes
Ich war am Leben.
Noch immer glich es einem Wunder, dass ich meinen Körper nach dem ewigen Schlaf wieder spürte. Doch mit der Physis war auch die seelische Pein zurückgekehrt.
Ich fühlte mein Herz nach jedem Schlag vor Einsamkeit und Zorn schmerzen.
Meine Sehnsucht, mein Verlangen nach ihr verzehrte mich von innen heraus. Ich liebte sie mit allem in mir, was fühlen konnte. Vor meinem geistigen Auge erschien sie gleich einem Engel mit ihrem seidenen, langen blonden Haar, ihren tiefen großen blauen Augen und ihrem herzlichen Lachen.
Das war meine Ajinah. Mein Herz der Sterne. Und doch war sie nur noch als Echo da! Ajinahs Körper war längst zu Staub zerfallen, ihre Seele im Hort meines ärgsten Widersachers gefangen.
Das Verwirrendste: jetzt hieß sie Anya! Oh, welch Zufall, dass sich ihre Namen glichen. Oder war es gar kein Zufall? War es Bestimmung? Ich konnte das Bild nicht mehr vergessen. Es war Millionen Jahre her, seit ich Ajinahs Schönheit mit meinen eigenen Augen bewundern durfte.
Die Terranerin Anya Guuze glich Ajinah wie ein Zwilling. War sie eine Reinkarnation meiner Geliebten?
Im Laufe der Äonen hatte es keine Frau geschafft, ihrem Antlitz nahe zu kommen. Die schönen Gesichter der anderen Frauen waren mit der Zeit verblasst, die Haut war von den Knochen abgeblättert, ehe die Totenschädel zu Staub zerfielen. Wieder und wieder – bis sie beinahe aus meinen Erinnerungen gelöscht wurden und nur noch schemenhaft, geisterhaft durch den Kopf huschten.
Nur das von Ajinah nicht.
Millionen Jahre waren vergangen, und doch hatte ich niemals die kleinste Einzelheit ihrer Schönheit vergessen.
Aber ihr Körper war vergangen. Deshalb lebte ich und doch war ich tot. Meine Seele war leer. Ich wäre besser dran gewesen, wäre ich tot geblieben.
Mein großer Geist war frei von diesen Gefühlen. Im großen Geist des Rideryons hätte ich es besser gehabt, und doch war meine Rückkehr nicht ohne Grund.
Das Rideryon steuerte auf das Ziel zu, welches ich vor Millionen von Jahren gesetzt hatte. Der Kreis schloss sich. Ich war bereit, das Erbe anzutreten, doch dieses Mal würde ich nicht mehr auf Ajinah verzichten! Sie gehörte zu mir!
Ihr perfektes Abbild hatte ich bereits getroffen, nun musste ich noch ihre Seele finden. Oder schlummerte mein Engel gar in dem Körper dieser Terranerin?
Sie ging mir nicht aus dem Kopf. Dabei gab es viele wichtige Dinge zu erledigen. Das Rideryon hatte seinen Gott wieder, und es bedurfte einiger Anweisungen.
Ebenso wichtig war es, die Gefahren auf meiner Weltrauminsel zu beseitigen. Ich spürte eindeutig die Anwesenheit einer hohen Hexe. Eine hatte ich vor Jahrmillionen getötet, doch offenbar existierten andere Hexen noch immer. Zwar nicht mehr auf dem Rideryon, doch anscheinend in dieser Galaxiengruppe. Sie trachteten mir nach dem Leben, wollten mein Werk für den Kosmos zerstören. Mit welchem Recht? Wer hatte SI KITU ermächtigt, über die Belange des Universums zu entschieden?
Niemand! Sie agiert mit derselben Überheblichkeit wie Kosmokraten und Chaotarchen!
Ja, jene Hohen Mächte glaubten immer wieder, sie seien die Herren der Universen. Eines Tages werde ich sie eines Besseren belehren und ein Universum erschaffen, in dem ihre finsteren Einflüsse bedeutungslos waren.
Dann seufzte ich und dachte wieder an Ajinah.
Es hieß, alle Wunden heilen mit der Zeit. Diese eine heilte nicht. Sie war nach Äonen nicht verheilt und würde es niemals sein. Doch noch immer hatte ich die Hoffnung nicht aufgegeben, es würde sich alles doch noch zum Besseren wenden, gerade jetzt nicht.
Wütend donnerte ich mit der Hand gegen die Wand. Meine Gedanken waren nicht bei der Sache. Sie drehten sich nur um mein Herz, nur um Ajinah. Diese Schwäche hatte schon immer mein Handeln beherrscht, oftmals war ich in der Vergangenheit zu emotional vorgegangen. Das hatte sich erst mit meinem körperlichen Tod verändert.
Doch nun war ich wieder am Leben und spürte die Bedürfnisse eines lebendigen Wesens in mir. Mein Herz verzehrte sich nach Ajinah. Sie nicht zu bekommen, machte mich wütend.
Diese Gefühle musste ich unter Kontrolle halten! Ich durfte mich ihnen nicht hingeben! Ich hatte doch noch so viel vor mit dem Universum. Das Leben im Resif-Sidera pulsierte in den verschiedensten Facetten. Ich hatte einst dieses eigene, kleine Universum im Kosmos erschaffen, welches sich nun langsam seiner Bestimmung näherte. Seine Bewohner waren meine auserwählten Geschöpfe, dazu bestimmt, dieses verruchte Universum zu reformieren.
Die große, schwere Tür zu meinem Thronsaal schwang langsam auf. Ich drehte mich nicht um, sondern beobachtete die Tholmonde.
Auf gut zwanzig Monden erkannte ich die Oberflächenstruktur mit bloßem Auge. Diese Trabanten zogen in verschiedenen Bahnen am Himmel vorbei. Hunderte von ihnen leuchteten winzig am Firmament.
Das leise Schlurfen und Knarren der Rüstung enttarnte die Besucher. Es waren meine Jaycuul-Ritter.
Ich drehte mich zu ihnen um und begrüßte sie mit einem Lächeln. Die fünf schwiegen natürlich. Unter ihren schwarzen Kapuzen war keinerlei Regung erkennbar. Sie waren Untote, auf ewig verflucht, ihre Schuld mir gegenüber zu begleichen. Sie waren meine seelenlosen Diener. Und doch waren sie mir ans Herz gewachsen nach all den Äonen, schließlich waren sie meine treusten und vertrautesten Untertanen.
Hinter den Jaycuul-Rittern betraten der Manjor Zigaldor und der Harekuul Tashree den Saal. Sie hatten sich ebenfalls als loyale Diener erwiesen und genossen mein Vertrauen.
Der wolfsartige Manjor mit den sechs Armen war mein Hohepriester, er lebte, um ausgerechnet mich zu verehren. Ein wenig schmeichelte mir das schon. Sein graues Fell war zum Großteil von einer weißen Robe bedeckt. Der Harekuul war ein stolzer Krieger. Er war eine Mischung aus einem Reittier und einem Humanoiden.
»Wie können wir dir dienlich sein, Herr?«, fragte Zigaldor unterwürfig.
Ja, wie konnte ein einfacher Sterblicher mir nütze sein? Welche Bürde konnte er mir schon abnehmen? Aber ich wollte ihn nicht unterschätzen, schließlich war ich einst genauso wie er gewesen und hatte trotzdem Großes vollbracht.
»Berichte, Flegorn.«
Der Oberste Jaycuul trat näher. Seine Rüstung, die er unter dem zerrissenen Gewand trug, gab bei jeder Bewegung ein Geräusch.
»Ich habe Fremde auf dem Rideryon getroffen. Sie haben das Bildnis der Ajinah gestohlen und halten es in ihrem Besitz.«
Das einzige Bild meiner Geliebten entwendet? Über viele Äonen hatte es mir Trost gespendet.
»Was für Fremde?«
»Jene, die auf Thol7612 waren«, antwortete Flegorn mit krächzender Stimme.
Roi Danton, Kathy Scolar, Nataly Andrews, Sato Ambush, Roland Meyers und die Hexe Maya ki Toushi. Abgesandte der Terraner, die von den Entropen entführt worden waren. Sie lebten und trieben ihr Unwesen. Warum hatten sie Ajinahs Marmorbild gestohlen? Welche Bedeutung hatte es für sie?
»Wieso konntest du ihnen das Bild nicht abnehmen?«
»Es gibt noch mehr Interessenten. Piraten und Fürst Medvecâ persönlich. Ich musste mit ihnen kämpfen und habe so Danton verloren.«
Die Terraner waren nicht zu unterschätzen, ebenso wie Medvecâ. Sowohl Danton als auch Medvecâ verfügten über eine langjährige Erfahrung. Zwar war ich schon lange tot gewesen, als beide das Licht der Welt erblickt hatten. Dennoch waren die Fähigkeiten von Unsterblichen niemals zu unterschätzen.
»Sucht das Hexenbiest und die Terraner. Versucht, sie gefangen zu nehmen und zu mir zu bringen.«
Die Jaycuul machten kehrt und verließen den Raum. Schweigend und bedingungslos befolgten sie meine Order.
»Ruft die Späher aus den fernen Galaxien zurück. Ich habe inzwischen genügend Informationen gesammelt. Bis auf Anya …«
Tashree und Zigaldor blickten sich fragend an. Ich bemerkte sofort, dass sie etwas auf dem Herzen hatten. Der Harekuul schließlich nahm seinen Mut wohl zusammen und trat vor.
»Herr, wir haben deine Aufmerksamkeit bemerkt. Glaubst du, diese Terranerin ist deine Gefährtin Ajinah?«
»Möglich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss es wissen.«
»Verzeih meine Anmaßung, großer Gott, aber mich erschreckte die Art und Weise, wie du die beiden Terraner behandelt hast.«
Tashree war wirklich mutig! Das gefiel mir sehr! Er übte Kritik an mir. Jeder andere Herrscher hätte vermutlich einen Wutanfall bekommen, aber was nutzten mir Ja-Sager? Gar nichts! Tashree sprach den Vorfall auf der AGASH an, als ich mit Marcello Zeem gesprochen hatte, der offenbar eine Art Arbeitgeber für Anya gewesen war. Er hatte mich angewidert, denn er war ein sogenannter Kapitalist. Ein gieriger, verlogener Mensch, der sein sterbliches Leben zum Anhäufen von Besitz verplemperte.
Ich verabscheute diese Wesen zutiefst. Gier und Maßlosigkeit waren die Plagen des Universums. Gier führte zu Unzufriedenheit, dann zu Neid und schließlich zu Unterdrückung und Mord!
Die Gierigen bereicherten sich und teilten nichts. Sie waren egoistisch. Selbstlosigkeit war ihnen fremd. Sie setzten sich nicht für Arme und Schwache ein, sondern spuckten auf sie. Seelenlose Roboter waren sie, die nur ihrem eigenen Reichtum dienten und keinerlei Nächstenliebe kannten. Dafür hasste ich sie und tötete sie einst in Massen! Ich bereute das niemals!
»Tashree, ich danke dir für die Offenheit. Du wirst noch lernen, dass manche Arten von Wesen selbst mich wütend machen. Eines Tages wird es hoffentlich keinen Egoismus und keine Rücksichtslosigkeit mehr geben.«
Der Harekuul verneigte sich.
»Was sind deine nächsten Schritte?«, wollte Zigaldor wissen.
»Ich werde weiter im Verborgenem bleiben, bis die Rideryonen bereit sind, meine Rückkehr anzunehmen. Das Resif-Sidera ist vielschichtig geworden. Es muss geeint werden.
Dann werde ich Siom Som von der Last dieses intergalaktischen Krieges befreien, von dem ihr mir berichtet habt. Und nun lasst mich bitte allein, ich muss mich mit der Geschichte der letzten Zeit beschäftigen.«
Die beiden verneigten sich und verließen die Halle. Ich hatte sie angeschwindelt, längst wusste ich über Perry Rhodan und den Konflikt zwischen den Kosmotarchen Bescheid. Ich setzte mich in einen Sessel und starrte aus dem Fenster.
Dann nahm ich den Datenträger aus meiner Tasche und aktivierte das Bild von Anya oder Ajinah.
Wie auch immer sie hieß, ich konnte mich ihrem Bann nicht entziehen, dachte ständig an sie, und der Gedanke, mit ihr verbunden zu sein, berauschte mich geradezu. Ich gab mich der Illusion hin, eine große Liebe würde zwischen uns entflammen und dieser Gedanke ließ mein Herz in längst vergessenen Gefühlen des Glücks schwelgen.
*
Tashree meldete das Erreichen von Thol1. Die fünfhundert Kilometer durchmessende Welt war der erste Satellit des Rideryons gewesen. Einst war er der Mond jenes Planeten gewesen, auf dem ich die Strafe der Kosmokraten abgeleistet hatte. Viele Äonen war es her gewesen. Wie oft hatte ich damals auf diesen Trabanten geschaut und mich danach gesehnt, dorthin zu fliegen?
Und in irgendeiner Nacht war dann die Idee des Rideryons geboren worden. Auch damals hatte ich zum Mond geschaut. Er war wie ein treuer Weggefährte in all den Jahrmillionen gewesen.
Und dort wartete mein geliebtes Raumschiff auf mich. Ich gab Tashree den Befehl, meine Ausrüstung zu bringen. Der Harekuul war wenige Minuten später in meinem Quartier und überreichte meine Uniform. Der Gürtel war etwas Besonderes. Er besaß nicht nur einen Schutzschirm, diverse Waffen und eine mechanische Apparatur zur Herstellung von Nahrung und Wasser, sondern auch einen Fiktivtransmitter.
Ich dankte meinem treuen Helfer und strahlte mich in die Tiefen des Meeres auf Thol1 ab. Dort fand ich mich in kompletter Dunkelheit wieder. Die Luft war schwach und schlecht. Es dauerte nur wenige Sekunden, als das fahle blaue Licht aktiviert wurde.
»Willkommen an Bord, Herr!«, röhrte eine mechanische Stimme. Der Bordrechner hatte meine Anwesenheit erkannt und richtig interpretiert.
»Erwecke die STERNENMEER!«
Mit einem lauten Grollen wurde das Gefährt aktiviert. Das Licht schien nun grell und offenbarte auch eine dicke Staubschicht. Die Wartung meines geliebten Raumschiffes schien nicht so gut gelaufen zu sein.
Ich begab mich zur Kommandozentrale, watete durch den Staub. Die dunkelgrünen Wände fingen an zu pulsieren, und Gesichter schälten sich heraus. Mit einem lauten Knacken befreiten sich die kugelförmigen Besatzungsmitglieder aus ihren Schiffsnischen. Sie hatten lange Zeit geschlafen.
Die Vyr waren ein Teil des Raumschiffes. Ihre Körper entstanden aus der biomechanischen Masse des Schiffes selbst, wenn es notwendig war. Die Vyr in der STERNENMEER mussten nicht einmal eine stoffliche Form annehmen. Sie waren in den Leitungen, in der Hülle, den Energierelais, den Prozessoren und Speichern. Brave und treue Bewohner des Rideryons waren sie, mit einer Bestimmung nach ihrem irdischen Dasein.
Ihr Zentralrechner stand in telepathischem Kontakt mit mir, um Anweisungen entgegenzunehmen. Ich informierte den Vyrkommandanten über meine Absichten.
Kurs in den Orbit des Mondes.
Ohne ein Wort zu sagen, verrichteten sie ihre Arbeit.
Um Tashree nicht zu beunruhigen, berichtete ich ihm über die Reaktivierung des Schiffes.
Die STERNENMEER katapultierte sich aus dem Ozean und schoss in den Himmel.
»Tashree, informiere die Mechaniker der AGASH. Sie sollen eine Wartung durchführen.« Ich sah mich um. »Und schicke auch eine Putzkolonne an Bord …«
Es war besser, wenn auch die Vyr untersucht wurden. Nach Jahrmillionen des Ruhens waren sie vielleicht nicht mehr voll funktionsfähig. Die STERNENMEER hatte über 220 Millionen Jahre lang geruht. Zwar hatten die Vyr stets Erneuerungsprozesse durchgeführt, doch ich wollte sicher sein, dass die STERNENMEER noch voll einsatzfähig war.
Zwar sah alles auf der Kommandobrücke so aus wie vor über 220 Millionen Jahren, doch ich wusste, dass dies nur ein Trugbild war. Die STERNENMEER war im Laufe der Jahrmillionen immer wieder zerfallen und nach einem festen Muster und Konstruktionsplan neu aufgebaut worden. Der letzte Reproduktionszyklus schien jedoch einige Zehntausende Chroms her gewesen zu sein, was den Zustand der Einrichtung anging.
Das Rideryon lag vor mir, und die Tholmonde glänzten im Schein der Kunstsonnen. Langsam spürte ich auch die Freude in meinem Leben wieder. Der Anblick meines Rideryons ließ mein Herz höherschlagen. An Bord meiner STERNENMEER zu sitzen, erfüllte mich mit Stolz.
Nun galt es den nächsten Schritt in die Wege zu leiten.
*
Die Überholung der STERNENMEER schritt gut voran. Ich hatte meine Kabine inzwischen eingerichtet und Tashree zu meinem stellvertretenden Kommandanten der STERNENMEER ernannt. Auf ihn konnte ich mich verlassen.
Der Vyrkommandant akzeptierte auf meine Order hin Tashree als Befehlsbefugten. Der Harekuul hatte sichtliche Probleme, sich an die teils unsichtbare und schweigsame Besatzung zu gewöhnen.
Nun fand ich die Zeit, um mich noch einmal mit Siom Som zu befassen. Ich rief die Daten der Galaxie auf und informierte mich über die aktuellen Geschehnisse.
Wir schrieben September 1307 Neuer Galaktischer Zeitrechnung, die Zeiteinheit der Galaktiker und Cartwheeler, die inzwischen in vielen Gebieten Einzug gehalten hatte.
Siom Som war unter Kontrolle des Quarteriums und Dorgons. Quarteriumsfürst Leticron regierte dort. Co-Kaiser Elgalar, Statthalter Konsul Carilla und Legat Falcus repräsentierten die schwächelnden Dorgonen. Nach der Ermordung von Kaiser Commanus und der Opposition war Dorgon noch geteilter als je zuvor.
Die Bürger wollten einen starken Kaiser, der nicht vom Quarterium abhängig war. Elgalar war dies nicht. Der Mann, der eine Frau sein wollte, gehörte zu den unbeliebtesten Kaisern der dorgonischen Geschichte. Er – sie – schien keinerlei politisches Geschick zu besitzen und setzte die Bedürfnisse ihres Privatlebens über die des Sternenreiches. Ihre Gefährten Carilla und Falcus hatten auch viel an Sympathie eingebüßt.
Es kriselte in der Allianz des Quarteriums und Dorgons. Auch die Angriffe des Widerstandes, der sogenannten FES – Föderation Estartischer Separatisten – leistete ihren Beitrag. Die einheimischen Estarten wollten nicht länger unterdrückt werden, doch es fehlte ihnen an militärischer Macht, um sich durchzusetzen.
Die Galaxie lag im Chaos. Es wurde Zeit, sie zu ordnen. Ich würde ihnen noch einige Monate geben, ehe ich mich ihnen offenbaren würde. Dann würde ich den Austausch der Kulturen einleiten und damit Siom Som stabilisieren.
Der Besucher
Liebster Aurec,
nach unserem Abenteuer im Dorf haben wir nichts mehr von der VIPER, den Jaycuul oder Medvecâ gehört. Das ist nun eine Woche her. Wir sitzen hier dennoch in der Falle. Vermutlich würde die DUNKELSTERN einen Flug durch die Nebelbarriere nicht überstehen. Sollte das Überlichttriebwerk ausfallen, würde unsere Flucht vermutlich schnell zu Ende sein. Selbst wenn wir das Rideryon verlassen könnten, was dann? Der Weg zum Dunklen Himmel ist weit – mit der DUNKELSTERN nicht zu bestreiten.
Wir bräuchten die VIPER dafür.
Oder wir treten in Kontakt mit Cul’Arc, der sich vermutlich irgendwo auf dem Riff befindet. Er ist uns wohl gesonnen. Wenn wir ihm Ajinahs Abbild übergeben, könnte er uns im Gegenzug sicherlich freilassen. Das ist meines Erachtens unsere einzige Hoffnung. Doch wir haben keine Spur von ihm und möchten auch nicht wieder in die Hände der Jaycuul-Ritter geraten, die wenig vertrauenerweckend sind.
Außerdem macht mir Nataly Sorgen. Sie hat sich so verändert. Gut, sie ist immer launisch gewesen, aber es ist in letzter Zeit extrem geworden. Sie kapselt sich ab, verbringt aber viel Zeit mit Roland Meyers. Ich befürchte, die beiden haben eine Affäre. Armer Jonathan! Das hätte ich nie von ihr gedacht. Sie ist nicht mehr die Nataly, die ich kenne. Als ob sie manipuliert würde. Vielleicht ist das aber auch nur ein Wunsch von mir, denn es ist schwerer zu akzeptieren, wenn sie das aus freien Stücken tut.
Ich hoffe, dass wir hier irgendwann endlich rauskommen.
In Liebe, Deine Kathy
*
Kathy ließ das Verhalten ihrer Freundin keine Ruhe. Was war mit ihr los? Sie verhielt sich in letzter Zeit sehr seltsam.
Deshalb suchte sie Nataly auf, die nun wieder zuckersüß war. Aber die Freundlichkeit wirkte aufgesetzt. Kathy wollte nicht mehr um den heißen Brei reden.
»Was ist los mit dir?«
»Gar nichts. Alles prima!«
Und das sollte sie ihr glauben?
Plötzlich schrillte der Alarm. Kathy sah Nataly verwundert an. Was war los? Sie rannten durch den engen, grauen Korridor in die Kommandozentrale und bekamen das Stottern des durchsichtigen Fithuul Zerzu mit.
»Ein grässliches, haariges Monster war auf einmal hier. Es hatte lange Zähne und große, böse Augen! Dann war es wieder weg!«
Sie beobachte, wie die Organe des Fithuul pulsierten, sein Blut schneller durch die Adern floss und sie sich weiteten. Das Wesen mit der transparenten Haut war in heller Aufregung.
»Du hast zu viel Arawakplörre gesoffen«, meinte der Manjor Craasp und schlug dem Fithuul auf den Hinterkopf.
»Nein, es ist wahr! Der stumme, blinde Jako hat es auch gesehen! Fragt ihn!«
Danton schüttelte genervt den Kopf.
»Haarige Monster mit großen Augen auf der DUNKELSTERN? Hm, das könnten alle möglichen Wesen sein … wir … aber …«
Wieso stotterte Danton? Er schien durch sie hindurch zu starren. Zerzu fing an zu schreien, Craasp warf sich hinter eine Konsole. Kathy wusste, dass das behaarte Monster nun direkt hinter ihr stehen musste. Also drehte sich Kathy ganz langsam um, bereit dem Grauen ins Auge zu blicken.
Es hatte braune, große Kulleraugen.
Das debile Kichern des beharrten Winzlings jagte ihr keine Angst ein. Sie war überrascht und erleichtert zugleich. Was vor ihr auf einer Konsole mit seinen knapp einem Meter stand, war kein Ungeheuer, und doch war es eine Sensation!
Die großen Augen schauten sie heiter an, die runden Ohren standen schräg in die Höhe, die Nagezähne blitzten weiß aus dem spitzen Mäulchen.
Was vor ihr stand, ähnelte einem Mausbiber.
»Gucky?«
»Gagga?«, antwortete das Wesen mit piepsiger Stimme.
»Nein, Gucky!«
»Guggu?«
Roi ging langsam auf Kathy zu, doch der Iltartige fing an, unruhig auf der Stelle zu hüpfen. Roi machte ihm offenbar Angst.
»Habt ihr Gemüse?«, fragte sie.
»Nein, aber Alkohol …!«, antwortete Roi.
Nataly lief in die Kombüse, um etwas zu holen. Kathy bat die anderen, Abstand zu halten. Offenbar schien das Wesen zu ihr Vertrauen zu haben, aber zum Rest der Belegschaft wohl nicht. Sie schmunzelte, es besaß eine gute »Wesenskenntnis«.
Als Nataly wiederkam, hielt sie eine Mohrrübe in der Hand. Sie winkte lockend mit dem Gemüse.
»Yahka«, piepste das Wesen vergnügt und schleckte sich mit der Zunge über die Lippen.
Nataly ging langsam vor und hielt die Mohrrübe der putzigen Kreatur vor die Nase. Nun kam auch Kathy näher, bis beide vor dem Ilt oder was immer es auch war standen. Er griff mit seinen kleinen Händchen die Mohrrübe und biss herzhaft rein. Kathy und Nataly streichelten ihn.
»Der ist ja sooo süß«, sagte Nataly und kraulte ihn hinter den Ohren. Das Wesen steckte sich die Mohrrübe in den Mund, krallte sich an Kathy und Nataly fest, und plötzlich spürten die Frauen, wie sich ihr Magen umdrehte. Die Zentrale löste sich auf, und sie standen unvermittelt am Rand eines Urwalds.
Der kleine Mausbiber gackerte belustigt und hoppelte in den Wald hinein.
»Blödes Mistvieh«, schimpfte Nataly hinter ihm her. »Kommst du wohl her? Bei Fuß! Hörst du nicht?«
Kathy sah sich um. Sie befanden sich irgendwo auf dem Rideryon. Die Sonne schien, also irgendwo auf der hellen Seite, aber das war ja nur eine ein paar Millionen Quadratkilometer große Landmasse. Sie steckten nun in einem ziemlichen Schlamassel!
*
»Huch, wo sind sie hin?«
Danton starrte verwundert auf den Fleck, wo sich eben noch Nataly, Kathy und dieser Mausbiberverschnitt befunden hatten. Offenbar war die Kreatur auch noch Teleporter. Roi versuchte die Überraschung, dass sie hier scheinbar auf eine Gattung der Ilts gestoßen waren, erst einmal zu unterdrücken. Wichtig war jetzt festzustellen, wohin das Wesen mit den beiden Damen teleportiert war.
»Sucht die Gegend ab. Na los, ihr faules, leichtgläubiges Pack.«
Craasp, Hakkh und Zerzu sahen sich verdutzt an. Roland Meyers, Maya ki Toushi und Sato Ambush setzten sich sofort an die Ortungskontrollen.
»Kann man hier Individualimpulse eingeben?«, wollte Meyers wissen.
»Was für Pulse?«, antwortete Craasp verständnislos.
Meyers seufzte.
»Wir könnten versuchen, ihr Datenmuster in das System einzuspeisen und dann danach suchen«, schlug Sato Ambush vor. »Wir brauchen dabei nicht einmal die Daten der beiden Frauen, sondern es reichen terranische DNS-Muster. Es dürfte im Rideryon wohl nicht mehr als zwei geben.«
Roi stimmte der Idee des Pararealisten zu. Meyers schüttelte genervt den Kopf.
»Die primitive Ortung lässt das nicht zu. Es ist in der Software einfach nicht vorgesehen, nach speziellen Lebewesen zu suchen. Das System zeigt Siedlungen, Landschaften und Lebenszeichen, lässt diese aber nicht genauer definieren.«
»Dann werden wir aus der Not eine Tugend machen und die Software entsprechend umprogrammieren«, entschied Ambush freundlich. »Wenn Sie mir dabei assistieren möchten, Meyers-San, wäre ich geehrt.«
Meyers nickte. Die beiden machten sich sofort an die Arbeit, während Roi das ungute Gefühl überkam, dass sich ihre Situation schlagartig verschlechtert hatte.
Die Zeit läuft davon
Roi Danton blickte unruhig auf sein Chronometer. Seit zwei Tagen tüftelten Ambush und Meyers nun an dem Ortungsgerät – ohne sichtbaren Erfolg. Die Suchaktionen hatten bisher nichts gebracht. Die Zeit lief ihnen davon, denn Kathy und Nataly waren da unten völlig auf sich allein gestellt. Sie suchten ein Areal von mehreren hunderttausend Quadratkilometern nach den beiden ab.
Er wusste, dass ein Mausbiber sogar einige tausend Lichtjahre weit teleportieren konnte, wie es zum Beispiel Guckys Söhnchen Jumpy direkt aus dem Bauch seiner Mutter Iltu vor vielen, vielen Jahrhunderten getan hatte. Damals war er von Terra bis zu den Koordinaten von Tramp gesprungen.
Ob diese iltähnlichen Wesen das auch konnten, wusste er nicht, er vermutete jedoch, dass es Wesen vom Riff waren und sie dort irgendwo zu finden waren. Bei einem gigantischen Haufen Steine, Erde und Wasser mit einer Länge von vierzig Millionen Kilometern war es jedoch schwer, die beiden Frauen wiederzufinden, zumal die VIPER unter Fyntross, der Jaycuul-Ritter Flegorn und der Ylors Medvecâ auch noch irgendwo lauern mussten.
Er bemerkte, dass Maya ki Toushi mit seltsamem Gesichtsausdruck durch die Gegend starrte. Er stellte sich vor sie, winkte, und als sie nicht reagierte, schnitt er ein paar Grimassen. Immer noch keine Reaktion.
Er überlegte, ob sie unter Katalepsie litt oder zu viel Drogen genommen hatte.
»Meyers, Ihre Freundin glotzt sinnlos durch die Gegend«, rief er dem ehemaligen Kommandanten der FLASH OF GLORY zu.
Meyers überließ Ambush das Ortungsgerät und schaute zu Maya hinüber. Er ging zu ihr und rüttelte sie an den Schultern.
»Hey, Schlafmütze, aufgewacht!«
Nun endlich reagierte sie. Ihre Worte klangen abwesend.
»Sie hat hier gelebt und ist hier gestorben, doch ihr Geist ist in der Ferne gefangen. Der Weg durch die Hölle führt zu ihrer verlorenen Seele.«
»Häh?«, machte Danton und verstand kein Wort, während Meyers nur verständnislos den Kopf schüttelte.
Maya starrte beide weiterhin verständnislos an. Sie fuhr sich mit ihren Händen durch ihre rote, halblange Mähne, dann sprach sie mit derselben, tonlosen Stimme weiter.
»Versteht ihr Narren gar nichts? Sie war hier! Und ich weiß es. Aber nicht wieso. Wisst ihr es?«
»Nein, Mademoiselle! Wir wissen nicht, was Ihr wisst, geschweige denn wissen wir, warum Sie nicht wissen, dass Sie etwas wissen, von dem Sie eigentlich gar nichts wissen können. Verstehen Sie?«
Maya bedachte Roi Danton mit einem tödlichen Blick. Sie wirkte mehr und mehr, als wäre sie nicht mehr sie selbst.
»Ich fühle es ganz deutlich, ihre Seele ruft mich. MUTTER schenkte uns Erleuchtung, die göttliche Eingebung des Weges zu ihr.«
Nun meldete sich auch Sato Ambush zu Wort. Der kleine Pararealist war hellhörig geworden.
»Mit MUTTER wird sie SI KITU meinen. Vergesst nicht, dass SI KITU die Besatzung der FLASH OF GLORY schon länger beobachtet hat. Offenbar galt SI KITUS Interesse besonders Maya ki Toushi.«
»Aber wieso?«, wollte Meyers wissen.
»Die Antwort auf diese Frage liegt wohl in der gleichen Dunkelheit, in der auch Mayas Vergangenheit liegt«, antwortete der Japaner.
Die Angesprochene schob Meyers beiseite. Wie in Trance bewegte sie sich durch die Kommandozentrale. Sie wirkte orientierungslos, als befände sie sich in einer anderen Dimension.
»Er hat sie getötet und ihren starken Geist geknechtet und verbannt. Ich muss sie finden und ihren Geist retten. Sofort. Kehrt um, wir müssen sie suchen!«
»Aber wen denn?«, wollte Meyers wissen.
Maya ergriff plötzlich einen Kombistrahler und hielt ihn auf Meyers, Ambush und Danton gerichtet. Danton dämmerte es langsam, dass Cul’Arcs Aussage, Maya ki Toushi sei eine Hexe, mehr Bedeutung hatte, als er ihr zuerst beigemessen hatte. Offenbar stand sie in einer besonderen Verbindung zu SI KITU.
»Versteht ihr nicht? Ich muss gehen! Ich muss ihrem Ruf folgen und kann euch dabei nicht gebrauchen, wenn ihr mir nicht helfen wollt. Ich nehme jetzt ein Beiboot. Wer mich daran hindern will, der wird es bereuen!«
Danton deutete den anderen an, Maya in Ruhe zu lassen. Ki Toushi stand unter dem Einfluss von irgendetwas. Oder zeigte sie ihre wahre Natur? Eines war klar, sie war wohl keine Terranerin im normalen Sinne. Aber war sie tatsächlich eine Hexe, wie sie von Cul’Arc bezeichnet wurde? Auf jeden Fall schienen sich nun ihre Wege zu trennen. Wohin ihr Weg führen würde, war unklar.
Roland Meyers versuchte dennoch, auf Maya einzureden, doch sie hörte nicht auf ihn. Mit einem knappen Lächeln verabschiedete sie sich von ihm und lief zum Hangar. Wenige Minuten später startete eine der zwei Fähren der DUNKELSTERN und hielt direkt auf das Rideryon zu.
Maya ki Toushi war weg. Ebenso wie Kathy und Nataly. Doch diese beiden mussten sie wiederfinden.
»Macht euch wieder an die Arbeit. Dieses blöde Ortungsdings soll endlich funktionieren!«
Sato nickte in japanischer Tradition, während Meyers kommentarlos einfach zur Apparatur ging und sich schweigend an die Arbeit machte. Vermutlich machte ihm das plötzliche Verschwinden von Maya zu schaffen. Oder von Nataly? Ihm war die heimliche Affäre nicht entgangen, doch er hatte es nicht für nötig gehalten, beide damit zu konfrontieren. Das war ihre Sache.
»Achtung! Wir orten ein großes Raumschiff in zwei Millionen Kilometer Entfernung«, meldete Craasp.
»Nicht gut«, murmelte Danton. »Und?«
Craasp sah Danton entsetzt an. »Es ist die VIPER!«
*
»Alle Männer sofort auf ihre Posten«, brüllte Danton. »Können wir sie abhängen?«
»Ich fürchte nicht«, erklärte Meyers. »Es wäre so, als würde ein Benzinauto versuchen, einen Gleiter abzuschütteln.«
»Eine Antwort, die ich nicht hören wollte …«
Roi dachte angestrengt nach, wie sie der VIPER entkommen konnten. Er starrte auf die tiefen Klüfte zwischen den Bergen des Riffs. Im Gebirge hatte er eine Chance gegen die größere VIPER.
»Meyers, das Steuer bitte!«
Roland Meyers übergab Danton den Platz an der Steuerung des Schiffes. Vor Danton baute sich eine Konsole auf. Hier gab es keine SERT-Haube oder vergleichbare Steuerungen. Wenn man die DUNKELSTERN manuell steuerte, dann mit einem Joystick.
Danton aktivierte die manuelle Kontrolle, umklammerte den Stick mit der rechten Hand und starrte auf den großen Bildschirm vor ihm.
»Meyers ans Waffensystem, Sato an die Reaktorsteuerung. Der Rest: Beten!«
Danton gab Sato ein Zeichen, auf volle Leistung zu gehen. Sie kamen dem Riff näher, doch die VIPER befand sich inzwischen hinter ihnen. Sie verkürzte die Distanz zur DUNKELSTERN mehr und mehr.
Plötzlich erschien der Fischkopf von Fyntross als Holographie rechts neben Danton, der bei dem Anblick zusammenzuckte. Damit hatte er nicht gerechnet.
»Ah, der Dieb meines Raumschiffes«, sagte Fyntross.
»Nein, nein, der Dieb eines Raumschiffes, dessen Bestohlener der Dieb meines Raumschiffes ist, n’est-ce pas?«
Fyntross’ knallrote Lippen bebten vor Wut.
»Die VIPER ist ein schnuckeliges Schiff, doch ich will die DUNKELSTERN zurück. Zwei Schiffe sind besser als eines. Ergebt euch und ich verschone die Crew. Diesmal werden dich keine Jaycuul und Ylors retten!«
Roi dachte nicht im Traum daran, diesem Fyntross zu vertrauen. Das braunschuppige Fischwesen mit den Stielaugen und dem roten Mund war ebenso ruchlos wie hässlich.
»Wollen wir nicht verhandeln?«, fragte er, um Zeit zu gewinnen.
»Pah, ich bin geneigt, deinem Ersuchen nicht nachzukommen, Terraner. Also, nein! Ergebt euch oder sterbt!«
»Dann ist dein Schiffchen aber immer noch kaputt …«
»Wenn es sein muss!«, erwiderte Fyntross amüsiert. Danton zweifelte nun nicht mehr daran, dass er im äußersten Fall die DUNKELSTERN vernichten würde.
Sie kamen dem Rideryon immer näher. Schließlich erreichte die DUNKELSTERN ein gigantisches Gebirge. Die Berge, Schluchten und Abgründe waren fast hundert Kilometer hoch und ebenso tief. Die Gipfel waren mit Schnee und Eis bedeckt, in manchen Schluchten floss brodelnde Lava. Danton lenkte das Schiff in die dichte Wolkendecke. Er konzentrierte sich auf die digitale Abbildung des Gebirges. Hoffentlich stimmten sie, denn viele Kollisionen konnte er sich nicht leisten.
Die VIPER holte auf, sie war nur noch einige tausend Kilometer von ihnen entfernt, doch Fyntross feuerte noch nicht. Worauf wartete er? Bluffte er womöglich doch nur?
»Die VIPER wird langsamer«, meldete Zerzu.
»Wieso? Was?«, stieß Roi verwundert aus.
»Das ist das Tal der Geister im Land der ewigen Vulkane. Hier fliegt man nicht so einfach herein. Es heißt, die Jaycuul-Ritter haben hier ihre Burg und unterrichten die Termetoren«, erklärte Craasp ehrfürchtig. »In den Schluchten des Gebirges lernen sie das Töten. Es gibt im Umkreis von tausenden Kilometern keine Siedlung.«
Danton grinste.
»Fein, dann sind wir hier genau richtig.«
Er steuerte die DUNKELSTERN durch eine enge Schlucht. Sie war nicht viel breiter als das Raumschiff. Hinter ihnen detonierten die ersten Salven der VIPER. Doch das Schiff wahrte Abstand. Fyntross hatte Angst!
Plötzlich ging ein Ruck durch die DUNKELSTERN.
»Was ist passiert? Schadensmeldung?«
»Wir sind nicht getroffen worden, Sir! Aber wir haben die Hälfte unserer Energie verloren«, meldete Meyers.
»Mist! Aber warum? Das ist unfair!« Die DUNKELSTERN wurde langsamer und er erkannte an den Energieanzeigen, dass der Schutzschirm auch stark geschwächt wurde. Die VIPER holte auf und verlangsamte ebenfalls abrupt. Was auch immer für ihren Energieverlust verantwortlich war, es hatte die VIPER auch erwischt. Damit hatten sie eine Chance.
»Meyers, alle Heckwaffen sofort Feuer!«
»Aye!«
Meyers schoss alle Hecktorpedos ab und feuerte mit den drei Impulsgeschützen auf die VIPER. Der Schutzschirm flackerte, zeigte Risse. Blitze bildeten sich um die VIPER. Das Schiff driftete ab und knallte an die rechte Seite der Felswand. Es prallte ab, nachdem es Unmengen von Geröll losgerissen hatte, und donnerte an die gegenüberliegende Seite. Wie ein Pingpongball prallte die VIPER zwischen den Wänden der Schlucht ab und verlor an Höhe. Tonnen an Geröll und Gestein prasselten in den Lavastrom oder auf das Raumschiff.
Die VIPER stürzte in den Lavasee, raste hindurch und gewann langsam wieder an Höhe. Die Aktion musste Fyntross und seine Crew ziemlich mitgenommen haben. Die Besatzung des Arawakpiraten war unerfahren im Umgang mit der terranischen Technik. Ein versierter Raumfahrer Terras oder des Quarteriums hätte das Schiff stabil gehalten. So einer wie Roi Danton.
Plötzlich ein Schuss auf die DUNKELSTERN. Er ließ das Piratenschiff unkontrolliert nach rechts driften und drückte das Schiff gegen die Wand. Die langgezogene Walze donnerte mit dem Heck gegen die Felswand und schliff mehrere tausend Meter an ihr entlang. Er drehte hart Backbord, um gleich wieder gegenzulenken. Nun war die DUNKELSTERN wieder stabil.
»Ups«, murmelte er kleinlaut.
Der Schuss war von der VIPER gekommen. Fyntross gab nicht auf. Die VIPER kam näher, war immer noch schneller als die DUNKELSTERN. Meyers feuerte erneut und der angeschlagene, ohnehin seit Monaten nicht mehr richtig funktionierende Schutzschirm brach zusammen. Die VIPER schoss zurück und traf die DUNKELSTERN empfindlich, denn auch ihr Schutzschirm war am Ende.
»Sie benutzen MVH-Geschütze. Das könnte gefährlich werden«, meldete Meyers.
Die DUNKELSTERN wurde in ein Feuerinferno eingehüllt. Die Felswand stürzte auf sie hinab. Danton biss die Zähne zusammen und manövrierte die DUNKELSTERN zwischen den herabfallenden, teilweise über hundert Meter großen Brocken. Die VIPER wurde getroffen, doch Fyntross schien es nicht zu interessieren.
Das Hologramm von Fyntross erschien wieder in der Zentrale der DUNKELSTERN.
»Danton, ich ziehe meinen Hut vor dir! Diese Jagd ist ein Heidenspaß. Doch leider wird es kein gutes Ende für dich und deine Mannschaft nehmen.«
Fyntross lachte gellend. Die VIPER beschleunigte und drohte, die DUNKELSTERN zu rammen. Danton zog hoch und der Gegner rauschte unter ihnen vorbei. Dabei feuerte die Viper und traf die DUNKELSTERN. Eine Explosion jagte die nächste.
Zwei der Triebwerksträger wurden abgeschossen. Die VIPER bremste und war plötzlich wieder hinter ihnen. Roi täuschte an abzutauchen, zog die DUNKELSTERN erneut hoch, damit die VIPER wieder unter ihnen durchfliegen sollte, doch die Metallarme an der Unterseite der DUNKELSTERN verhakten sich in der Außenhülle des Gegners, rissen wie Krallen tiefe Furchen in das Schiff und blieben schließlich hängen.
»Wir haben angedockt«, meinte Danton trocken. »Alle Mann zum Entern bereit machen!«
»Entern? Mit wem denn?«, wollte Craasp wissen.
»Ich töte alle«, brüllte der Zwerg Hakkh, schaute wie immer grimmig drein und hob drohend seinen Hammer.
»Gut, dann mal an die Arbeit.« Danton versuchte, mit maximalem Schub die DUNKELSTERN loszureißen, doch es funktionierte nicht.
Die VIPER wurde langsamer. Offenbar machten sich nun Fyntross’ Männer zum Entern bereit. Roi gab es auf, die DUNKELSTERN zu steuern. Sie saß fest.
»Ideen, messieurs?«
»Kapitulation?«, schlug Zerzu vor.
»Eine Entschuldigung bei Fyntross?«, fragte Craasp kleinlaut.
»Eine List doch eher«, schlug Sato Ambush vor. »Fyntross wird mit fast allen seiner Leute die DUNKELSTERN kapern. Wir werden derweil einfach in die VIPER gehen und sie erbeuten.«
Der Japaner grinste. Roi Danton gefiel diese Idee. Sie hätte von ihm sein können.
»Also gut. Legt einen Prallschirm um die Zentrale. Sie sollen eine Weile daran knabbern, bis sie hier eindringen können. Der Rest der Crew macht sich schon einmal auf den Weg zur VIPER. Meyers, führen Sie die Leute an. Sie kennen die Schlupfwinkel des Schiffes.«
»Und Sie, Sir?«
Danton machte eine theatralische Geste.
»Werde mich dem Angesicht der Fischfresse stellen. Zumindest muss ich ihn an Bord der DUNKELSTERN einladen. Wir treffen uns auf der VIPER. Wenn ich in fünfzehn Minuten nicht da bin, wisst ihr, was zu tun ist!«
»Ja, Sir! Wir fliegen los!«
»Nonsens, ihr wartet noch mal fünfzehn Minuten!«
*
»Hey, Fischstäbchen!«
Wie erwartet, glotzte Fyntross ihn verständnislos an. Was war ein Fischstäbchen? Der Kapitän des Resif-Sidera wusste natürlich damit nichts anzufangen.
Einen Moment lang starrten sich beide schweigend an, ehe Danton das Wort ergriff.
»Also gut, du hast gewonnen. Die DUNKELSTERN ist fast Schrott und kann nicht mehr starten. Wir ergeben uns.«
Fyntross musterte ihn eindringlich.
»Das war’s? Einfach so aufgeben? Kein Trick?«
»Na gut, schon einer. Ich habe eine Bombe an Bord der DUNKELSTERN versteckt. Sie geht in fünfzehn Minuten hoch und wird beide Schiffe zerstören. Aber ansonsten hat die Sache keinen Haken.«
Danton drückte auf die automatische Steuerung der Rettungskapseln. Er ließ eine starten.
»Dummerweise sind jetzt nur noch zwei Rettungskapseln übrig. Eine nehme ich – und du? Bin wohl eher dort. Also gehabe dich wohl.«
Danton verbeugte sich galant vor dem Kapitän und beendete die Verbindung. Roi eilte aus der Kommandozentrale. Zuerst lief er zum Hangar und startete nach drei Minuten die zweite Kapsel. Dann rannte er zur hintersten Schleuse und öffnete sie. Ihm war es etwas mulmig dabei, an den Halterungen der Außenhülle zur VIPER zu klettern. Obwohl die VIPER langsam flog, war es ziemlich windig und die heißen Dämpfe der gigantischen Lavaflüsse taten ihr Übriges.
Und tatsächlich fuhren Andockschleusen aus der VIPER heraus. Einige Piraten rannten sogar auf dem Deck in Richtung DUNKELSTERN. Eine Böe erwischte einen zierlichen Fithuul und wehte ihn einfach über Bord. Schreiend fiel er in den Lavastrom.
Danton beschloss, sehr vorsichtig und mit nötiger Ruhe zur VIPER zu gehen. So recht traute er sich nicht, den Stahlträger der DUNKELSTERN, welcher sich in die Hülle des anderen Schiffs gebohrt hatte, loszulassen.
Eine Schleuse der VIPER war nur fünfzig Meter von ihm entfernt. So nah und doch so fern. Hätte er doch nur einen SERUN. Die Hülle der VIPER war eben. Es gab kaum Halterungen, Masten oder Ausbuchtungen. Danton schätzte die Windstärke auf mindestens hundertfünfzig Kilometer in der Stunde.
Hastig und doch mit Vorsicht, bedacht, nicht vom Winde verweht zu werden, arbeitete er sich bis zur Schleuse vor, stieg ein und schloss sie. So schnell er konnte, lief er in die Kommandozentrale. Dort warteten die anderen Besatzungsmitglieder bereits auf ihn.
»Schutzschirm aktivieren und weg hier.«
»Die VIPER ist ziemlich angeschlagen, Sir. Ich fürchte, sie hält nicht mehr lange durch. Wichtige Systeme sind beschädigt und ohne Ersatzteile, die es im Riff definitiv nicht gibt, können wir sie nicht reparieren«, meldete Meyers.
»Oh!«, machte Danton und überlegte angestrengt, was sie nun tun sollten. Er verfluchte Fyntross und seine DUNKELSTERN, doch das Raumschiff war noch halbwegs intakt und auf Thol2777 konnte man sie reparieren.
»Verbindung zur DUNKELSTERN herstellen. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir das Fischstäbchen zu Gesicht bekommen.«
Und so war es auch. Das illustre Gesicht von Kapitän Fyntross erschien auf dem Monitor.
»Danton! Ich …«
»Sachte, mein Freund! Es ist wieder mal ein Patt entstanden. Du sitzt auf der DUNKELSTERN fest und die VIPER ist nicht mehr im besten Zustand. Wir fliegen nach Thol2777 und lassen die DUNKELSTERN reparieren. Ich kaufe dir das Raumschiff ab – als Geschenk kriegst du die VIPER.«
»Aber das Raumschiff ist Schrott.«
»Im gewissen Sinne ja, aber denk an die Technik. Wenn du sie studierst, lernst zu verstehen, kannst du die VIPER reparieren und der Herr des Resif-Sidera werden. Keiner ist dann ein so mächtiger Pirat wie du!«
Fyntross schwieg und dachte offenbar über das Angebot nach. Danton sah, wie er mit dem Persy Mumdök beriet. Mumdök wabbelte seltsam, offenbar eine Art Zustimmung oder Ablehnung. Danton pokerte hoch und ihm war nicht wohl bei dem Gedanken, die Technik der VIPER den Rideryonen zu überlassen. Doch er brauchte ein flugfähiges Raumschiff, um Kathy und Nataly zu finden und anschließend das Riff zu verlassen.
»Abgemacht! Diesmal keine Tricks. Wir bleiben ruhig und friedlich, helfen dir, die DUNKELSTERN zu reparieren, und behalten die VIPER.«
»Klar soweit! Dann wünsche ich eine gute Reise. Wir fliegen auch vorsichtig, damit ihr nicht plötzlich abgerissen werdet.«
Er beendete die Verbindung und spürte die beunruhigten Blicke von Meyers und Ambush.
»Wir haben keine andere Wahl. Der Mann ist ein Gauner mit Ehre. Wir können ihm vertrauen, denn die Aussicht, größter Pirat im Resif-Sidera zu werden, ist ihm sicherlich das Wichtigste.«
Er hoffte es zumindest und gab den Befehl, nach Thol2777 zu fliegen. Er fürchtete, dass sie dort eine Zeit verbringen würden, und das bedeutete für Kathy und Nataly, dass sie noch eine Weile auf sich allein gestellt waren.
Rückkehr zum Dorf
Einen Zwischenstopp wollte Roi noch machen. Er hatte es Hurtel und den anderen Dorfbewohnern versprochen. Die beiden verkeilten Raumschiffe brauchten zwei Tage, um die Strecke zum Dorf zurückzulegen.
Da Kapitän Fyntross ihm offenbar nicht traute, bestand der Fischkopf darauf, ihn zum Dorf zu begleiten. Roi, Fyntross und Sato Ambush flogen mit einer Space-Jet zum Dorf und landeten auf den abgebrannten Feldern. Die Wracks der Raumschiffe befanden sich noch immer dort.
Es dauerte nicht lange, bis die ersten Dorfbewohner auf sie zu liefen. Allen voran Pyla und Paddy. Sie warf sich Roi um den Hals und knutschte ihn ab.
»Ich wusste, dass du wiederkommst, mein Retter!«
Paddy ging sabbernd und lachend auf Fyntross zu und betatschte ihn. Fyntross schubste Paddy weg. Ihm war das wohl unangenehm.
Nun tauchten auch Hurtel, Jock und Carah auf. Ihnen folgten Jork, Krydemann und seine beleibte Frau Lachsee.
»Du bist zurückgekehrt. Bringst du noch mehr Unheil?«, fragte Jock gereizt.
»Nein! Es tut mir leid, dass ihr in die ganze Sache verstrickt wurdet, doch ich habe euer aller Leben gerettet. Entweder er hier …«, Danton deutete auf Fyntross, »oder die Ylors hätten euch getötet. Nun suchen sie uns und haben keine Ahnung, dass wir hier sind.«
»Was willst du noch hier?«, fragte Hurtel ruhig. »Ich bin dir dankbar, dass du meine Tochter gerettet hast, doch was ist, wenn die Finsteren und der Kuttenritter zurückkehren?«
Auf diese Frage war Roi vorbereitet.
»Wir werden euch Technik zur Verfügung stellen. Ein Schutzschirm und Defensivwaffen, Medizin und einen Energiegenerator. Damit könnt ihr euch gut absichern und in Ruhe und Frieden leben.«
So recht glaubte er jedoch nicht daran. Wenn die Ylors wollten, würden sie alle Dorfbewohner vernichten. Am liebsten wäre ihm gewesen, wenn alle Bewohner sich ein neues Plätzchen suchen würden.
»Von welchem Schiff nehmen wir eigentlich die Bewaffnung? Von meiner DUNKELSTERN oder meiner zukünftigen VIPER?«, fragte Fyntross schrecklich gehässig.
»Etwas von beiden. Dein fetter Mumdök kann uns sicher Ersatz auf dem Piraten-Tholmond besorgen.«
»Jetzt spielen wir schon die helfenden Heiligen«, jammerte Fyntross. Paddy schien das zu freuen.
»Guter Mann mit roten Lippen! Guter Mann. Tut Gutes für Dorf. Paddy hat ihn lieb.«
Paddy umarmte eines von Fyntross drei Beinen und streichelte es.
»Lass das!«, blubberte der Piratenkapitän ungehalten, doch Paddy reagierte nicht darauf. Nun spürte Roi Pylas Hände an seinen Hüften. Sicherlich war Pyla deutlich hübscher als Paddy und zudem eine Frau, aber irgendwie konnte er Fyntross’ Unwohlsein jetzt nachempfinden.
Roi gab Craasp, Hakkh und Zerzu ein Zeichen. Die Rideryonen brachten die technischen Geräte. Sato Ambush und Roland Meyers folgten ihnen, um den Generator zu installieren.
Die Geräte hatten sie aus dem Lager der VIPER genommen. Sie dienten zur Sicherung und Energieversorgung für Lager auf fremden Planeten. Das komplette Set bestand aus zwei Energiereaktoren, einem Schutzschirm, Warnmeldeanlagen, einer kleinen Medostation, einem Heizungssystem und Defensivbewaffnung.
Für die Einheimischen war es sicherlich ein Wunderwerk. Bei der LFT und dem Quarterium gehörte es zum normalen Standard. Roi registrierte, dass auch Fyntross mit großem Interesse die Technologie betrachtete.
*
Nach einigen Stunden war alles installiert. Danton, Fyntross, Ambush und Meyers wurden angemessen gefeiert.
Roi verzichtete an diesem Tag auf den Alkohol. Er hatte in letzter Zeit sowieso zu viel getrunken. Zwar neutralisierte der Zellaktivatorchip jegliche Vergiftung des Körpers und verhinderte somit dauerhafte Schäden, doch die Sinnesbeeinflussung minderte er nur bedingt. Unter den gegebenen Umständen wollte er einen klaren Kopf behalten.
»Sag, Hurtel, hast du jemals Wesen gesehen, die aussehen wie eine Kreuzung zwischen einer Maus und einem Biber?«
Der Bürgermeister blickte den Terraner schräg an.
»Nein, solche Wesen sind mir unbekannt. Doch das Rideryon ist groß. Sucht, und ihr werdet sie bestimmt finden.«
Toller Rat! Er hatte nicht so viel Zeit. Je länger Kathy und Nataly verschwunden waren, desto größer wurde die Möglichkeit, dass ihnen etwas zustieß.
Jock, Pyla und Paddy traten auf ihn zu.
»Wir haben eine Bitte«, begann Jock.
Paddy nickte eifrig mit dem Kopf, während Pyla lüstern grinste und mit ihrer piepsigen Stimme ein »Ja« hauchte.
»Nun?«, wollte Danton wissen.
»Wir wollen uns deiner Crew anschließen und durch die Sterne fliegen«, sagte Pyla und streckte die Arme in den Himmel.
Fyntross fing an zu lachen.
»Drei primitive Schwachsinnige sind wahrlich eine Bereicherung für deine Crew, Terraner.«
Der Pirat blubberte spöttisch. Doch er hatte nicht ganz unrecht. Pyla hatte sicherlich die besten Attribute. Sie war eine Frau und schön. Sie könnte seine Ordonnanz werden. Jock und vor allem Paddy waren jedoch wenig geeignet.
»Das Weltall ist ein gefährlicher Platz.«
»Aber auch faszinierend. Wir lernen neue Wesen kennen und können helfen, wie du. Das will ich auch!«
Er blickte Pyla überrascht an. War das noch das gleiche Mädchen, welches doch offensichtlich recht umtriebig war? Eine seltsame Frau. Irgendwie aber auch interessant.
»Als Handwerker kann ich doch im Maschinenraum arbeiten. Ich lerne schnell.«
Nun, vielleicht konnte man Jock tatsächlich für die handwerklichen Tätigkeiten einsetzen. Schließlich brauchte man kein Diplomabschluss, um eine Leitung zu reparieren. Vielleicht konnte Roi beide auch noch einer Hypnoschulung auf der VIPER unterziehen.
Aber Paddy? Roi fühlte den treuherzigen Blick des armen Kerls auf sich ruhen. Er hatte wirklich keine Verwendung für ihn. Weiß Gott, es waren schon genügend Irre auf dem Raumschiff.
»Pyla und Jock dürfen mit. Paddy nicht. Es tut mir leid, aber er kann uns nicht helfen.«
»Du bist ein Spießer! Der arme Paddy«, schimpfte Pyla.
Der behinderte Buuraler fing an zu weinen. Danton verdrehte die Augen, während Fyntross amüsiert blubberte.
»Das ist kein Spaß da draußen. Ihr verlasst euer wohlbehütetes Zuhause und stürzt euch in gefährliche Abenteuer. Paddy ist der Sache nicht gewachsen. Er würde sterben! Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob ihr zwei tauglich seid.«
»Sind wir«, konterte Pyla umgehend.
Jock schien genauer über die Sache nachzudenken.
»Ich bin mir der Gefahren bewusst. Doch es ist mein Wunsch, zu den Sternen zu fliegen.«
Die Tochter des Bürgermeisters stellte sich vor Danton und sah ihn ernst an. Es war offenbar das erste Mal, dass sie das tat, zumindest kannte er diesen Blick von ihr nicht.
»Ich will auch zu den Sternen!«
»Das könnte ein sehr langer Abschied von eurer Heimat werden.«
»Ich weiß …«
»Also gut. Ihr beide habt meine Genehmigung.«
Pyla schrie laut auf, umarmte und küsste ihn. Dann knutschte sie fröhlich mit Jock weiter.
Irgendwie hatte Roi das Gefühl, dass er einen Fehler begangen hatte.
Im Walde
»Wo sind wir?«, fragte Nataly.
»Irgendwo auf dem Riff. Keine Ahnung jedoch, wo wir uns genau befinden.«
Kathy sah sich um. Die Sonne schien, aber es war nicht unbedingt warm. Sie standen vor einem großen Wald mit seltsam geschwungenen Bäumen, die diesmal rotschwarze Blätter trugen. Der Boden war trocken, braun und mit wenig Gras bewachsen.
Ein grünlich schimmernder Wurm kroch mühsam über den Boden und verschwand in einem Loch. Ein Schwarm doppelköpfiger schwarzer Vögel flog krächzend über sie hinweg. Offenbar waren sie aus dem Wald gekommen.
Immerhin erblickte sie am blauen Himmel oberhalb des Blattwerks einige jener gleißenden Vierflügler, deren eng gezogene Kurven sie wie Tau im Morgenrot aufleuchten ließ. Diese Tiere hatte sie schon in der Nähe des Dorfes bewundert.
»Wie weit kann so ein Mausbiber teleportieren?«
Kathy zuckte mit den Schultern.
»Sicherlich ein paar hunderttausend Kilometer. Da die Sonne hier scheint, müssen wir uns weit entfernt haben.«
»Das glaube ich nicht.« Nataly deutete auf die schwarzgraue Nebelwand, die deutlich hinter einem großen Hügel erkennbar war. Offenbar befanden sie sich am Rand der Grenze zwischen Licht und Dunkelheit, also noch immer in der Nähe der Randzone zur Unterseite des Riffs.
Der Wald lag am Fuße des kleinen Berges. Kathy sah keinen Sinn darin, dass sie hier ausharrten, bis Hilfe kam. Es würde vermutlich seine Zeit dauern, bis die DUNKELSTERN sie fand. Sie schlug Nataly vor, in den Wald zu gehen.
»Vielleicht kann uns ja der komische Mausbiber weiterhelfen. Der hat uns das schließlich eingebrockt«, stimmte ihre Freundin zu.
Kathy glaubte weniger, dass der Ilt ihnen helfen konnte. Er hatte auf sie keinen intelligenten Eindruck gemacht. Die beiden Terranerinnen gingen zögerlich auf den Wald zu.
»Ziemlich dunkel da drin«, bemerkte Nataly.
Auch Kathy war nicht besonders wohl zumute. Sie konnten vielleicht auch außen herumgehen. Vermutlich hatte Nataly mit dem Mausbiber doch recht. Er war ihr einziger Anhaltspunkt. Also mussten sie ihn suchen. Vielleicht konnten sie ihn dazu bringen, sie zurück zum Schiff zu teleportieren.
Der erste Schritt in den Wald war am schwersten. Das Licht der Sonne fiel nur spärlich durch den dichten Blätterwald, doch es reichte, um die Pflanzen, getaucht in Dämmerlicht, zu sehen. Das ständige Knarren und seltsame Tierlaute taten ihr Übriges, um alles gruselig wirken zu lassen.
Sie wanderten mehr als eine Stunde durch die Wildnis und niemand begegnete ihnen. Abgesehen von einer ekligen fünfzig Zentimeter großen Spinne, welche den beiden eine enorme Angst eingejagt hatte. Sie hatten einen weiten Bogen um ihr Netz gemacht.
Endlich erkannte Kathy eine Lichtung. Sie hielten darauf zu. Auf der Wiese mit üppig gewachsenem Gras trampelte eine Herde Saurier entlang. Sie waren mindestens drei bis vier Meter hoch und erinnerten an einen Triceratops.
Nataly stupste ihre Freundin an und deutete nach rechts. Da saßen einige Mausbiber auf einer Anhöhe, andere hatten alle Viere von sich gestreckt, lagen auf dem Boden und ließen sich die Sonne auf den Pelz brutzeln. Wieder andere tollten freudig durch die Gegend.
»Eine ganze Herde Mausbiber! Es gibt hier also ein ganzes Volk. Wenn das Gucky sehen würde«, meinte Nataly und lächelte.
Ja, der kleine Gucky würde sich freuen, dass es noch Angehörige seiner Rasse oder zumindest derselben Gattung gab.
Nicht alle Mausbiber in der Herde hatten das typisch braunrote Fell. Einige von ihnen trugen auch weißen, schwarz-weißen oder grauen Pelz. Das Fellhaar war sehr lang. Die beiden gingen näher zu den Ilts, die sie offenbar längst bemerkt hatten, denn einige starrten in ihre Richtung.
Behutsam gingen Kathy und Nataly in gebührendem Abstand an der Saurierherde vorbei und waren noch etwa zwanzig Meter von dem Mausbiberrudel entfernt.
»Siehst du, ob der Frechdachs auch dabei ist?«, fragte Nataly.
»Nein«, antwortete Kathy knapp.
Je näher sie ihnen kamen, desto unruhiger wurden die Ilts. Einige fingen an zu fauchen, stellten sich auf die Hinterbeinchen und fletschten die Zähne. Sie besaßen nicht nur einen Nagezahn, sondern ein ganzes Gebiss. Plötzlich spürte Kathy eine mentale Welle, die sie und Nataly zu Boden warf. Demnach waren diese Ilts auch Telekineten.
Kathy wurde plötzlich hochgehoben, mehrmals gedreht und unsanft zu Boden geworfen. Sie bekam noch so etwas wie ein sadistisches Gelächter der Ilts mit. Sie verzog das Gesicht. Immerhin verstanden die halbintelligenten Wesen es, auf ihre Kosten ihren Spaß zu haben.
Langsam rappelte sie sich auf, doch gleich wurde sie wieder hochgehoben. Nun aber auch Nataly. Beide prallten mit voller Wucht gegeneinander, dann ließ man sie erneut fallen.
»Aua«, machte Nataly nur. Sie hielt sich die schmerzende Nase.
Kathy war auch nicht in der Lage, mehr zu sagen. Die Biester machten sich ein Vergnügen daraus, die beiden zu piesacken. Ein dicklicher Ilt mit braunem Fell kam näher. Mit großen Augen und zaghaften, kleinen Schritten ging er auf sie zu.
Die Terranerin saß auf dem Hosenboden und blickte dem Mausbiber in die großen, dunklen Kulleraugen. Er sah sie so traurig an, dass sie ihm nicht böse sein konnte. Der Mausbiber stand gut im Futter. Es war daher definitiv nicht derjenige, der sie hierher gebracht hatte.
»Guck mal, er sieht jetzt ganz süß aus«, rief sie.
»Wollen wir ihm einen Namen geben?«, fragte Nataly.
Kathy streckte die Hand zu ihm aus. Er schnüffelte lange dran, dann fing er an, die Hand abzuschlecken. Sie musste lachen, doch das verging ihr sofort, denn der Mausbiber biss auf einmal herzhaft zu. Schreiend zog sie die Hand zurück. Zu ihrer Erleichterung waren es nur winzige Bisswunden, aber es tat dennoch weh.
»Ja, wir nennen ihn Arschloch!«, fauchte sie.
Der Mausbiber kicherte und hielt sich seinen speckigen Bauch. Nataly holte aus, packte ihn am Nacken und hämmerte seinen Kopf zweimal auf den Boden.
»Aus, pfui!«, brüllte sie, doch dann war der Mausbiber plötzlich hinter ihr und versetzte ihr einen Tritt in den Hintern. Einen Lidschlag danach stand er wieder vor den beiden Frauen und grinste breit.
Nataly seufzte frustriert, und Kathy ging es auch nicht viel besser. Was sollten sie mit diesem frechen Ilt nur machen? Oder konnte er ihnen weiterhelfen, wenn sie es anders anstellten?
»Vielleicht ist er Telepath?«, vermutete Nataly. »Ich denke jetzt einfach an unser Raumschiff, aus dem einer seiner Kumpane uns entführt hat und in das wir wieder zurück wollen …«
Kathy blickte abwechselnd zum Ilt und zu Nataly. Doch vom Mausbiber mit der Plauze kam keine Reaktion.
»Ist halt nicht jeder der Retter des Universums«, meinte Nataly resigniert.
Da kam ein zweiter Mausbiber an. Diesmal war es derjenige, der sie entführt hatte. Er zeigte auf die Frauen und gackerte. Der Übeltäter war offenbar sehr amüsiert. Kathy hätte dieses Pelzknäuel am liebsten über die Knie gelegt, aber das brachte wohl nicht viel, da er sicherlich teleportieren würde oder Telekinese verwenden.
Der dicke Ilt schlug dem kleinen Mausbiber auf den Kopf und piepste etwas Unverständliches. Offenbar rügte er ihn für sein Verhalten. Wenn sie sich doch nur miteinander verständigen könnten. Doch Kathy hatte nichts mit, nicht einmal einen Translator.
Der dicke Ilt deutete den beiden an, ihm zu folgen. Sie schaute Nataly fragend an, die dann ihre Bereitschaft signalisierte. Sie folgten ihm zu den anderen Ilts, die mit großen Augen und wild schnüffelnd ihre Besucherinnen begutachteten.
»Na immerhin haben wir wohl jetzt ein paar Freunde gefunden«, meinte Nataly, als sich die ersten Mausbiber an sie anschmiegten. Kathy beobachtete die stampfend vorbeiziehenden Saurier und war in diesem Moment einfach nur ratlos. Es wurde langsam dunkel, die Sonne hing rot am Firmament.
Sie kramte ihre Schachtel Zigaretten aus der Jacke, zündete sich den Glimmstängel an und zog genüsslich daran. Plötzlich schwebte die Kippe aus ihrem Mund in Richtung des dicken Mausbibers.
»Hey, das ist meine!«
Der Mausbiber steckte sich die Zigarette in den Mund und zog daran. Dann fing er an zu husten und spuckte auf den Boden.
»Jetzt kannst du sie behalten«, sagte Kathy angeekelt. Zu ihrem Erstaunen nahm der Ilt einen zweiten Zug und guckte sie mit aufgequollenen, rot unterlaufenden Augen an. Dann fing er wild an zu kichern und zu gackern. Er hampelte herum, tanzte und rief immer wieder: »Hubi hui!«
»Ist der high?«, fragte Nataly erstaunt.
»Offenbar. Naja, der Tabak kann sicher auch eine berauschende Wirkung haben auf fremdartige Wesen. Oh je, …«
Sie schnappte sich die Kippe und trat sie aus. Der Dicke ließ sich auf den Hintern plumpsen und rülpste herzhaft.
»Scheint ja ein besonders kultiviertes Exemplar seiner Gattung zu sein«, scherzte Nataly. Dann fing der Ilt an, sich zu kratzen, grabbelte mit den Fingern in seinem Hinterteil herum und begann, sich in der Nähe seines Genitalbereichs sauber zu lecken, was beide Frauen mit einem angewiderten »ähhh« kommentierten.
Der Mausbiber schien das bemerkt zu haben und starrte die beiden verständnislos an.
»Versuchen wir es mal.«
»Was? Uns sauber …«
»Quatsch, wir versuchen, mit ihm zu sprechen, Nataly!«
Kathy deutete auf sich und sagte ihren Namen mehrmals. Dann zeigte sie auf Nataly und sagte ihren Namen.
Der Ilt sah sie an, als seien sie bescheuert. Aber nach einer Weile begriff er, stand auf und schlug sich auf die Brust.
»Kallkkhschieminidruns!«
»Häh?«, machte Nataly.
»Kallkkhschieminidruns!«, wiederholt der Ilt. Das war offenbar sein Name. Der war viel zu lang, fand Kathy.
»Wir nennen dich Kalky!«
»Klingt gut«, bestätigte Nataly.
Dann hoppelte der kleine, dickliche Ilt zu ihnen und deutete auf sich. Auch er hatte offenbar verstanden.
»Cutschimischidruff.«
Noch so einer mit einem komplizierten Namen.
»Du heißt ab sofort Cuty. Das passt auch, er ist ja so niedlich«, meinte Kathy und kraulte ihn vorsichtig. Der Kleine biss nicht zu, sondern schien die Streicheleinheit zu genießen.
Auf ein mal wurden die Ilts unruhig. Die Sonne war untergegangen. Sie rannten auf einmal weg oder teleportierten über kurze Distanzen. Wo wollten sie hin? Nataly und Kathy liefen ihnen hinterher, doch sie konnten kaum Schritt halten.
Plötzlich ertönte der Klang eines Horns. Jetzt begriff sie, dass sie nicht mehr allein waren. Aus dem Dunkel sah sie auf einmal Lichter. Gleiter schossen plötzlich über die Wiese. So schnell sie konnten, liefen die beiden Terranerinnen über den Hügel.
Die Mausbiber waren längst weg. Nataly packte Kathy und zog sie ins Gebüsch. Die Gleiter brausten an ihnen vorbei. Ein Gleiter hielt einige Meter von ihnen entfernt an. Drei Wesen, die am ehesten an terranische Schweine erinnerten, stiegen aus und stellten leuchtende Käfige auf den Boden. Das eine Schweinswesen aktivierte irgendetwas daran. Nach einigen Sekunden materialisierte dort ein Mausbiber.
»Parafallen«, wisperte Kathy. »Die jagen die Mausbiber!«
Der Vorgang wiederholte sich, und die Käfige waren nach einer Weile gefüllt. Insgesamt waren sieben Ilts dort gefangen, doch Kalky und Cuty waren nicht darunter, soweit sie es sehen konnte. Ein weiterer Gleiter fuhr auf. Er kam vom Berg mit dem Nebel. Zwei große, menschenähnliche Wesen stiegen aus. Doch ihre Körper waren verstümmelt, vernarbt. Sie sahen gruselig aus.
Das Schweinswesen begrüßte die beiden auf Rideryionisch mit »Herren«.
Kathy und Nataly beherrschten die Sprache inzwischen gut. Der Schweinsmann hielt einen Stock mit energetischer Spitze in einen der Käfige. Der Elektroschock ließ den betroffenen Ilt laut und schrill aufschreien.
Es war so grausam. Die Frauen mussten an sich halten, um nicht dazwischenzugehen.
Als der Ilt offenbar bewusstlos war, nahm das Schweinswesen ihn aus dem Käfig und gab ihm dem großen Menschen. Dieser schaute sich das Wesen an, dann verwandelte er sich plötzlich in eine grässliche Kreatur mit großem Maul und Zähnen und biss in den Ilt hinein. Er riss ihm die Gurgel heraus und aß von seinem Fleisch. Nataly wollte aufschreien, doch Kathy hielt die Hand vor ihren Mund.
Der Riese nahm ein Messer und schnitt den Biberschwanz ab. Er hing ihn sich als Trophäe an den Gürtel. Kathy wurde übel.
»Das Fleisch ist zart und das Fell weich. Sehr gute Ware. Wir nehmen alle.«
Das Schweinswesen freute sich und grunzte vergnügt. Es gab Anweisung, die Käfige auf den Gleiter der beiden Monster zu laden.
»Sagt dem Fürsten, es ist immer wieder eine Freude, für ihn zu arbeiten«, sprach das Schweinswesen und erhielt glänzendes Metall, offenbar Geld, als Preis von den beiden Wesen.
Nachdem alles eingeladen war, schwebten die Gleiter davon. Kathy hielt nur mit Mühe das Brechen zurück, während Nataly geschockt dasaß. Der arme tote Ilt! Und das Schicksal der anderen sechs war ebenfalls besiegelt. Wie konnte ein Wesen nur so grausam sein? In barbarischen Zeiten Terras hatte es auch Menschen gegeben, die Tiere oder Halbintelligenzen für Fleisch und Kleidung töteten. Diese barbarischen Zeiten waren aber seit Jahrtausenden vorbei.
Unter Mausbibern
Nach tagelangem Suchen in dem großen, dunklen Wald, zwischen Wiesen mit meterhohem Gras und allerlei ekligen Insekten hatten Kathy und Nataly endlich die Mausbiberherde wiedergefunden. Einige rannten weg, wagten es aber offenbar nicht zu teleportieren. Nur Kalky und Cuty verharrten an ihrem Platz und beäugten sie.
Zögernd gingen die beiden Terranerinnen näher, bis Cuty schließlich auf sie zu watschelte. Nataly nahm ihn behutsam auf den Arm und streichelte ihn.
Kathy knurrte langsam der Magen. Sie hatten nicht viel gegessen, waren vorsichtig gewesen, was die Natur im Wald angeboten hatte. Beeren hätten giftig sein können. Immerhin waren sie am Morgen nach der Jagd an einem Bauernhof vorbeigekommen. Auch dort lebten diese Schweinswesen. Die beiden hatten Obst und Wasser gestohlen, so viel sie tragen konnten. Doch der Vorrat war langsam verbraucht.
Sie deutete an, dass beide Hunger hatten. Kalky verstand offenbar als Erster und gab den Frauen einen Salatkopf und zwei Mohrrüben, die er aus einer kleinen Höhle geholt hatte. Dann deutete er an, sie sollten mitkommen. Sie erreichten ein kleines Waldstück und staunten nicht schlecht, als sie Hütten entdeckten. Hier lebten die Ilts offenbar! In einer Grube loderte ein Feuer, Guckys Artgenossen waren also nicht so primitiv, wie sie zuerst angenommen hatten.
Auf einem Spieß briet eine dicke Mausbiberfrau mit grauem Fell ein Stück Fleisch. Im Gegensatz zu Gucky waren die Ilts im Riff also nicht nur Vegetarier, aber wer mochte es ihnen verdenken, das Leben schien für sie hart zu sein.
Die beiden setzten sich an das Lagerfeuer. Kalky watschelte in eine große Hütte. Wenig später kam er mit einem dürren, ausgemergelten Mausbiber zurück, der Schmuck um den Hals trug. Vielleicht war dies eine Art Häuptling.
»Asha hasa schuhuschi?«, fragte der Ilt.
Kathy hatte natürlich keine Ahnung, was der damit meinte. Sie zuckte mit den Schultern und sagte ihren Namen. Sie würden wohl noch einen weiten Weg vor sich haben. Sie beschloss, den Mausbibern ihre Sprache zu lehren.
*
Liebster Aurec,
seit drei Wochen sind wir jetzt bei den Mausbibern. Sie haben mir einen Stift und Papier geschenkt. Vermutlich haben sie es von dem Bauernhof in der Nähe gestohlen.
Ich bin froh darüber, denn so kann ich Dir wenigstens schreiben, mein Liebster. Die drei Wochen waren auf gewisse Weise sogar schön. Obwohl wir in ständiger Angst leben, niemals mehr die DUNKELSTERN zu finden und von den seltsamen Schweinsmännern angegriffen zu werden, ist es schön bei den Ilts. Sie sind herzlich, verspielt, niedlich und machen sogar Fortschritte in der Sprache. Besonders Cuty und Kalky! Ich wünschte, Gucky könnte das mit ansehen.
Es sind bestimmt mehr als einhundert Mausbiber in dem Dorf im Wald. Sie besitzen wohl keine telepathischen Fähigkeiten, doch alle sind Telekineten und eine große Anzahl auch Teleporter.
Es ist schon wieder so lange her, dass wir uns gesehen haben. Und das für ganze zwei Tage nur! Es ist schrecklich. Zwei Tage in den letzten zwei Jahren! Ich bete, dass unsere Beziehung das aushält und Du Dir nicht eine Neue suchst wie diese alyskische Tussi!
Aber nein, ich habe Vertrauen zu Dir. Du wirst mich nicht hängenlassen, wirst Du doch nicht? Du liebst mich doch noch? Langsam fange ich an zu zweifeln, denn wir sehen uns ja nie. Ich mache jetzt lieber mit dem Sprachunterricht für die Mausbiber weiter.
In Liebe, Deine Kathy!
*
Kathy versuchte, die Selbstzweifel, die seit Wochen an ihr nagten, zu vergessen, doch immer wieder fragte sie sich, ob Aurec nicht besser ohne sie dran wäre. Er brauchte Liebe, und wenn sie ständig von ihm getrennt war, konnte sie ihm keine geben.
Sie blickte zu Nataly.
»Wieso schreibst du eigentlich nie Briefe an Jonathan?«, wunderte sie sich.
Nataly zündete sich eine Zigarette an und zog genüsslich daran.
»Weil ich ihn nicht mehr liebe, fürchte ich.«
»Was?«
Kathy war wie vor den Kopf gestoßen. Nataly liebte Jonathan nicht mehr? Niemals! Sie hatte doch über die Jahre hinweg immer wieder ihre ewige Liebe und Treue zu ihm betont.
»Wir sind seit knapp elf Jahren zusammen und irgendwie ist die Luft raus bei mir. Ich habe es gemerkt, als ich ihn auf SOLARIS STATION wiedergesehen habe. Und es ist mir hier im Riff endgültig klargeworden. Ich liebe ihn nicht mehr.«
»Aber die Gefühle können doch nicht einfach weg sein? Ihr habt so viel durchgemacht, ihr seid verheiratet. Ich …«
Kathy war sprachlos. Zwar hatte Nataly in der letzten Zeit immer wieder komische Andeutungen gemacht, aber das war doch seltsam. Sie verstand es nicht! Für Kathy war es das höchste Ziel, Aurec wiederzusehen. Der Gedanke gab ihr Kraft und ließ sie die ganze Hölle hier ertragen. Aber welche Ziele hatte ihre Freundin?
Nataly schien ihren zweifelnden Blick richtig zu interpretieren.
»Ich bin eine unabhängige, selbstbewusste Frau geworden. Das abenteuerliche Leben macht mir Spaß. Es zeigt mir, dass ich selbst einiges drauf habe. Männer brauche ich dazu nicht mehr. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich vermisse Jonathan nicht. Er fehlt mir nicht mehr. Es klingt hart, aber so ist es nun einmal.«
»So ist es nun mal? Nein, das ist mir zu schwammig! Da stimmt etwas nicht. Hast du einen anderen? Oh nein, doch nicht etwa Danton?«
»Nein, Quatsch!«
»Was ist es dann? Du bist früher deinem Ehemann sogar zum SONNENHAMMER gefolgt.«
»Die Zeiten ändern sich, Kathy, oder nicht? Damals warst du eine Verräterin!«
Sie fühlte sich jetzt angegriffen. Wieso spielte Nataly wieder darauf an. Sie dachte, sie hätte ihr das längst verziehen.
»Es ist nicht Danton, sondern Roland. Wir hatten etwas Spaß. Eine Beziehung mit ihm will ich aber nicht. Wie gesagt, ich bin unabhängig.«
Eine Affäre mit Roland Meyers? Kathy brauchte erst einmal eine Weile, um das alles zu verdauen. Sie dachte an Jonathan! Wie würde er es wohl aufnehmen? Bestimmt nicht gut. Was würde sie machen, wenn ihr Aurec gestehen würde, er liebe sie nicht mehr?
Sie würde durchdrehen, sterben wollen.
Nataly hatte doch alles Glück der Welt. Und sie warf es nun einfach weg und konnte es nicht einmal richtig erklären.
»Wer weiß übrigens, ob wir jemals wieder zurückkehren. Morgen könnte der letzte Tag sein. Daran sollte man denken, damit man mehr vom Heute hat.«
Sie stand auf und ging in den Wald. Kathy blickte ihr traurig hinterher. Nataly hatte sich verändert. Die zwei Jahre des Krieges waren nicht spurlos an ihr vorbeigegangen und hatten offenbar, nein wohl definitiv, ihre Ehe mit Jonathan zerstört.
Sie seufzte und wandte sich wieder an Cuty, der sie erwartungsvoll anstarrte.
»Guten Morgen, Cuty!«
»Gutzen Morjen, Kathy. Weia gehtsen dir des?«
Der Ilt kicherte. Kathy war gar nicht zum Lachen zumute. Sie dachte an Aurec und fing an zu weinen. Schnell wischte sie sich die Tränen vom Gesicht, doch Cuty hatte es längst bemerkt. Er setzte sich auf ihren Schoß und umarmte sie.
»Kathy traurig?«
Sie nickte nur.
»Hab Kathy lieb. Nixa traurig tun. Cuty haben Kathy lieb.«
Sie erwiderte die Umarmung und drückte ihn fest an sich.
»Cuty jetzt nixa Luft bekomme …«
»Ups!«
Sie ließ ihn wieder los und lachte verlegen. Das wollte sie natürlich auch nicht. Sie war heute wohl etwas durch den Wind.
»Moin! Mann, ist das wieder ein beschissener Morgen! Na Cuty, hast du wieder Kacka auf Schwanz gemacht?«
Kathy starrte Kalky entsetzt an, der gerade aus der Hütte auf sie zu watschelte und seinen Allerwertesten kratzte. Er lernte wirklich sehr schnell. Insbesondere verstand er es gut, sich die Kraftausdrücke, die Nataly und ihr manchmal rausrutschten, zu merken.
»Ach ja! Was lernen wir heute? Wie ihr Terranerinnen nackt ausseht? Das würde mich biologisch sehr interessieren. Hast du auch irgendwo ein Fell?«
Beinahe hätte Kathy ihm geantwortet, doch es wurde ihr zu bunt. Kalky war gnadenlos frech und hatte manchmal eine ziemlich ekelhafte Art an sich. Vielleicht tat er das aber auch nur, um sie zu provozieren.
Häuptling Antzschiwuschdrug hielt indes seine morgendliche Ansprache an sein Volk. Kalky verdrehte die Augen.
»Der Alte labert wieder seinen üblichen Stuss zusammen. Du hast nicht noch so eine Zigallnette oder wie das Ding heißt, was raucht und mich so glücklich macht?«
»Nein, mein kleiner, dicker Kiffer! Alle Zigaretten weg. Und erinnere mich nicht daran, ich krieg nämlich Entzugserscheinungen!«
Heute war wirklich ein furchtbarer Tag für Kathy. Nataly wirkte auch nicht sonderlich gutgelaunt, aber eigentlich sah sie so jeden Morgen aus. Augenränder, zerzaustes Haar und ein Blick, der ganze Legionen hätte töten können.
»Fertig geschrieben?«, fragte Kathy provozierend.
»Ja«, kam die knappe Antwort.
»Erzuhlst die uns von Gucky! Renner des Uttiversums?«, fragte Cuty mit seinem gebrochenem Interkosmo.
»Der heißt Retter des Universums. Kapierst du denn gar nichts?«
Kalky sah seinen kleinen Bruder böse an.
»Röttel des Fuffiverdums?«
»Ich gebs auf. Erzählt mir lieber von diesem Getränk, dass auch so eine Wirkung hat wie eine Zigarette. Vurguzz!«
Kalkys Augen leuchteten. Es war erstaunlich, welches Interesse er an den Rauschmitteln zeigte. Kathy seufzte. Leider hatte ihr Sprachunterricht zwar zur Verbesserung der Kommunikation beigetragen, doch wie sich herausstellte, war Cuty nicht in der Lage, die beiden zurück zur DUNKELSTERN zu teleportieren. Er war nur zufällig auf die DUNKELSTERN geraten und beherrschte die Teleportation noch nicht sehr präzise. Cuty war im Maßstab der Mausbiber noch ein Kleinkind. Kalky war der älteste Bruder von 21 Geschwistern. Cuty war das Nesthäkchen.
Die Ilts lebten in den Wäldern, in Höhlen und auf den Weiden. Sie ernährten sich hauptsächlich von Wurzeln, Salaten und Früchten, aßen aber auch Fleisch. Zumeist aber eher Aas, welches sie kochten. Die Mausbiber waren keine ausgesprochenen Jäger, obwohl sie als Telekineten und Teleporter leicht dazu in der Lage waren, aber offenbar verfügten sie doch über eine gewisse Ethik und töteten wohl nur sehr selten und wenn auch nur, wenn sie wirklich Hunger hatten.
Sie lebten isoliert in den Wäldern und erzählten, dass es so seit Anbeginn der Zeit war. Die »Großen Fremden« kümmerten sie herzlich wenig, doch sie wussten, dass die Großen Jagd auf sie machten. Es gab noch andere Mausbiberstämme, doch viele waren inzwischen ausgerottet.
Die Weiden waren immer unsicherer geworden, doch wo immer sie auch hinzogen, die Großen folgten ihnen. Kathy vermutete, dass die Entfernung, in der die Mausbiber rechneten, nicht groß war. Da die Schweinswesen und ihre Auftraggeber über Parafallen und Gleiter verfügten, besaßen sie einen soliden technischen Standard. Damit konnten sie vermutlich Mausbiber schnell lokalisieren.
Die Ilts schwebten in großer Gefahr und wurden wahrscheinlich nur in Ruhe gelassen, damit sie sich natürlich vermehrten und so die Population konstant blieb.
Doch Kathy vermutete, dass das Volk der Mausbiber auch hier zu einer bedrohten Art gehörte. Die Ilts glaubten, dass sie im Wald sicher waren, doch Kathy bezweifelte das. Sicher konnte man die Ilts auch hier orten. Man ließ sie nur in Ruhe, bis wieder Bedarf an ihrem Fleisch und Fell war.
»Hör zu, Kalky! Ohne Technik sind wir hier aufgeschmissen. Wir können nicht bis an unser Lebensende hier versauern«, meinte Nataly. »Wir müssen etwas unternehmen.«
»Huschi schöny hyri!«, brüllte der Stammesälteste plötzlich.
»Was?«, fragte Kathy.
»Unser Opa meint, dass es hier doch schön ist und wieso ihr weg wollt«, übersetzte Kalky.
»Weil wir auch Familie haben, dort oben in den Sternen. Und da wollen wir wieder hin!«, erklärte Kathy.
Kalky stand auf.
»Und ich helfe euch dabei. Eure Welt klingt interessant! Diesen Gucky will ich mal kennenlernen.«
Kathy lachte überrascht auf. Ausgerechnet Kalky bot ihnen Hilfe an? Dabei hatte sie selten so einen Egozentriker kennengelernt, aber offenbar pochte tief unter seiner Speckschicht doch ein gutes Herz.
»Also gut. Wir haben nur eine Chance, die DUNKELSTERN zu finden, wenn wir an Technik herankommen. Wir müssen also welche suchen«, meinte Kathy.
»Dann werden wir eine Expedition starten. Viele Fußmärsche oder wenige Teleportationen in Richtung der ewig scheinenden Sonne sind Städte mit Türmen aus leuchtendem Stoff. Dort werden wir sicherlich etwas finden, nur …«
»Was denn, Kalky?«, wollte Nataly wissen.
»Wir müssen durch das Gebiet der Husaaven, die ihr als Schweinsmänner bezeichnet. Und diesen gefährlichen Weg müssen wir zu Fuß bestreiten, da ich mich nicht traue zu teleportieren. Ihre Fallen … nun ja, ich möchte in keinem solchen Käfig landen.«
Das verstand Kathy nur zu gut. Sie war dem Ilt dankbar, dass er sie begleiten wollte. Leider fanden sich keine anderen Freiwilligen für die Mission, was Kalky sichtlich schockierte. Er sprach davon, dass sie zu der leuchtenden Stadt wohl Monate unterwegs sein würden. Doch das war besser als Monate des Nichtstuns.
Thol2777
Nach einer Reise von acht Tagen hatten die DUNKELSTERN und VIPER endlich Thol2777 erreicht, jenen Mond der Piraten, Gesetzlosen und Mafiosi. Keine schöne Gegend, doch die Persyallianz hatte die Mittel, um die DUNKELSTERN wieder herrichten zu lassen.
Fyntross und seine Piraten hatten sich in diesen Tagen sehr zurückgehalten. Der Fischkopf kooperierte sogar. Auch Pyla und Jock fügten sich gut in das Geschehen ein, wobei die Blondine sowohl Meyers als auch Jock den Kopf bereits verdreht hatte. Gut, dass er über so etwas erhaben war.
Nun blieb Roi nichts anderes übrig, als abzuwarten, auch wenn ihn der Gedanke an Kathy und Nataly beunruhigte. Es würde eine Weile dauern, bis die DUNKELSTERN wieder einsatzbereit war. Und dann war da noch die Frage, ob Fyntross überhaupt Wort hielt. Vielleicht war die Aussicht auf ein modernes Raumschiff für seine Beutezüge wirklich ausreichend, um sein Versprechen zu halten? Nein! Roi bezweifelte dies, doch er hatte Vorkehrungen getroffen.
Seine Gedanken galten Kathy Scolar und Nataly Andrews. Wo waren sie? Lebten sie überhaupt noch?
*
Etwas irritiert betrachtete Roi Danton seinen Ersten Offizier Roland Meyers und die Rideryonin Pyla, die ihm gegenüber saßen und kichernd kuschelten. Meyers hatte deutlich zu viel Tholrum getrunken. Seine Haare waren zerzaust und die Augen rot unterlaufen.
Pyla war wie immer, seit sie an Bord war: Sie wirkte, als hätte sie ein Fass Vurguzz getrunken. Aber so war sie oftmals auch, wenn sie nüchtern war. Nicht ganz so extrem, aber doch unverkennbar sie selbst.
Tja, viel hatten sie auch nicht zu tun, außer herumzusitzen und zu trinken. Sie hatten wenig Einfluss auf die Reparatur der DUNKELSTERN. Seit Wochen dümpelten sie in den Kneipen herum. Roi empfand die Warterei als schrecklich langweilig. Nicht einmal mit Pyla konnte er sich vergnügen, da sie offenbar einen Narren an Roland Meyers gefressen hatte. Der smarte Ex-Quarteriale ließ auch nichts anbrennen. Erst Nataly, nun Pyla und sicherlich hatte er mit Maya ki Toushi auch nicht nur Schach gespielt.
Rois Ego war etwas angeschlagen. Nicht, dass er eifersüchtig war, doch irgendwie geknickt. Doch er ließ es sich nicht anmerken – dachte er zumindest, denn plötzlich fragte Pyla säuselnd: »Was ist denn los mit dir?«
Danton war nicht danach, mit ihr zu reden. Er erhob sich, machte eine knappe Verbeugung und ging. Pyla ließ nicht locker. Sie folgte ihm durch die stickige Kneipe.
»Hey, lass uns tanzen!«
Sie kicherte. Roi verdrehte nur die Augen. Wieso hatte er diese Frau eigentlich mitgenommen? War es purer Egoismus gewesen? Hatte er sich die Chance auf etwas Abwechslung erhalten wollen? Oder war ihm wirklich daran gelegen, ihren Wunsch, zu den Sternen zu reisen, wahr werden zu lassen? Er wusste es nicht, aber aus ungeklärten Gründen machte es ihn wütend, sie mit Meyers zu sehen. Dieser Typ war Roi langsam nicht mehr geheuer und wurde ihm Schritt für Schritt unsympathischer. Danton hatte wenig Zeit mit Jonathan Andrews und dessen Meister Gal’Arn verbracht, doch er wusste, dass der Terraner ein feiner Kerl war und sicher so etwas nicht verdiente.
Wieso mussten selbst seine Besatzungsmitglieder noch so schlecht sein? Terraner sollten Werte haben!
Enttäuscht nahm Roi einen großen Zug aus der Schnapsflasche. Sein Papa hatte es doch versucht! Sicher konnte er generell die Spezies Mensch immer wieder vorantreiben, aber es kam doch auch ebenso beständig zu Rückschlägen.
Das Quarterium war der jüngste Beweis dafür. Roi seufzte. Und was tat er dagegen? Saß in einer Kneipe und soff Schnaps. Nun, immerhin war es ihm gelungen, das Riff näher zu erforschen, erste Verbündete zu gewinnen – und leider drei Leute seiner Crew zu verlieren.
Er machte sich Vorwürfe! Was war, wenn Kathy und Nataly nun schon tot wären? Seit Wochen waren sie verschwunden und er hatte keine Möglichkeit, nach ihnen zu suchen. Ohne Raumschiff war das nicht möglich. Er besaß kein Geld, um ein weiteres zu heuern, und Fyntross wollte ihm nicht helfen.
Der Fischkopf wartete wahrscheinlich nur, bis sich die richtige Gelegenheit für ihn bot, Roi den Hals abzuschneiden und sowohl die DUNKELSTERN als auch das Abbild der Ajinah abzunehmen. Doch er wäre nicht Roi Danton, König der Freihändler, wenn er nicht einen Plan B in der Tasche hätte.
Pyla hatte sich inzwischen wieder Meyers gekrallt, der auch willig mit ihr durch die Gegend hüpfte. Plötzlich verstummte die Musik. Die Wesen machten Platz für Kapitän Fyntross, Mumdök und ein fettes humanoides Schweinswesen, welches Danton unwirsch angrunzte.
»Ich nehme nicht an, dass das unser Abendbrot ist?«
»Setzt euch«, forderte Fyntross einigermaßen höflich. »Das ist Tscherko, Lord der Husaaven, einem Volk auf dem Rideryon.«
»Einem mächtigen Volk! Wir handeln sogar mit den Ylors«, erklärte Tscherko stolz.
Roi war über diese Information wenig erfreut. Das Misstrauen gegenüber dem Husaaven wuchs. Pyla schwankte zu ihnen und setzte sich grinsend neben Danton.
Tscherko grunzte abfällig.
»Eine Buuralerin! Wir schätzen dieses Pack nicht.«
Fyntross lachte.
»Das ist das Bordmädchen der DUNKELSTERN. Mit ihren Diensten hält sie die Crew bei Laune.«
»Gar nicht«, mischte sich Pyla ein. »Hat jemand eine Zigarette für mich? Ich bezahle auch.«
Nun lachte Tscherko.
»Womit?«
Das wurde Roi jetzt zu bunt.
»Messieurs et madame, wie kann uns diese wandelnde Leberwurst weiterhelfen?«
Natürlich wusste keiner etwas mit dem Begriff Leberwurst anzufangen. Fyntross schaltete jedoch am schnellsten.
»Tscherko soll einen erneuten Kontakt mit Medvecâ herstellen. Wir wollen immer noch das Bildnis der Ajinah loswerden.«
Pyla versuchte derweil ein Kartenhaus aus Bierdeckeln zu bauen. Vergeblich jedoch.
Roi half ihr, doch auch er scheiterte. Konzentriert half er der Buuralerin, die ersten Karten wieder aufzustellen, doch als sie die zweite Etage baute, brach alles wieder zusammen. Mit innerer Genugtuung registrierte Roi, dass sein offensichtliches Desinteresse zu Unbehagen bei seinen Gegenübern führte.
Nach einigen Minuten der Stille fragte Danton schließlich: »Mit was handeln Sie eigentlich mit den Ylors?«
»Tiere! Die Ylors schätzen das Fleisch und das Fell der Springbiber.«
Danton wurde hellhörig. »Springbiber?«
»Ja! Sie können sich schneller als andere bewegen«, erklärte Tscherko bedeutungsvoll. Er lehnte sich über den Tisch, was ihm bei seiner Figur jedoch schwerfiel. »Sie sind Teleporter.«
»Teleporter?«
»Aye!«, bestätigte Tscherko und starrte Danton aus seinen Schweinsaugen ehrfürchtig an. Er schien Respekt vor den Springbibern zu haben. Offenbar gab es keine parapsychologisch begabten Wesen außer ihnen auf dem Riff. Auf der anderen Seite war ihm der Begriff der Teleportation bekannt.
Für Roi bedeutete dies endlich eine Spur! Gut möglich, dass einer dieser Springbiber Kathy und Nataly entführt hatte.
»Ich will noch ein Bier!«, mischte sich Pyla ein und grinste seltsam. »Und ich will tanzen.«
»Kann dieses Weibsbild nicht einmal die Klappe halten? Ich schlitze ihr gleich die Kehle durch«, blubberte Fyntross ungehalten. Immerhin reichte das, damit Pyla kurzzeitig ihren Mund hielt. Doch nicht für lange. Sie streckte Fyntross die Zunge raus und erwiderte: »Das wird Roilein nicht zulassen. Wenn du mich töten willst, musst du erst an ihm vorbei!«
»Wie?«, fragte Roi entsetzt, während Fyntross vielsagend grinste. Danton wechselte schnell das Thema.
»Wo finden wir diese Springbiber. Ich habe Interesse an ihnen.«
»Wieso?«, wollte Tscherko wissen.
»Weil zwei seiner Besatzungsmitglieder von einem Springbiber entführt wurden«, nahm Fyntross vorweg.
»Aber du kennst doch die Region der Springbiber, Fyntross.«
»Tatsächlich?«, fragte Danton irritiert.
Fyntross stieß einen gleichgültigen Laut aus.
»Du hast mich nicht gefragt, Terraner!«
Kaum zu glauben! Hätte Fyntross ihnen die Koordinaten der Heimat der Springbiber gegeben, wären Kathy und Nataly vielleicht schon längst in Sicherheit. Eines war jedoch gewiss. Dem Fischartigen war nicht zu trauen. Das bestärkte Roi in seinem Vorhaben.
»Und selbst wenn. Zwei schwache Frauen würden im Wald oder auf den Steppen nicht lange überleben. Die Ylors jagen in diesem Gebiet. Und wenn sie einem Husaaven in die Hände gefallen sind, sind sie vermutlich zu Futter verarbeitet worden«, erklärte Tscherko gleichgültig.
»Wie gemein!«, meinte Pyla geistreich.
Roi hatte genug. Er zog seinen Strahler und richtete ihn auf Tscherko.
»Nun, dann wirst du deine Kontakte spielen lassen, sonst werde ich dich zu Futter verarbeiten. Hier ist der Deal. Ihr bekommt das Abbild von Ajinah kostenlos, doch dazu müsst ihr mir helfen, Kathy und Nataly lebend zurückzubekommen. Sollten sie Geiseln der Ylors sein, werden wir das Bildnis als Tausch anbieten.«
»Niemals«, mischte sich Mumdök ein. »Das ist viel zu wertvoll.«
Roi richtete den Strahler nun auf den Persy, der augenblicklich anfing zu zittern.
»Das Leben eines Individuums ist immer mehr wert als tote Materie, mein schwabbeliger Freund.«
»Ist das so?«, fragte Fyntross, zog seinen Energiestrahler und richtete ihn auf Pyla, die entsetzt aufgluckste.
»Dann übergib uns sofort das Abbild oder ich töte deine kleine Freundin.«
»Dann töte ich dich«, erwiderte Danton und zielte auf Fyntross. Dieser lachte verlegen.
»Ein Patt. Nun gut. Ich halte Dantons Vorschlag für annehmbar. Lassen wir ihn nach den beiden Terranerinnen suchen und Tscherko wird mit Medvecâ verhandeln.«
Fyntross senkte die Waffe.
»Also gut. Wir brechen auf, sobald die DUNKELSTERN einsatzbereit ist«, schloss Mumdök die Besprechung. Danton stimmte zu, nahm Pyla bei der Hand und verließ die illustre Kneipe.
»Meinst du, wir finden Kathy und die zickige Frau?«
»Die zickige Frau und du haben immerhin eines gemeinsam: Meyers!«
»Ich bin nicht so eine!«
»Natürlich nicht.«
Er wollte darüber nicht diskutieren. Er musste nachdenken und brauchte die Koordinaten von Tscherko vor dem Abflug. Weder Fyntross noch irgendjemand anderes von den Piraten durfte an Bord der DUNKELSTERN. Im Moment wurde sie gut von Dantons Leuten bewacht, doch er war sich gewiss, dass Fyntross die erste Gelegenheit nutzen würde, ihm in den Rücken zu fallen.
Er sah zu Pyla.
»Die nächsten Tage oder gar Wochen werden sehr gefährlich werden. Bist du sicher, dass du das durchstehst?«
Sie versuchte zu salutieren.
»Ja, Monsieur!«
Dann kicherte sie los.
Er atmete tief durch. Er teilte ihren Optimismus nicht.
Piratenspiele
Ein guter Kommandant erkannte die Fähigkeiten seiner Besatzungsmitglieder, so verborgen und unterschiedlich sie auch waren.
Nach weiteren zwei Wochen des endlosen Wartens war die DUNKELSTERN einsatzbereit und auch die VIPER war von Sato Ambush und Roland Meyers teilweise repariert worden.
Zumindest so sehr, wie es Roi Danton für nötig hielt. Die Zeit des Aufbruchs vom Tholmond2777, dem Piratenmond, stand kurz bevor. Und jetzt wurde es gefährlich. Jeder lauerte nur darauf, ihm den Kopf abzuhacken, seine Crew zu erschießen und die DUNKELSTERN mitsamt dem Bildnis von Ajinah in Beschlag zu nehmen. Meyers und Sato bewachten das Schiff streng und hatten alles nach Trojanern untersucht. In der Tat hatte Ambush einige plumpe Fallen im Computersystem entdeckt. Fyntross tickte zu seinem Erstaunen ähnlich wie er selbst.
Roi hatte aber noch ein oder zwei geheime Waffen in petto. Es war der Vorabend des Aufbruchs. Mumdök hatte zu einer Abschiedsfeier in der Residenz des verstorbenen Bullfah eingeladen.
Danton hatte nur eine Begleitung gewählt. Jemand, der ihm am geeignetsten für seinen Plan erschien.
»Bist du bereit, Schätzchen?«
Pyla hüpfte aus ihrer Kabine, wo sie sich zurechtgemacht hatte. Naja, eigentlich nicht wirklich. Ihr Haar war locker zusammengebunden, sie trug eher schlichte Kleidung und war nicht so aufreizend gekleidet, wie es bei Kathy Scolar oft der Fall war. Die Gute! Er vermisste sie. Aber vielleicht würde er sie ja bald schon finden.
Meyers und Ambush sahen ihn skeptisch an.
»Sicher, dass nicht lieber ich mitkommen soll, falls es Schwierigkeiten gibt?«, wollte Meyers wissen.
»Mon ami, Pyla ist genau die Richtige. Keine Sorge. Haltet ihr die DUNKELSTERN startklar.«
Er ließ Pyla einhaken und verließ mit ihr die DUNKELSTERN. Den Weg zu Bullfahs Palast legten sie zu Fuß zurück, obgleich die Tochter des Bürgermeisters immer wieder jammerte, es sei ihr zu weit. Wie verweichlicht diese Menschen von heute waren! Er war früher zu weitaus schlechterem Wetter durch die Gegend marschiert. Schneestürme wie auch Sturm und Eisregen hatten ihn nicht aufgehalten, wie er wortreich erklärte.
»Und was soll ich nochmal auf dieser wichtigen Mission machen?«, wollte Pyla wissen.
»Sei einfach du selbst. Feier und trink so gut, wie es geht.«
Zu heiterer Musik wurden die beiden in den Palast gelassen. Er registrierte, dass nur Mumdök und Fyntross sowie Tscherko anwesend waren. Vermutlich befanden sich Krash und seine Leute bereits auf der VIPER oder bereiteten einen Angriff auf die DUNKELSTERN vor. Sie setzten sich hin.
Mumdök hob ein vollgeschleimtes Glas in die Höhe.
»Auf unser Bündnis. Eine Allianz fürs Leben!«
Danton fand diesen Spruch schon immer doof, aber er erhob sein Glas und es ging los.
*
Noch Stunden später saßen sie im Palast und zechten ausgelassen. Roi war schon recht übel, doch dank seines Zellaktivators vertrug er mehr als die anderen. Aber eine war noch trinkfester: Pyla! Sie leerte ein Glas nach dem anderen, und auch Fyntross hielt mit. Sie hatte ihn am ganzen Abend geneckt und offenbar bei der Ehre erwischt. Ein Dorfmädchen durfte doch keinen Piratenkapitän unter den Tisch trinken.
Pyla fing an zu singen und Fyntross stimmte ein. Er war schon recht angeschlagen. Pyla nahm eine neue Flasche und flößte sie dem Fischkopf ein, der es bereitwillig mit sich geschehen ließ.
»Lustige Fete, nicht Schweinebacke?«
Roi stieß Tscherko an. Der Husaave erbrach sich auf seinen Oberkörper und Bauch. Angewidert wandte sich Roi schnell ab. Aber schon mal einer weniger.
Mumdök glotzte Pyla lüstern an. Wieso standen eigentlich fette Molluskenwesen immer auf menschliche Weibchen?
»Komm her, Kleines und kraule meinen Bauch!«
Fyntross hielt Pyla an der Taille fest.
»Nein, sie ist meine Trinkkumpanin. Komm, flöße mir noch mehr von dem Rum ein.«
Pyla blickte Roi hilfesuchend an. Der bedeutete ihr, ruhig weiterzumachen, obwohl es zugegeben recht unfair von ihm war. Das war selbst für sie etwas zu ekelhaft. Sie gab Fyntross wie einem Baby die Flasche, bis er nach hinten kippte und liegenblieb. Mumdök wabbelte wie ein Wackelpudding zur Musik und forderte Pyla auf, für ihn zu tanzen.
Plötzlich stand Fyntross auf und zog seinen Säbel. Dabei warf er ihn an die Decke. Er packte Pyla an ihren langen, blonden Haaren und zog sie zu sich.
»Ich habe deinen Plan durchschaut, Danton! Du wolltest uns abfüllen und dann verschwinden.«
»Nicht doch …«
Mumdök rappelte sich auf und griff mit seinen Tentakeln nach Pyla und Fyntross.
»Ich will sie haben«, gellte der Persy und zog beide herunter. Er drückte die schreiende Pyla und Fyntross an seinen Bauch. Mühsam befreite sich der Kapitän, doch da zerschlug Roi bereits eine Flasche an dessen Kopf. Diesmal war der Fischkopf wirklich ausgeschaltet.
Pyla schrie und strampelte, während sich immer mehr grüngelber Schleim über sie ergoss. Das war in der Tat widerwärtig. Er würde ihr ja gern aus dieser misslichen Lage helfen, doch irgendwie wollte er sie jetzt nicht mehr berühren.
Also zog er den Strahler und paralysierte Mumdök. Der Schleimbolzen verharrte in seinen Bewegungen. Pyla schaffte es aus eigener Kraft, sich zu befreien und schüttelte sich vor Ekel.
»So ungefähr fühlte ich mich, als du mich mit dem Schnaps bespuckt hast«, erklärte Roi und gab ihr die Tischdecke, um sich einigermaßen zu säubern.
»Mir ist schlecht. Zu viel Alkohol und Schleim. Ich …« Pyla schwankte und knickte ein. Offenbar war das alles doch zu viel – dabei hatte sie Rois Plan erfüllt und die meisten hier abgefüllt oder zumindest arg geschwächt. Er hatte sich ihre Fähigkeit als gute Trinkerin zunutze gemacht. Seine Bescheidenheit verbot ihm, sich noch weiter zu loben.
Doch nun stand er vor einem Problem. Pyla war k.o.! Ihm blieb also nichts anderes übrig, als sie sich über die Schulter zu legen und sich auch einzusauen.
Das hatte er in seinem Plan nicht bedacht. Während er ächzend mit Pyla auf der Schulter aus dem Palast ging und unbemerkt an den Wachen vorbei schlich, informierte er Ambush, die DUNKELSTERN zu starten.
Noch rechtzeitig kamen er und Pyla an. Er warf sie auf einen Sessel in der Kommandozentrale. Meyers stieß ihn wütend an.
»Was haben Sie mit ihr gemacht, Danton?«
»Sie hat tapfer getrunken und sich einschleimen lassen. Jetzt muss sie etwas schlafen. An die Maschinen, Meyers! Das ist ein Befehl!«
Roi klang sehr ernst. Ihm ging Meyers mit seiner Art langsam auf die Nerven! Der Angesprochene nickte und eilte an die Kontrollen. Die DUNKELSTERN hob ab.
»Sato-San! Darf ich bitten?«
Sato machte eine kurze Verbeugung. Dann aktivierte er den kleinen Virus auf der VIPER, der sämtliche Datenbanken auf dem Raumschiff löschte. Während der Reparaturen hatte Sato Ambush diesen Virus in der Syntronik installiert. Die Speichermedien wurden neu formatiert und waren anschließend leer. Fyntross konnte ohne die Syntronik nichts mit der VIPER anfangen.
Danton war mit seiner Aktion zufrieden.
Die DUNKELSTERN verließ den Orbit von Thol2777 und steuerte auf das Rideryon zu. Roi hatte die Koordinaten vom Reich der Husaaven. Dort lebten auch die sogenannten Springbiber. Sie galt es zu finden, denn sie führten ihn hoffentlich zu Kathy und Nataly!
Ende
Roi Danton, Sato Ambush und Roland Meyers sind auf dem Weg zum Rideryon, wo Kathy Scolar und Nataly Andrews verschollen sind. Nils Hirseland schildert im nächsten Heft die weiteren Abenteuer Roi Dantons und seiner Gefährten. Dabei erfahren sie auch weitere Einzelheiten zur Geschichte der Ylors und ihres Fürsten
Medvecâ
DORGON-Kommentar
Roi Danton und seine Getreuen erfahren mehr über das Riff, aber jede Antwort wirft zwei neue Fragen auf.
Nach wie vor ist das Riff, seine Funktion und sein Zweck ein einziges großes Fragezeichen. Bedenklich scheint mir dabei, dass Roi anscheinend seinen Blick für das große Ganze und aus verständlicher Sympathie für das individuelle Schicksal das Misstrauen gegenüber den Zielen des Riffs als Gesamtheit verliert. Ich befürchte fast, dass die Terraner das noch bitter bereuen werden.
Interessant ist auch, dass es auf dem Riff anscheinend Ilts gibt, wobei natürlich noch niemand weiß, wie diese dorthin gekommen sind und wie sie in die bisher bekannte Geschichte von Guckys Artgenossen passen.
Jürgen Freier
GLOSSAR
Pyla
Alter: ca. 20 Jahre
Herkunft: Land Buural, Riff
Größe: 1,75 Meter
Gewicht: ca. 60 Kilogramm
Haarfarbe: blond
Augenfarbe: blond
Pyla ist die Tochter des Bürgermeisters Hurtel, der das Dorf im Niemandsland zwischen dem Reich Buural, den Husaaven und den Ylors regiert. Sie ist rein biologisch gesehen eine Buuralerin und entspricht einem Menschen. Auf Terra würde man sie als »Partygirl« bezeichnen, denn sie feiert ausschweifend mit der Dorfjugend und gräbt am ersten Tag gleich Roi Danton an. Und sie will zu den Sternen reisen.
Pyla ist eine widersprüchliche Frau. Einerseits eher einfältig und nur auf Spaß ausgelegt, träumt sie auf der anderen Seite davon, Heldentaten zu vollbringen und anderen zu helfen.
Harekuul
Die Harekuul (der Harekuul, die Harekuula) sind Zentauren, die eine vorherrschende Rolle auf dem Riff spielen. Sie werden bis zu zwei Meter groß und gelten als besonders tapfere Krieger und loyale Gefolgsleute. Harekuul leben auf dem Riff selbst und auf den Tholmonden. Jene, die nicht in den Diensten der Hohepriesterschaft des Riffs stehen, arbeiten als Söldner für kriminelle Organisationen wie die Riffpiraten und semimafiöse Gesellschaften wie die Persyallianz.
Dychoo
Die kopflosen Dychoo sind Bewohner des Riffs. Ihr massiger Körper ruht auf stämmigen Beinen. Die Hautfarbe ist gelb, rotorange pigmentiert. Die Dychoo haben keinen Kopf. Ihr »Gesicht« ruht auf dem Torso. Die Augen gleichen terranischen weiblichen Brüsten. Einen Mund besitzt diese Rasse nicht. Sie verständigen sich ausschließlich telepathisch.
Dychoo sind sehr intelligent, sie werden oft als Lehrer, Navigatoren oder Taktiker/Strategen eingesetzt.
Das Dorf
Das Dorf ist eine Siedlung im Riff. Es liegt im Westen des Riffs zwischen dem Reich Buural, der Dunkelzone der Ylors und den Husaaven. Es ist sehr abgelegen, was mit Absicht so gewählt wurde. Vor Jahrzehnten sind 200 Buuraler aus ihrem Reich ausgesiedelt, um so zu leben. Die Population liegt inzwischen bei 312 Buuralern.
Im Sommer und Herbst des Jahres 1307 NGZ wird das Dorf von Roi Danton, Sato Ambush und Kathy Scolar aufgesucht, um mit den Bewohnern Handel zu treiben.
Ältestenrat
Bürgermeister: Hurtel
Arzt: Doktor Brinkel
Polizist: Hynrich
Schmied: Jork
Fischer: Krydemann
Postmann: Lytga
Feuerwehrmann: Kulle
Glaubenshüter: Spruggel
Bauer: Kroll
Wirt: Pelzrak
Mehr über die Dorfbewohner
Die Familie von Bürgermeister Hurtel besteht aus dem Vater selbst und seinen beiden Töchtern Carah und Pyla. Ihre Mutter starb früh an einer Lungenentzündung. Dem Dorf fehlte es an notwendigen Medikamenten, um Hurtels Weib zu behandeln.
Carah ist blind.
Die Familie von Doktor Brinkel ist groß. Sein Weib trägt den Namen Urzella und hilft ihm als Krankenschwester in der Praxis. Seine erwachsenen Söhne Brank und Brunk (Zwillinge) gehen immer noch zur Schule. Seine Tochter Eify ist mit dem Sohn des Wirts verheiratet und hat ein Kind.
Urzella ist übrigens die Schwester von Hurtel. Somit sind Brank, Brunk und Eify Cousins und Cousinen von Pyla und Carah.
Hynrich der Polizist lebt allein. Er war nie verheiratet und hatte niemals Kinder. Hynrich gilt als mürrischer Buuraler, der oft nachts allein durch das Dorf streift.
Jork der Schmied ist ein Rauhbein. Seine Frau Elsbetha wiegt so viel wie eine Kuh. Ihr smarter Sohn Jock gilt als Dorfschönling und ist beliebt bei den Dorffrauen. Jock ist wie sein Vater Schmied. Ihn verbindet eine Freundschaft zu Paddy, dem geistig behinderten Sohn vom Fischer Krydemann.
Der Fischer Krydemann und seine Frau Lachsee gehören ebenfalls zu den Ältesten des Dorfes. Sie haben ein Kind, den geistig zurückgebliebenen Paddy. Er gilt als Dorftrottel und wird von vielen nicht sehr nett behandelt, hat jedoch in Jock, Carah und Pyla Freunde gefunden, die ihn akzeptieren.
Postmann Lytga ist glücklicher Familienvater von fünf Kindern und stolzer Großvater von siebzehn Enkeln. Seine Frau heißt Prysca. Sie führen ein normales, biederes Leben im Dorf und fallen kaum auf.
Der Feuerwehrmann Kulle ist der Partylöwe im Dorf. Seine Grillfeste sind legendär, sein Fleisch beliebt. Kulle säuft bis zum Abwinken und führt ein sehr trauriges, einsames Privatleben. Seine Frau Kaballa ist vor vielen Jahren zum Bauern Kroll gezogen. Seitdem lebt Kulle allein und mag Kroll nicht sonderlich.
Bauer Kroll ist für die Bewirtschaftung der Felder und das Vieh zuständig. Zusammen mit seiner Frau Kaballa, der Ex-Frau von Kulle, kümmert er sich um die Nahrung der Dorfbewohner. Kroll ist ein Eigenbrötler und wenig freundlich.
Pelzrak ist der älteste Dorfbewohner und Wirt der hiesigen Dorfschenke. Er ist vierfacher Vater, dreifacher Großvater und vierfacher Urgroßvater. Er lässt es sich nicht nehmen, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und bedient sogar selbst, obgleich die Aufgabe für ihn schwer wird und er öfters mal einschläft.
Warum sich das Rideryon so lange hinzog
Ein Lektoratsbericht von Alexandra Trinley
Mit Band 100 der Special Edition stockte DORGON. Vor allem zwischen dem Erscheinen von Band 106 und 107 lag eine riesige Pause, in der sich allerdings Entscheidendes veränderte. Unterm Strich wird die Pause der Serie guttun.
Das Problem in Kurzfassung: Die Bindung von zwei Dritteln der DORGON-Gruppe im Newsletter der PRFZ und beim Lektorat und Korrektorat der SOL und auch bei den Beiträgen fürs Corona Magazine schluckte spätestens seit dem Sommer 2018 viel Zeit. Aber es gab auch innere Verschiebungen, die bewältigt werden mussten. Nach mehr als 30 überarbeiteten Romanen der Special Edition und drei Taschenbüchern, deren Erstellung viel Sorgfalt erfordert, war ein grundsätzlicher Wechsel im Modus der Zusammenarbeit angesagt.
Frühere Phasen
Erinnern wir uns, wie das Projekt begann. Am Anfang, um Band 75 herum, stand ein schneller Kontakt, Nils brauchte Hilfe, DORGON war festgefahren, es ging ums Bearbeiten, und dann sollte möglichst bald weitergeschrieben werden. Nils ist in seiner Persönlichkeit vom Wiki-Prinzip der Perrypedia geprägt. Er schafft einen offenen Raum, in dem jeder sich einbringen kann. So jemandem hilft man gern.
Außerdem stellte sich schnell heraus, dass wir ähnlich träumten, auch wenn die Nazi-Welt des Quarterium-Zyklus eher ein Alptraum war. Beim Überarbeiten hatte ich eine freie Spielwiese, viel Platz zum Ausprobieren. Das war gut, weil ich von der klassischen Literaturwissenschaft herkomme und keine echte Genre-Leserin bin. Wie werden Abenteuergeschichten hübscher, wie fühlt es sich an, solche Handlungen auszudrücken?
Vieles im Quarterium-Zyklus ist nicht hübsch und sollte auch nicht hübsch sein, im Gegenteil: Die Vertrautheit mit Literatur und Dokumenten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs flossen ein und bereicherten die Handlung, wobei ich mir beim Ausformulieren den einen oder anderen Alpdruck von der Seele schrieb. Nils fühlte sich verstanden, auch wenn ihm wohl der Abenteueraspekt näher lag.
Unmerklich, wie es seine Art ist, kam René dazu, so dass wir plötzlich eine Dreiergruppe waren. Fast ohne Worte entstand eine Aufteilung der Arbeitsvorgänge, bei der sich die Neigungen ergänzten. Der durch die Dynamik zwischen René und mir entstehende Hang zur Präzision löste die Orientierung an Nils sicherlich hin und wieder ab, der das seinerseits interessiert zur Kenntnis nahm und nur selten leise klagte, wie viel anderes als das erneut liegenbleibende DORGON wir gemeinsam machten, wie dann auch »Gespräche über TERMINUS« und so weiter.
Der Brocken Rideryon
Was den Arbeitsprozess endgültig aus der Bahn warf, war Band 100 »Die Weltrauminsel Rideryon«. Der war überdimensioniert wie die Landmasse, auf dem er spielt, war arbeitstechnisch also geeignet, auch die wohlwollendste Lektorin aus dem Rhythmus zu bringen.
Hinzu kam ein ungünstiger Zyklusaufbau. Exakt nach dem riesigen Band 100, den man rückblickend gesehen unbedingt in vier oder fünf Einzelbände hätte zerlegen müssen, kam die »Schwarze Seele« von Roman Schleifer, ein Thriller, dessen Zusammenhang mit dem Rest der Serie erst am Schluss sichtbar wird und der einer anderen Textsorte angehört.
Entgegen meiner Befürchtungen wurde das eine sehr schöne Zusammenarbeit. Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Gruppe machten wir ein aktives Lektorat mit viel Kontakt, arbeiteten uns Stück für Stück vor, wodurch der Text deutlich länger und auch blutiger wurde als die Anfangsversion. Wobei ich heute noch finde, dass er wesentlich länger sein müsste. Ein paar hundert Seiten mehr hätten dem Handlungsfortschritt und der Charakterisierung gut getan. Das hätte dann aber wirklich nicht mehr in DORGON gepasst.
Die Folgen der »Schwarzen Seele«
Nun war die »Schwarze Seele« ein durchgearbeiteter Roman mit einem für unsere kleine Fanserie ungewöhnlich ausgeprägten Aufbau, was den Übergang zum »Chaos im Kreuz der Galaxien« (Band 102) problematisch machte. Was tun?
Neue Spielwiese! Denn ich hatte mich in der Zusammenarbeit mit Roman weiter in die Tiefen der Grausamkeit begeben als je zuvor – und da war die 102, die ich wieder allein bearbeitete, ein idealer Ort, das alles mal allein auszuprobieren. Wer weiß, vielleicht müssen wir das Gemetzel wieder zurückfahren, wenn die Taschenbuchbearbeitung an diese Romane kommt, oder auch nicht.
Die Folgeromane »Manjardon« und »Der Virus Prosperoh« von Aki Alexandra Nofftz wurden nur nachbearbeitet. Die Konflikte waren klar, doch was mir nicht gefiel: Bedauerlicherweise spielte das Rideryon selbst, dieser phantastische Handlungsort, nur eine untergeordnete Rolle.
Es folgten »Der Andromeda-Feldzug« von Jürgen Freier und Jens Hirseland, wobei Nils bei der Aufbereitung des Textbestands für die Special Edition Romane zusammenlegte und auch mal umfangreiche Teile kürzte oder um neue Abschnitte erweiterte, ehe sie an mich gingen. Das neu Geschriebene ist leichter zu redigieren.
Die Geschichten von Jens sind in der Regel voller krudem Humor, was sich gut überarbeiten lässt, während die von Jürgen sehr geschlossen sind, manchmal geht kein Eingriff, der über das Ausbessern sprachlicher Fehler und kleine Ausgestaltungen hinausgeht. Sein »Krieg in Andromeda« (Band 106) war solch ein Roman.
Dazu kam ein zunehmendes Hufescharren – es wurde mehr und mehr und noch mehr Text zum Überarbeiten sichtbar, wo es ursprünglich mal geheißen hatte, dass sich der Altbestand in Grenzen hält. Der schien aber Junge zu kriegen, ständig kam noch und noch und noch was hinzu.
Aus genannten Gründen hatte meine Demotivation am Übergang zur 107 ihren Höhepunkt erreicht, noch dazu, weil die »Piraten Rideryons« wieder mal von Nils war, aber erneut den Schauplatz verschenkte und viel zu schnell ablief. Habe ich erwähnt, dass wir ähnlich träumen? Dadurch entsteht auch ein Überhang an Ideen. Und so kam es zur »Carah«, und zu einer neuen Phase der Zusammenarbeit.
»Carah«
Im Conbuch des 3. BrühlCon gibt es die Geschichte von Carah – meiner Carah, die im Roman Nr. 107 ein einfaches Bauernmädchen ist. Diese Geschichte fügte zusammen, was getrennt war, und das ist auch in ihren Verlauf hineingeschrieben.
Wir befanden uns in einer Stockung, und der Retter hieß Martin. Nicht der Heilige Martin, sondern der Brühlotarch Martin aka Ingenhoven, der mit dem »Heftehaufen«. Martin schrieb wegen eines Conbuchbeitrags, wünschte sich eine Geschichte. Eine mit DORGON? Sehr gerne! Also gut. Dieses ewige Überarbeiten nervt irgendwann schon sehr.
Aber welche Geschichte? Wo wäre ein Anknüpfen sinnvoll? Viele DORGON-Figuren hatte ich ausgestaltet, aber keine gehörte mir. Am fremdesten waren mir die Hexen, die Lilim, und das hat mich blockiert. Da könnte ein wenig spielerische Auseinandersetzung nützen. Ich entschied mich also für die Geschichte einer Hexe.
Da das Rideryon wenig konkret beschriebene Umgebung hatte, holte ich aus einer nie fertiggeschrieben Geschichte eine Landschaft und Insekten, die vorzüglich zur vielbeinigen Fauna der 107 passten. Aber was sollte in der Geschichte passieren?
Wie sollte meine Hexe heißen? Ich fragte einen Freund, wie ich als Hexe hieße. Er schlug Kara Zor-El vor, das kryptische Supergirl, ha ha, sehr witzig – bis ich genervt in der 107 scrollte und Carah entdeckte. Dieser Zufall legte die Person fest. Dass Carah blind ist und ich einige Zeit lang von Phasen der Sehschwäche geplagt wurde, die mein Lektoratstempo nicht beschleunigten, erleichterte die Wahl. Carah war als Hülle festgelegt, hinter der sich eine andere Lebensform versteckte – so eine richtige Lilim ist sie wohl auch nicht, doch das Rideryon ist groß, hat unzählige Völker.
Ausgangspunkt sollte mir die Echtwelt sein, die ich aus eigener Anschauung beschreiben konnte. Carah sollte also zwei Identitäten haben. Da brauchte es einen zweiten Namen. Ich fragte meinen Mann, wie ich hieße, wäre ich eine Hexe. Seine Antwort lautete »Alexandra«. Ha ha, sehr witzig! Nix da! Meine Protagonistin nennt sich durchgehend Carah.
So ergab sich ein neuer Modus der Zusammenarbeit. Carah hatte nach meiner Geschichte ein genaueres Aussehen, und ihr Wohnort hatte mehr Flora und Fauna. Nils übernahm diese Beschreibungen in die 107. Im Gegenzug zu meinem Redigieren seines Romans spürte er in meiner detailreichen Art zu erzählen Abläufe auf, bei denen die Bewegungen nicht stimmten, wo Gegenstände und Personen nicht zur richtigen Zeit am richtigen Platz waren. Ich machte den Humor der 107 subtiler, er brachte ein paar gröbere Witze in meine komplexere Conbuch-Geschichte ein, und mehr Situationskomik.
Und er beeinflusste den Schriftsteller Jonathan, der durch eine mysteriöse Transportvorrichtung auf dem Rideryon landet. Nils ist die Seele von DORGON – sollte meine »Carah« sich in unsere Fanserie einpassen, so musste er dem Jonathan, der eigentlich älter und nervöser war und einen anderen Menschen als Vorlage hatte, einige seiner Charakterzüge leihen, inklusive Nikotinlaster. Das war ziemlich lustig. Humoristischer Höhepunkt war der Kommentar: »Na ja, wenn sie ihn zu einem Ylors schleppt, kann sie schon auch mal für ihn kochen.« Und die 170 Millionen Jahre natürlich.
Der Ylors … da habe ich meine ursprünglich blutigere Geschichte ziemlich umgestaltet, so dass sie humorvoll bleibt. Gregor Sedlags großartige Illustration dürfen wir nach der Veröffentlichung im Conbuch auf der Website verwenden. Durch seine Wahl der Geschichte war der Schluss, den ich zu diesem Zeitpunkt nur skizziert hatte, festgelegt. Gregor hatte sich wegen der Verankerung in der Echtwelt und des betreffenden Aspekts der Schlussszene diese Geschichte zum illustrieren ausgesucht. Später stellte sich erst heraus, wie problematisch es war, an dieser Stelle anzukommen.
Andere Fundstücke kamen hinzu. Zum Beispiel der nervige Riffmausbiber. Nils hatte seinen Kalky, den wollte ich nicht weiterverwenden, das gab die Figur nicht her. Ich entdeckte im Heft eines Schülers den hingekritzelten Namen Korkij. Das passte gut. Das Ylors-Haus kam auch aus meiner alten Geschichte, der Rabe hatte was mit einem Mausbiberhasser zu tun, auch das erwies sich aber im Schreibprozess als veraltet und musste eingepasst werden.
Band 108 titelt »Medvecâ«. Das ist der Fürst der Ylors, ein finsterer Geselle. Da auch dieser Roman von Nils ist, kann man vielleicht wieder verzahnen – ein Ylors ist jede Verzahnung wert.