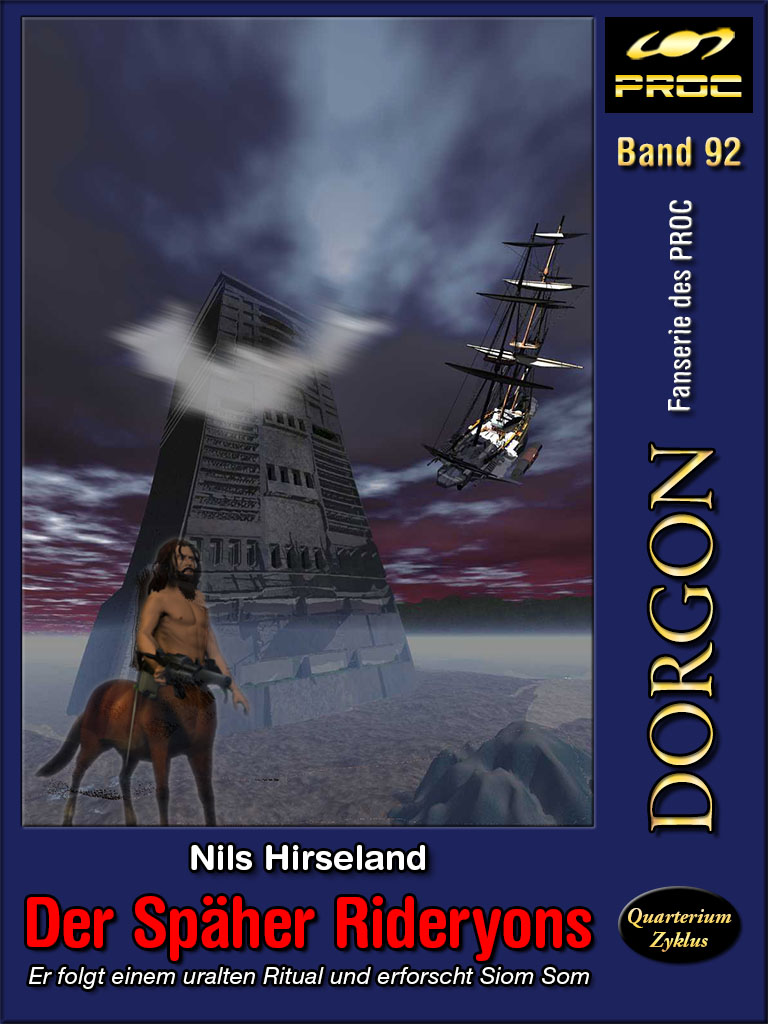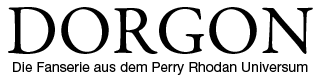| Was bisher geschah | Hauptpersonen des Romans |
|---|---|
| Dezember 1306 NGZ. Die Galaxien befinden sich im Krieg seit dem Angriff der Dorgonen auf Siom Som vor fast zwei Jahren. Das Quarterium und das Kaiserreich Dorgon stehen gegen eine Allianz der Saggittonen, Akonen, Estarten und USO-Agenten. Sie bekämpfen sich seit Februar 1305 NGZ. Kaum ein Wesen weiß von der Verbindung des Emperadors de la Siniestro mit MODROR, jener negativen Entität, die für all die Untaten verantwortlich zu sein scheint. Während MODROR einen absoluten Krieg auch gegen die Liga Freier Terraner fordert, sucht der Emperador Frieden mit Perry Rhodan, da er den Unsterblichen fürchtet. Deshalb lädt er Perry Rhodan und seinen Sohn Roi Danton sowie Reginald Bull und den Mausbiber Gucky zu einer privaten Weihnachtsfeier mit der Familie de la Siniestros ein. Während Rhodan noch überlegt, ob er diese Einladung annehmen soll, machen sich in weit entfernten Regionen des Alls Wesen auf den Weg, um Galaxien zu erkunden. Einer von ihnen ist DER SPÄHER RIDERYONS … |
Mashree – Der Riffspäher. Daccle Dessentol, Secc Grindelwold, Lariza Bargelsgrund, Wilzy Wltschwak – Vier gannalische Kinder mit reinem Herzen. Emperador Don Philippe de la Siniestro – Der Spanier verfolgt ein bestimmtes Ziel. Orlando, Brettany, Peter, Stephanie – Die Kinder de la Siniestros. Cauthon Despair – Der Silberne Ritter hasst Weihnachten. Perry Rhodan – Der Terranische Resident freut sich gar nicht auf Weihnachten. Reginald Bull, Roi Danton, Gucky – Rhodans Begleiter. |
Prolog – Der Kampf
Der Vulkan spie Feuer, klirrend und Funken sprühend kreuzten einander die scharfen Klingen. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Ein Duell zwischen einstigen Alliierten, die nun bittere Feinde waren, die epische Schlacht zwischen den zwei Ikonen des Resif-Sidera Rideryon: Nistant, der Herrscher über alle Landen auf Rideryon und den Monden der Thol, gegen seine einstige treue Verbündete Lilith, der Mutter aller Hexenbrut, der Verräterin des Resif-Sidera.
So putschten die Hexen gegen den Erschaffer von Rideryon. Sie wollten die kosmische Aufgabe des Resif-Sidera sabotieren und kämpften gegen die Rideryonen und besonders gegen Nistants Jaycuul-Ritter. Sie fochten gegen die Entität NACHJUL und sie wandten sich gegen Nistant selbst.
Lilith verletzte den Meister und Erbauer des Resif-Sidera auf dem Berge Keshruuv. Ihre Hiebe mochten ebenso schmerzen wie einst die Zurückweisung seiner über alles geliebten Ajinah – einst, in der dunklen Zeit vor der Goldenen Ära des Glücks und der Liebe. Sie mochten Nistant genauso in Pein aufschreien lassen, wie das verdorbene Volk der Sargomoph dereinst seinen Sohn in Zorn und Hass brüllen ließ.
Das Unfassbare geschah: Nistant starb durch Liliths Schwert. Doch er riss ihren Körper mit in den Tod. Sein Geist verwehte, keiner wusste wohin. Seine Schatten, seine anderen zwei Selbst, Cul’Arc und Brok’Ton wurden durch die Hexen verschleppt und an die hinterlistige Kahaba, die Anstifterin des schändlichen Verrats, übergeben.
Nistant war tot, Cul’Arc und Brok’Ton weggesperrt für alle Ewigkeiten. Die finstere Superintelligenz führte einen Feldzug der Rache gegen die Hexen und vernichtete sie voll todbringender Verachtung. Es hieß, die Seele Liliths würde auf immer im Feuer der Hölle schmoren, welches ihr der Kosmokrat AMUN selbst bereitete.
Ohne Nistant setzte Rideryon seinen Weg fort. Lange, lange Zeit begleitete NACHJUL das Resif-Sidera durch das Weltall, ehe er aufstieg und eine neue Bestimmung fand.
Doch der Glaube an Nistants Rückkehr hielt sich über Millionen von Chroms. Die Hoffnung auf die Rückkehr des Erbauers von Rideryon lebte in unzähligen Generationen der Rideryonen fort.
Den verschwundenen Nistant und seine über alles geliebte Ajinah verehrten die Rideryonen als die Herrscher des Resif-Sidera. Doch selbst Äonen nach den Ereignissen warteten die Völker vergeblich auf ihre Rückkehr, ohne in Zweifel zu fallen. Alle Wesen auf Rideryon waren festen Glaubens: Nistant würde zurückkehren. Irgendwann.
Der Mann mit dem Hut
Ich bin der Mann mit dem Hut und ich will euch eine Geschichte erzählen. Doch ehe ich beginne: Hört ihr auch die zweiköpfigen Schnabler gackern? Sie zwitschern seinen Namen. Den Namen des großen Meisters, des guten Geistes.
Heureka rufen sie alle. Nicht nur die albernen Schnabler aus den Ebenen des Feenlandes von Miskatoor. Nein, alle rufen es. Obwohl sie es noch gar nicht wissen. Innerlich zelebrieren sie es, denn der Große Meister wispert es ihnen des Nachts zu, wenn es dunkel ist und sie schlafen, in ihr Bettzeug oder an den warmen Körper des Bettgespielen gekuschelt. Das ist die Zeit, dann spricht er zu ihnen. Zu mir spricht er immer. Hörst du seine Stimmen? Ich bemerke sie. Ja, meine Stimmen sind gut zu mir. Sie sind weise, sie geben mir Ratschläge und helfen mir, meinen Weg zu beschreiten.
Das Flüstern dringt von den finsteren Tälern der Ylors bis weit nach Ajinahstadt. Er wird zurückkehren. Wir sind fast da. Die Sterneninsel liegt vor uns und es dauert jetzt nicht mehr lang. Der eine von ihnen liegt hier gefangen. Der andere ist noch ein paar Millionen Lichtjahre entfernt. Aber was sind schon ein paar Millionen Jahre für die Weltraumarche, die bereits seit zweihundert Millionen Jahren unterwegs ist? Nichts. Ein Wimpernschlag.
Doch für diese auserwählte Generation ist dieser Wimpernschlag alles. Denn sie werden Zeuge der Auferstehung unseres Herrn und Meisters werden.
Heureka!
Der Meister kommt zurück. Dabei war er nie wirklich weg. Ein Teil von ihm ist immer bei uns gewesen. Er hat uns über Millionen von Chroms hinweg gelenkt. Doch dieser große, gute Geist ist erwachsen geworden und mächtiger, als es der Meister je war, obwohl er doch noch älter ist und der Begründer unserer Zivilisation.
Ich ziehe meinen Hut vor ihm. Ich verbeuge mich. Er wird Veränderungen bringen, wenn er befreit wird. Dass er befreit wird, davon gehe ich aus. Die neue Generation der Rideryonen hat unbewusst – gesteuert vom Großen Geist – bereits die Weichen gestellt. Sie schicken den Späher des Resif-Sidera, um die Galaxis mit dem Namen Siom Som auszukundschaften. Sie suchen nach telepathisch begabten Wesen auf Rideryon, um den Kontakt zum physischen Splitter des Nistant herzustellen. Erst ihn, dann den anderen. Und dann wird Nistant kommen. Das hoffe ich. Nach Millionen Chroms kehrt er vielleicht zurück.
Nistant wird die Arche, das Resif-Sidera im Weltall, in eine neue Zukunft führen. Er wird zu den Bergen gehen und Fragen stellen, Fragen beantworten.
Die Zeit ist reif. Wir kommen!
*
Die Kiefernwälder verbreiteten einen ganz speziellen Duft. Ich atmete die frische Luft genüsslich ein. Dann zog ich meine Sandalen aus und ging barfuß über den matschigen Boden. Vor mir auf einer Lichtung lag das Dorf. Es war weit und breit die einzige Siedlung. Diese Buuraler lebten in Isolation von ihrem Volk, viele hundert Kilometer tief in diesem unbewohnten Wald. Fast unbewohnt, denn er grenzte an die Finsternis. Ja, und nach der nannten die Dorfbewohner sich auch – die Finsteren.
Ich wanderte also mit matschigen Füßen durchs finstere Tal, immer weiter in Richtung des kleinen Dorfes. Von Weitem sah ich das Licht in den Häusern brennen. Vor mir lagen bestellte Felder und ich passierte einen leeren Ausguck aus Holz, drei ausgewachsene Mann hoch. Der Weg glich einer Wanderung in die Vergangenheit. Auch spirituell war es eine interessante Erfahrung. So unberührt war hier alles! Freiwillig hatten die Buuraler sich vom hektischen Alltag ihres höher entwickelten Volkes losgesagt zugunsten der Einsamkeit.
Sie wussten noch nichts von den kosmischen Ereignissen, die auf sie zukommen würden. Doch damit waren sie wiederum nicht allein. Es gab unzählige Völker auf dem Riff. Viele lebten so wie diese Dorfbewohner: in Isolation, Abgeschiedenheit, hatten niemals die Thol-Monde besucht.
Sie waren so unbedarft. Und so trat ich ihnen entgegen, als die ersten neugierigen Buuraler mich anstarrten. Ein hochgewachsener, bärtiger Mann mittleren Alters kam mir entgegen.
»Nistant sei mit euch«, sprach ich und lächelte.
»Nistant sei mit dir, Fremder. Ich bin Hurtel, der Bürgermeister unserer Gemeinde«, erwiderte der Bärtige. Und er stellte die Buuraler vor, die mich voll Neugierde beäugten.
Der Schäbige mit der Mistforke hieß Kroll und war der hiesige Bauer. Die anderen Namen merkte ich mir nicht. Doch dafür fielen mir die zwei hübschen Buuralerinnen auf. Sie waren die Töchter des Bürgermeisters. Die eine trug gewellte Haare, doch ihre Augen waren weiß. Das hübsche Kind war blind. Die andere war eine vollbusige Blonde mit strahlenden blauen Augen. Die Blinde hieß Carah, der Blondschopf Pyla.
»Weshalb bist du hier?«, fragte Hurtel misstrauisch.
Ich lächelte und betrachtete meine matschverschmierten Füße. Sie gefielen mir so dreckig. Der kalte Schlamm zwischen meinen Zehen beglückte mich. Ich strich über meinen langen Bart, dann nahm ich den Hut ab und verbeugte mich.
»Ich bin auf der Durchreise. Ich predige. Denn die Rückkehr ist nah.«
»Wessen Rückkehr?«, fragte Carah.
Sie ging zu mir und streckte die Hände aus.
»Darf ich?«
Ich bejahte. Ihre feinen Finger tasteten über mein bärtiges Gesicht, fuhren durch die langen Haare. Dann ließ sie von mir ab und ging zurück.
»Du bist ein Husaave«, sagte sie.
»Das hast du mir wohl an der Nasenspitze angesehen? Oder angetastet, schönes Kindlein? Ja, ich stamme vom Volk der Husaaven. Ihr kennt demnach andere Spezies?«
»Wir sind nicht ganz dümmlich, Fremder. Doch wir leben in einer selbst gewählten Isolation und je eher das Wissen verloren geht, desto besser«, sagte Hurtel. »Und nun beantworte uns die Frage.«
»Es ist die Rückkehr des Heiligen. Die Rückkehr unseres Schöpfers. Oh ja, meine Freunde! Der Große Geist persönlich hat zu mir gesprochen. Nistant kehrt zurück. Und das Riff wird schon bald eine Sterneninsel erreichen.«
»Das ist Blasphemie«, rief der Fischer. Ich glaubte, sein Name sei Krydemann.
Und ich lachte. Laut lachte ich den Einfältigen aus.
»Was weißt du schon? Kennst du den Namen der Finsteren? Hast du jemals mit einem gespeist? Hast du die Riesen von Thol kennengelernt oder mit den Riffpiraten bei gutem Manjorwein Karten gespielt? Die Stimmen in meinem Kopf sprechen von Generationen über Generationen aus dem Riff. Glaubt mir, ich bin nicht blasphemisch. Ich bin ein Bote des Geheiligten.«
Ich lachte und lachte. Die anderen schienen mir nicht zu glauben. Diese Narren.
»Gibt es keine Gastfreundschaft in dem Dorf? Ich habe Hunger und Durst«, sagte ich schließlich.
»Also gut, Prediger. Komme mit«, sprach Hurtel.
Ich sank auf die Knie, beugte die Arme und drückte sie in den Schlamm. Dann krabbelte ich auf allen Vieren durch Matsch und Dreck zur einzigen Taverne. Pyla sah mich ungläubig an. Ich blinzelte ihr zu. Die anderen gingen voran. Nur sie passte sich meinem Tempo an.
»Warum tust du das, Fremder?«
»Weil ich es kann. Ich bin frei. Ich esse Fliegen und mache in die Hose. Ich schlafe mit den Schafen und frühstücke mit den Wölfen. Ich bin frei. Ich verkünde die Wahrheit, denn die Stimmen in meinem Kopf lügen nicht.«
Pyla lächelte.
»Du bist interessant. Ich will auch frei sein. Zu den Sternen reisen. Weg von dieser Einöde.«
Ich grunzte.
»Du wirst noch ein Sternenkindchen werden, Pyla. Das garantiere ich.«
Wir erreichten die Taverne. Ich schmierte Schlamm in mein Gesicht, dann wusch ich mir die Hände und sang ein Liedchen von Ajinahs Keuschheit. Der Duft des geräucherten Fisches und des Rindes stachen wohlig in meine breite Nase. Ich schwang mich auf den Holzstuhl, griff beherzt ins Fleisch und stopfte es mir in den Mund. Was am Bart hängen blieb, das würde ich später essen. Die Masse spülte ich mit einem eher schlechten Bier hinunter.
Zum Zeichen des Wohlgefallens pupste ich meine Freude hinaus. Das war ein Mahl!
»Nun denn, höret meine Worte: Nistant kehrt zurück. Schon bald wird es soweit sein. Die Hohepriesterschaft des Nistant wird einen Riffspäher in die Weiten des Alls schicken, um die neue Sterneninsel zu erforschen. Von da an wird sich alles ändern, meine Freunde.«
Hurtel winkte ab.
»Wir leben abgeschieden. Uns wird das gar nicht betreffen.«
Ich stand auf. Dabei platschte ein Stück Rinderkeule von meinem Bart auf den Teller. Ich kicherte über seine Naivität.
»Ihr wisst nichts. Niemand kann sich vor dem Großen Geist verstecken. Auch euer Leben wird sich ändern«, sagte ich und begann mich auszuziehen. Als ich nackt vor ihnen stand, packte ich meine Sachen in den Beutel. Nur meinen Hut behielt ich auf.
»Denkt an meine Worte, Freunde. Lebet wohl. Ich gehe nun.«
Entrüstet von meiner Nacktheit starrten sie mich an. Ich lächelte ein letztes Mal, dann verließ ich die Taverne und stapfte durch den Matsch. Nach wenigen Minuten erreichte ich den Wald.
»Nicht doch, Fremder. Dort sind die Finsteren«, rief mir Pyla hinterher.
Ich stoppte, blickte kurz zurück und sagte zu ihr: »Ich weiß. Genau dort will ich hin. Denke an mich: Nistant kehrt zurück. Er kehrt zurück!«
Der Späher Rideryons
Es war soweit. Für Mashree eine besondere Zeit – nein, die Wichtigste von allen. Er war auserkoren worden, die neue Welt als Erster zu erforschen. Diese Ehre wurde nur wenigen in Äonen zuteil. Nur jene, die gerade dann am Zenit ihrer Fähigkeiten standen, wenn das Resif-Sidera eine neue Sterneninsel erreichte.
Tosender Applaus donnerte Mashree entgegen, als er die Halle der Weihe betrat. Sie war eine in Stein geschlagene Höhle, die größte der unterirdischen Metropole Amunrator auf der Schattenseite. Doch eigentlich erinnerte nur wenig den Harekuul daran, dass er sich in der Unterwelt befand. Natürlich, das künstliche Licht aus den Lampen an Decken und Wänden, die etwas stickigere Luft, an die er sich bis heute nicht gewöhnt hatte … ansonsten glich Amunrator mit seinen Stollen, Gängen und großen Bauwerkshöhlen einer Stadt in der Nacht, nur dass die Gebäude in die Tiefe ragten, dass es keinen freien Himmel gab, zu dem man hinaufblicken konnte.
Die Halle der Weihe simulierte an der Decke den Mondhimmel. Die achttausend Gestirne – alles Thol-Monde – blinkten in einer Holografie auf sie hinab. An den Wänden ringsum waren unzählige Statuen aufgereiht. Natürlich Abbilder von Nistant und Ajinah, aber es waren auch ruhmreiche Späher von Rideryon darunter. Seine Ahnen, seine Vorväter.
Als er langsam an den Bewohnern vorbeitrabte, spiegelte sich sein kraftvoller Körper im bernsteinfarbenen Boden. Seine vier Hufe bewegten sich in tadellosem Rhythmus, die Arme hielt er bescheiden gesenkt. Er wusste um die Pracht seiner muskulösen Arme und den kastanienfarbenen Glanz seines mit kostbarem Öl gepflegten Bartes.
Die ausgewählten Vertreter der Riffvölker jubelten ihm zu. Alle waren sie versammelt: Die vierköpfigen Huskenen, die kopflosen Dychoo, die tausendgliedrigen Vessyl, die Giganten von Tohl, die Zwerge aus dem Steinsektor von Bruul, die Flatroor aus den Lüften, die psionisch begabten Gannel, die Buuraler, Persy, Manjor und natürlich die Harekuul. Jene Völker, die in Amunrator in den letzten Chrons an der Realisierung des Projektes beteiligt waren. Jene auserwählten Spezies, die schon seit Äonen die Geschicke des Resif-Sidera in einer friedlichen Völkergemeinschaft regelten.
Natürlich waren sie nur ein Bruchteil der Völker auf Rideryon. Kein Rideryone wäre in der Lage gewesen, alle Völker und deren Kolonisten auf Rideryon und den Monden von Thol aufzuzählen. Sie waren einfach zu zahlreich. Immer wieder entstanden neue Wesen und Kreaturen aus sich heraus. Die Evolution bahnte sich auf der gigantischen Landmasse ihren eigenen Weg.
Auf seinem Weg zur Ehrentribüne flatterten Mashree die leuchtenden Feen aus Miskatoor entgegen. Sie ähnelten Buuralern mit insektoiden Flügeln und besaßen die Fähigkeit, den Geist eines Wesens in Harmonie und Freude zu versetzen. Zweifellos waren sie Suggestoren, doch sie verwendeten ihre Gabe nur zu friedlichen Zwecken. Miskatoor-Feen waren für das Gleichgewicht und das friedliche Miteinander auf Rideryon zuständig. Sie verhinderten Verbrechen, indem sie jeden Verbrecher zum positiven Denken zwangen. Miskatoor-Feen stützten das Resif-Sidera. Ein Leben ohne sie wäre ein Dasein im Chaos.
Die Fanfare des Spähers erklang zu Mashrees Ehren. Diese Musik wurde nur gespielt, wenn ein Späher in die neue Welt aufbrach. Nun war es endlich wieder soweit. Nach mehr als hundertdreißigtausend Chrons erreichten sie eine neue Welt.
Vor ihm baute sich die mächtige Gestalt des alten Meisters und Mentors Zigaldor auf. In seinem Gesicht stand die Weisheit tausender Chrons. Er breitete seine sechs Arme aus. Das Fell des Manjors war grau, doch er war keineswegs ein hinfälliger Greis. Seine braunen Augen funkelten voller Energie.
»Späher des Resif-Sidera, bist du bereit für deine Aufgabe?«
Die Stimme Zigaldors hallte durch den gesamten Saal. Mashree lief ein Schauer über den Rücken. So lange hatte er auf diesen Moment gewartet, sein ganzes Leben nur diesem einen Ziel gewidmet. Es gab keine größere Ehre für einen Rideryonen.
»Der Späher aus dem großen Rideryon, der die Völker der Gemeinschaft Rideryons und der Monde von Thol – dem Resif-Sidera – repräsentiert, ist bereit, Meister Zigaldor. Bei unserem Begründer, dem großen Nistant von Sargomoph, ich bin bereit.«
Das war die Formel, die Mashree auswendig gelernt hatte. Sie war nicht schwer, ein Versprecher wäre peinlich gewesen.
Zigaldor nickte. Ein Lächeln huschte über seine Lippen. Er gab Murrh ein Zeichen. Murrh schliff über den Boden zu den beiden und hinterließ eine braungelbe, vereinzelt blubbernde Schleimspur. Das kugelförmige Wesen vom Volk der Persy baute seinen gallertartigen, gelbbraunen Körper auf. Aus dem Torso züngelten vier Tentakel. Jede Bewegung wurde von einem glucksenden Geräusch begleitet, welches durch die Tentakel über seinem Mund entstand.
»Bei Nistant, dem großen Sargomoph. Vor vielen Millionen Chrons entsandte Nistant uns ins All, um neue Welten zu erforschen und ihnen Leben zu schenken. Seitdem ist das Riff kontinuierlich gewachsen und wir erwarten die Rückkehr unseres Heiligen. Bis dahin werden wir treu seinem Willen folgen. Späher, du hast den Segen der Hohepriesterschaft des Nistant!«
Der alte Manjor Zigaldor übergab Mashree den heiligen Stab der Erforschung. In diesem Datenspeicher würde er alle Daten der neuen Welt sammeln.
Wieder lächelte Zigaldor und entblößte seine dolchscharfen Eckzähne. Die spitzen Ohren standen senkrecht, das Fell sträubte sich hoch. Ein Zeichen, dass er tief berührt war, so wie Mashree selbst.
»Und nun Mashree, deine Gefährten auf dieser Mission. Zwei Auserwählte, die dem Späher dienen werden während seiner Erkundungen.«
Zigaldor deute auf zwei Wesen, die Mashree nicht unbekannt waren. Borgelund, der Tashool und Wedyyrk, die Fithuul.
Mashree hatte mit den beiden zusammen eine hervorragende Ausbildung genossen. Trotzdem war das Wichtigste für ihn, dass er der Späher des Resif-Sidera war und sie nur seine Diener. Mashree würde in die Geschichtsdatenbanken eingehen. Darauf hatte er sein ganzes Leben hingearbeitet.
Wieder ertönte die heitere Fanfare der Rideryonspäher, komponiert vom legendären Zwerg Zillii vor siebenhunderttausend Chrons.
»Und nun«, sprach Zigaldor und hob erneut seine sechs Arme, »breche auf, Späher und bringe uns Kunde von der unentdeckten Sterneninsel im Weltraum. Möge Nistant mit dir sein, mein Sohn!«
Mashree knickte die vorderen Beine ein und neigte den langen Hals tief. Dann erhob er sich und trabte davon. In gebührendem Abstand, wie er freudig registrierte, folgten ihm Borgelund und Wedyyrk. Der wuchtige Körper des Tashool stampfte auf beiden Stummelbeinen vorwärts. Die beiden Arme schlenkerten im Rhythmus seiner Schritte. Sein langer Hals war aufgerichtet, die fünf Stilaugen an dessen Ende auf ihn fixiert. Auch Wedyyrks schwarze Augen waren unbeirrbar auf ihn gerichtet. Unter ihrer transparenten Haut erkannte er jedes Organ. Er wusste um die Stärke in ihren beiden knochigen Beinen, um ihre überragende Kondition.
Mashree durchschritt den Korridor zur Rohrbahn, welche direkt zur Außenwelt führte. Ein Vessyl krabbelte knacksend auf sie zu. Er baute sich vor ihnen auf und überragte alle drei um mehrere Kopflängen.
»Euer Begehr?«
»Ich bin der Späher«, sagte Mashree ungeduldig. Unwillkürlich strich er sich über den langen, kastanienbraunen Bart, unterdrückte den Wunsch, seinen graubraune Raumkombination glattzuzupfen, um auf seinen Rang zu verweisen. Er stampfte nur mit zwei Hufen, dann zeigte er kühles Standesbewusstsein.
Sein Gegenüber beeindruckte er damit kein bisschen.
»Und wenn du Nistant selbst wärst, so würde es die Termetoren nicht interessieren. Deine Erlaubniskarte?«
Mashree gab sie dem Vessyl. Der steckte die Karte, welche von Zigaldor unterzeichnet war, in einen Scanner und überprüfte damit die Echtheit. Dann zog er sie heraus. Mit einem der Gliedmaßen griff er nach einer Sprühflasche. Damit sprühte er die drei ohne Vorwarnung ein. Es war ein fauliger Duft, er roch nach verwesendem Fleisch.
»Die Termetoren verfügen über einen speziellen Geruchssinn. Sie wissen nun, dass ihr authentifiziert seid. Steigt ein. Wünsche eine angenehme Reise.«
Die drei husteten, dann begaben sie sich in die Kabine mit den rot gepolsterten Sitzen. Die Einstiegsluke schloss sich und die Fahrt begann. Nur authentifizierte Rideryonen durften Amunrator in Richtung Schattenwelt verlassen.
Denn ihr Raumschiff befand sich auf der Dunklen Seite Rideryons, welche von den Ylors beherrscht wurde. Die galt es zu vermeiden. Die Ylors waren Blutsauger. Sie konnten sich in riesige Fledermäuse verwandeln, in Wölfe, doch auch in wunderschöne, grazile Gestalten. Die Legende besagte, dies sei ihre ursprüngliche Gestalt gewesen, die sie durch einen Fluch unendlich mächtiger Wesen verloren, vor denen sie schuldig wurden. Unsterblichkeit sei ihre Strafe und das Gebot, der Heimatwelt nahe zu bleiben. Wer dagegen verstieß, wurde Ylors. Was an der Sage stimmte, wusste Mashree nicht. Wohl aber, dass er die Ylors auf alle Fälle meiden wollte.
Er war der Späher von Rideryon mit seinen Begleitern. Ihre Mission genoss höchste Geheimhaltung. Nur ausgewählte Vertreter der vielen Völker wussten davon. Sie lebten in Abgeschiedenheit, fern von Ajinahstadt, Commerza und anderen großen Metropolen, denn ihre Mission sollte noch nicht der Öffentlichkeit publik gemacht werden.
Auf der Dunklen Seite lauerten Gefahren. Zwar war Amunrator eine große Siedlung, doch im Gegensatz zu Ajinahstadt oder Commerza keine offene Stadt. Seine Bewohner waren Wissenschaftler und Soldaten mit ihren Familien. Jene, die über Generationen hinweg am Kulturaustausch arbeiteten. Streng geheime Projekte mussten sie durchführen. Die Hohepriesterschaft des Nistant bewahrte hier verbissen bewachte Geheimnisse und es hieß, es gebe hier eine Passage zum Großen Geist des Riffs, welche von einem Volk bewacht wurde, das weit schlimmer sein sollte, als die Termetoren. Kein Wunder, dass man keine Fremden hier rein ließ. Die Bevölkerungszahl von Amunrator war auf vier Millionen Wesen begrenzt.
Der Zugang zur Dunklen Seite des Riffs war streng bewacht. Denn die Termetoren hielten nicht nur die Ylors von Amunrator fern, sondern auch die Amunratoren von den Ylors.
Sie verließen die fensterlose Röhrenbahn und schritten durch einen dunklen, nebligen Korridor, der sie an ein Tor führte. Es gab keine anderen Wege in die Schattenwelt, als diese Kontrollpunkte. Jede Rohrbahn führte direkt durch die Unterwelt zur Tagesseite.
Vor ihnen stand ein Termetor, ein Wächter der Innenwelt. Das knöcherne Wesen in der grauen Kutte musterte sie abfällig. So wie die lebensfrohen Miskatoor-Feen Harmonie ausstrahlten, so versprühten diese Kreaturen Kälte und ließen jeden in Furcht erstarren. Doch Mashree war entschlossen, sich keine Blöße zu geben.
»Ich bin der Späher. Lasse mich und meine Gefolgsleute durch die Passage.«
Der Termetor gab nur ein undefinierbares Wispern von sich. Seine Augen leuchteten rot. Er bewegte sich nicht. Langsam wurde Mashree unsicher. Termetoren waren für ihre Unberechenbarkeit bekannt. Sie töteten willkürlich, wenn ihnen jemand nicht gefiel. Doch sie waren wichtig, denn sie schützten die Innenwelt vor dem Gesindel der finsteren Außenwelt. Vor den Verbrechern und Taugenichtsen, die als Sklaven und Vasallen den Ylors dienten. Selbst die Feen waren nicht in der Lage, sie alle zu kontrollieren. Ebenso wenig wie sie die Termetoren kontrollieren konnten. Niemand konnte das, bis auf die Priesterschaft. Die Termetoren gehörten zu den ältesten Völkern des Resif-Sidera. Es hieß, sie stammten schon aus der Zeit des Nistant.
Der Termetor schien unseren »Duft« wahrzunehmen.
»Du kannst passieren«, hauchte er nach einer halben Ewigkeit und machte den Weg frei.
Mashree nickte ihm kurz zu und gab Borgelund und Wedyyrk ein Zeichen. Sie folgten ihm. Jedoch hielten sie nicht den gebührenden Abstand ein. Mashree schrieb es nicht mangelndem Respekt, sondern ihrer Furcht vor dem Termetor zu. Es war verständlich, dass sie sich in seiner Nähe wohler fühlten. Schließlich war Mashree der Held des Resif-Sidera. Er war der Späher.
Die Passage zur Außenwelt war düster, doch sie schreckte Mashree nicht. Schon oft war er hier entlanggegangen, um an seinem Raumschiff zu üben, das hier im Verborgenen stand.
Den Start eines Raumschiffes von der Sonnenseite des Riffs hätten alle raumfahrenden Völker bemerkt. Auf der finsteren Seite herrschten jedoch Ortungsanomalien vor. Das war vermutlich das Werk der Ylors. Doch in dieser Hinsicht gereichte es ihnen zum Vorteil. Die RYDOM verfügte über einen Ortungsschutz und so würden die Ylors den Start zu spät registrieren, um Probleme zu machen.
Die drei Auserwählten passierten die letzte Schleuse und erreichten die Außenstation. Über sich erblickten sie die geschlossene Decke des Hangars. Sie würde sich erst beim Start öffnen. Wachmannschaften, zumeist Harekuul wie er, und sechsarmige, wolfsähnliche Manjor, wie sein Mentor Zigaldor, blickten auf sie herab. In festen Trab näherte sich Mashree der kegelförmigen, zweihundert Meter hohen RYDOM. Roboter in humanoider, buuralischer Form nahmen Haltung an.
In diesem historischen Augenblick nun standen Mashree, Borgelund und Wedyyrk vor dem Schiff. Es war nicht groß, besaß aber Technologie, die wohl sonst nur die Ylors aus alten Tagen kannten, aus jener Zeit, als sie ohne Blutgier waren.
Das Schott öffnete sich. Eine grün wabernde Kuppel baute sich auf. Sie umschloss nicht nur die drei Riffaner, sondern auch ihr Raumschiff. Die Roboter wichen zur Seite. W-XP-SP2 – ein vom Bordrechner gelenkter Roboter – schwebte auf Mashree zu. Sein leuchtend gelbes Auge an dem zweigliedrigen Gestänge, welches auf einer Kuppel mit abgeflachtem Ende ruhte, blinkte unruhig.
»Das Raumschiff ist einsatzbereit, Späher«, meldete W-XP-SP2.
Ihm dafür zu danken, wäre wohl übertrieben gewesen, fand Mashree. Stattdessen ging er ins Raumschiff und verlud sein Gepäck. Borgelund und Wedyyrk taten es ihm nach. Er nutzte die Gelegenheit, um noch einmal auszusteigen. Das Hangartor an der Decke hatte sich inzwischen geöffnet. Mashree beobachtete die Thol-Monde und die spinnwebfeinen Flecken ferner Galaxien über dem Riff. Sie waren wunderschön.
Als erster Rideryone seit Äonen würde er das Riffsystem verlassen, wieder zu den Sternen reisen, um neue Welten zu entdecken. Sein Traum wurde wahr. Er war nur noch wenige Momente von diesem historischen Augenblick entfernt.
»Borgelund, mache alles für den Start bereit.«
Borgelund nickte. Dabei wippte sein Hals im Einklang mit seinen fünf Stielaugen hin und her.
»Endlich ist es soweit. Meine beiden Herzen pochen wild durch den Körper, so aufgeregt bin ich«, sagte Wedyyrk.
»Ich weiß, was du meinst. Für uns alle drei ist das ein großer Moment. Der größte in unserem Leben«, erwiderte Mashree und erteilte den Startbefehl.
Borgelund befolgte die Order. Sanft, kaum spürbar hob die RYDOM vom Boden ab. Sie verließ den künstlich ausgehöhlten Hangar, passierte das Deckentor und stieg langsam empor in die Dunkelheit des Resif-Sidera.
Schnell entfernte sie sich von Amunrator, der Stadt im Untergrund, die sich im Erdreich dreizehn Kilometer tief und zwanzig Kilometer breit erstreckte. Amunrator war über Jahre hinweg seine Heimat gewesen. Seit Ewigkeiten war er nicht mehr durch die Wälder von Harekuun gestreift oder über die üppigen Steppen galoppiert. Auch die Weißen Türme von Ajinahstadt hatte er während seiner Ausbildung nicht mehr erblickt. Kein Tageslicht. Amunrator war gewiss schön, doch es war eine Stadt in der Unterwelt. Ohne die zwei Sonnen, die das Riff in ihr Licht tauchten. Es war beklemmend, so wie die Schattenseite, auf der ewige Nacht herrschte.
Doch Amunrator war auch nicht unbedingt als Stadt gedacht, an der sich die Bürger Rideryons erfreuen sollten. Gewaltige Anlagen füllten den Großteil der Fläche. Es war hauptsächlich ein Hort für Wissenschaftler, Militärs und die alten Weisen, denen die Geheimnisse des Resif-Sideras vertraut waren. Ein normaler Rideryone machte sich doch gar keine Gedanken über seine Bestimmung und Existenz, wohin das Resif-Sidera flog, wieso die Dinge so waren, wie sie nun einmal waren.
Das war der Wehmutstropfen für Mashree. Nicht alle Rideryonen würden seine Heldentaten erfahren. Unzählige Völker lebten in Primitivität. Sie würden den Kulturaustausch nicht mitbekommen. Mashree würde ihnen unbekannt bleiben. Welch eine Schande!
Der Späher sah auf Rideryon hinab. Auf einen kleinen Bereich, denn Rideryon war so gigantisch, dass es eine Weile dauern würde, bis sie es zur Gänze aus dem Weltall betrachten konnten. W-XP-SP2 nahm seine Position als Hauptrechner in der Kommandozentrale ein. Er verband sich mit dem Schiffsnetzwerk und kontrollierte fortan den gesamten Rechnerverbund an Bord.
Die Ylors griffen nicht ein. Sie waren die einzigen, die den Start der RYDOM hätte stoppen können. Der Legende nach könnten sie das gesamte Rideryon und alle achttausend Monde von Thol beherrschen, doch sie begnügten sich mit der dunklen Seite und beschränkten sich auf Beutezüge, Jagdsport und Nahrungsjagd auf der Sonnenseite. Ihre Beweggründe waren schwer zu verstehen.
Nun umflogen sie die Kante. Die Sonnenseite kam in Sicht. Die drei erblickten den Berg Keshruuv und die Lavaregion drumherum, die feurig rot glühte, auch von weitester Ferne sichtbar. Schnell entfernten sie sich: Das Rideryon war einfach zu groß, um noch einzelne Punkte auf der riesigen, endlosen Landfläche lange Zeit ausmachen zu können.
Der Flug durch das Resif-Sidera dauerte nicht lang. Mit Unterlichtgeschwindigkeit streifte die RYDOM an einigen Thol-Monden vorbei und verließ schließlich das Resif-Sidera. Vor ihr lag die unbekannte Spiralgalaxie.
»W-XP-SP2, gib mir die Daten dieser neuen Welt.«
Sofort baute sich ein Hologramm vor Mashree auf. Die Spiralgalaxie war nur eine aus dem großen Galaxienverbund in diesem Sektor. Schon bald würden sie dort sein. Mashree versuchte wieder einmal den Namen dieser Galaxie auszusprechen. In ihrer Sprache war die Bezeichnung einfach, doch in der fremden Sprache der Einwohner klang der Name immer noch seltsam für ihn. Erneut versuchte er es: »Sm Sm … Sum Sum …« Noch einmal probierte er es. Diese Wesen verwendeten eine ganze andere Sprachform, als die Riffaner. Doch schließlich sprach er den Namen der neuen Welt einwandfrei aus: »Siom Som!«
Inspektion
19. Dezember 1306 NGZ, Fort Wolfenstein, 1337 Lichtjahre vom Sternenportal der Lokalen Gruppe
Dichter Nebel zog über die dunkelgrünen Wiesen. Mit bloßem Auge sah man höchstens fünfzig Meter weit, doch dank seiner Anzeige am Pikosyn überblickte Orlando de la Siniestro das gesamte Terrain. Er gehörte zu den wenigen, dessen Ortung nicht gestört war. Für die Infanteriegruppen im Tal war es anders. Sie wussten nicht, was sie im Dunst des Nebels erwartete.
Eine Kompanie des Quarteriums und eine Kompanie der Liga Freier Terraner. Seite an Seite übten sie für den Ernstfall. Dieser würde eintreten, sobald die tausend Schiffe MODRORs einen Angriff starteten. Knapp fünftausend Schiffe der LFT und ihrer Verbündeten sowie fünftausend Schiffe des Quarteriums schützten das Portal und die drei Raumstationen vor einem Übergriff der Flotte MODRORs.
Orlando war nicht wohl, wenn er überlegte, dass diese zehntausend Schiffe vielleicht gar nicht ausreichten, um den Verband zu stoppen. Sie wussten nichts über die Technologie der Raumschiffe der Dscherr’Urk. Zwar besaßen die LFT und Cartwheel seit 1299 NGZ Aufzeichnungen über die barymische Technologie, doch die waren nun auch schon sieben Jahre alt. Die Einheiten MODRORs hatten sich weiterentwickelt.
Der Sohn des Emperadors blickte auf das Tal hinab. Bedächtig und unbeirrbar marschierten die beiden Kompanien mit je hundert Mann durch das Feld, sicherten die Flanken und suchten nach möglichen Feinden.
Orlando registrierte zwei Männer neben sich. Es waren die Einsatzleiter der beiden Kompanien. Oberst Wolf Linker, neuer Kommandant der Eliteeinheit »Division 503. Tahera« und sein LFT-Gegenstück, Major Thed Waldherr. Während Waldherrs 777. Raumeingreifdivision nur wenige Kriegseinsätze hinter sich hatte, war die 503. aus Veteranen des Estartu- und M 87-Feldzuges zusammengestellt worden.
Orly konnte Linker nicht leiden. Der adrett gekleidete Offizier gehörte zum Stab von Alcanar Benington, einem der brutalsten Generäle in der Quarterialen Armee. Als Ausbilder am Redhorse Point hatte er sich mühevoll hochgearbeitet, musste dann einige Degradierungen über sich ergehen lassen. Schließlich fasste er in der Quarterialen Armee Fuß und war nun Generaloberst, aufgrund seiner Verdienste in Siom Som und M 87. Offiziell ein Held – in Orlandos Augen war er ein größenwahnsinniger Schlächter. Doch ausgerechnet seine Schwester Stephanie und damit auch wohl notgedrungen ihr Verlobter Toran Ebur hatten den ehrgeizigen Benington seit Jahren protegiert.
Schweigend beobachteten Linker, Waldherr und Orlando den Angriff der Roboter. Natürlich wurde niemand wirklich verletzt, die Maschinen feuerten mit Paralysestrahlern. Weder der dort unten kommandierende Major Henner von Herker, noch Captain Daniel Ellory ahnten, dass die Roboter sich im Erdboden eingegraben hatten und nun wie Pilze aus dem Boden schossen. Beide Kompanien wurden völlig überrascht und traten den Rückzug an.
Orlando las auf dem kleinen Display seines Pikosyns die Daten des Angriffes ab. Sie waren erschreckend. Dreißig fiktive Tote, zwanzig Verletzte. 25 Prozent der Truppe waren nach wenigen Minuten außer Gefecht. Orlando zeigte Major Waldherr und Oberst Linker die Daten. Beide schwiegen sich aus.
»Das ist inakzeptabel!«
Benington! Orlando fragte sich, wo der plötzlich herkam. Seine Anwesenheit war ihm nicht sonderlich angenehm.
»Sir, ich bitte mich für dieses Fehlverhalten meiner Soldaten zu entschuldigen. Offenbar nehmen sie eine Übung nicht so ernst.« Benington grinste überheblich. Orlando hasste dieses Lächeln. »Im Krieg haben sie sich als hervorragende Kämpfer ausgezeichnet, Sir!«
»Nun, vielleicht sind die Männer etwas kriegsmüde. Diese Niederlage wird ihnen eine Lektion sein. Das nächste Mal wird es besser«, meinte Orlando.
Beningtons Lächeln blieb.
»Ich werde dafür Sorge tragen, Sir!«
»Sicherlich. Ich hörte, Sie kommen gerade aus M 87? Wie ist die Lage?«
»Monol steht kurz vor der Eroberung. Eine Frage von Tagen. Ich werde nicht lange hier weilen, muss bald zurück an die Front.«
»Nun denn. Auch die LFT wird ihren Männern den Ernst dieser Übung näherbringen. Ich bin davon überzeugt, dass Major Will Dean und Oberleutnant Scorbit das hinkriegen.«
»Remus Scorbit, Sir?«, fragte Benington.
Major Waldherr nickte.
»Die Veteranen Scorbit und Dean trainieren mit der 777. Raumeingreifdivision. Vielleicht kann ich sie davon überzeugen, ein fester Bestandteil in der Führung dieser Truppe zu werden. Obgleich die Interessen beider woanders liegen. Sie möchten für den Kriegseinsatz bereit sein.«
Beningtons Lächeln gefror. Er wirkte auf Orlando nun noch unsympathischer.
»Kennen Sie Remus Scorbit, Generaloberst?«, wollte Orly schließlich wissen.
»Ja, Sir! Er diente zusammen mit dem verräterischen Jonathan Andrews am Redhorse Point. Ich war sein Ausbilder. Außerdem waren sie während der Krise auf Lingus.«
»Nun, ob Jonathan Andrews ein Verräter ist, weiß ich nicht. Wir kämpfen eben auf unterschiedlichen Seiten. Ich schätze ihn jedoch sehr«, erwiderte Orlando.
»Die beiden haben stets für Ärger gesorgt, Sir«, meinte Benington. »Keine guten Soldaten. Sie sollten ein Auge auf Scorbit haben, Major Waldherr.«
Der schnauzbärtige Terraner nickte und warf Benington einen seltsamen Blick zu.
Der Generaloberst salutierte und verabschiedete sich. Oberst Linker folgte ihm wie ein Hund bei Fuß. Orlando war nicht stolz auf diese beiden Offiziere des Quarteriums. Sie standen nicht für seine Ideale und auch nicht für die seines Vaters. Manchmal fragte sich Orlando, ob alle Entwicklungen innerhalb des Reiches richtig waren. Ihm stand es nicht zu, darüber offen zu sprechen. Absolute Unterstützung war eine Frage der Ehre und des Anstands gegenüber seinem geliebten Vater. Niemals würde sich Orlando offen oder hinter dessen Rücken gegen ihn wenden, das war für ihn undenkbar. Er liebte und verehrte Don Philippe de la Siniestro, der nicht sein leiblicher Vater war, doch an dem er hing, wie man einen Vater nur lieben konnte. Kritik, so empfand er, stand ihm nicht zu. Und wenn, dann höchstens in einem Vieraugengespräch.
Das Nachrichtensymbol auf Orlys Pikosyn leuchtete auf. Er aktivierte die Mail. Sie war von seiner Schwester Brettany.
Das Fest der Liebe
Liebster Orly,
die Vorbereitungen für das Fest sind fast fertig. Vater möchte wissen, wann du zurückkehrst. Perry Rhodan und die anderen werden am 22. Dezember ankommen.
Herzliche Grüße
Deine Schwester Brettany
Orlando schmunzelte, wenn er an seine engelsgleiche Schwester dachte. Brett war die gute Seele der Familie. Seit rund acht Jahren lebten sie nun bei ihrem – nein, Orly weigerte sich, ihn als Ziehvater zu bezeichnen. Don Philippe de la Siniestro war ihr Vater! Wer denn sonst? Rund acht Jahre lebten sie nun in Cartwheel, als Kinder des bedeutendsten Mannes dieser Galaxis. Es war eine Ehre. Orlando hatte es bis zum Admiral gebracht. Er war Kommandant der I. Terranischen Flotte, einer der vier großen Flotten des Quarteriums. Das in ihn gelegte Vertrauen erfüllte ihn mit Stolz.
Er durchdachte Bretts Nachricht. Sie hatte recht, es wurde Zeit, nach Paxus zu fliegen, Vorbereitungen zu treffen. Sein Vater hatte Perry Rhodan, seinen Sohn Michael, Reginald Bull und Gucky zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier mit den de la Siniestros eingeladen. Ihn trieb die Hoffnung auf einen friedlichen Dialog zwischen den beiden Nationen der Menschheit. Orlando fand diese Geste edel. Sie zeigte, dass sein Vater – trotz aller Gerüchte – keinen Krieg mit der Liga Freier Terraner wollte. Im Gegenteil. Sie arbeiteten sogar am Sternenportal der Lokalen Gruppe zusammen. Sein Vater wollte den Frieden.
Alles deutete auf eine Entspannung hin. Und wenn erst einmal der Krieg in den estartischen Galaxien und M 87 beendet war, dann würde es keine Reibereien mehr zwischen der LFT und dem Quarterium geben. Daher war dieses Fest wichtig, so ungewöhnlich es auch war. Diese Einladung war beispiellos und deshalb so besonders. Rhodan und de la Siniestro feierten zusammen das Fest der Liebe.
Weihnachten war ein traditionelles terranisches Fest, doch sein Sinn, oder besser gesagt, sein Geist war längst auf viele Kulturen übergesprungen. In der LFT galten trotz verschiedener Glaubensrichtungen der 24. bis 26. Dezember als allgemeine Feiertage. Jedes Volk feierte das uralte Fest auf seine Art, hatte die eigenen Bräuche und den eigenen Glauben mit dem Fest der Liebe verbunden. Selbst die Akonen und sogar manche arkonidische Kolonisten feierten Weihnachten. Andererseits gab es viele Arkoniden, die das Fest strikt ablehnten und es als barbarisch bezeichneten.
Nun, Orly gehörte nicht zu den Kritikern. Er freute sich auf das Familienfest, auch wenn er sich selbst gerade zu Weihnachten eine Frau an seiner Seite gewünscht hatte. Er fragte sich, ob seine Sehnsucht nach Liebe irgendwann erfüllt werden würde. Und er betete, dass es eines Tages so kam. Dass die Richtige kam. Die Frau seines Herzens.
Alte Freundschaften und neue Freunde
Einige Besorgungen standen an, ehe er aufbrach. Orlandos Gleiter erreichte das Zentrum von Fort Wolfenstein. Hier lebten knapp zehntausend Männer und Frauen. Es gab Restaurants, Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen, natürlich nur für die Familien der Soldaten. Viele nutzten die Abwechslung vom Dienst auf den drei Raumstationen und verbrachten ihre dienstfreie Zeit auf dem Stützpunkt.
Buntes Leben tummelte sich auf dieser Welt. Orlando war immer wieder erstaunt, dass Menschen und Extraterrestrier hier harmonisch zusammenlebten. Es gab keine Unterschiede, genauso wie auf Terra. Die Lebensweise im Quarterium unterschied sich davon. Dort war der Mensch die Herrenrasse und andere Rassen hatten sich ihm unterzuordnen. Manchmal war sich Orly nicht sicher, ob dies richtig war. Natürlich war er fest davon überzeugt, dass der Mensch allen anderen Rassen überlegen war. Perfekter, intelligenter und vor allem moralisch überlegen. Außerdem war die Menschheit seine Rasse und er liebte sie. Doch Orlando weigerte sich, die Extraterrestrier als Abschaum anzusehen. Sie konnten ja nichts dafür, waren eher wie Kinder oder prachtvolle Tiere. Man musste sie gut behandeln, so wie man auch seine Pferde gut behandelte, hegte und pflegte.
Doch abgesehen von der noch immer kontroversen Behandlung der Nichtmenschlichen, war das Quarterium ein starkes und gerechtes Imperium, das die Menschheit vereinte, besser, als Perry Rhodan es je geschafft hatte.
Sein Vater hatte es geschafft, Terraner, Arkoniden und deren Kolonisten zu vereinen. Selbst die Akonen und Saggittonen gehörten nun zu ihnen. Jedes Volk lebte in Harmonie und unter Wahrung der eigenen Kultur. Sie strebten gemeinsam in eine bessere Zukunft, fernab von Korruption und Dekadenz. Das alles hatte Cartwheel seinem Vater zu verdanken. Die Kriege waren bedauerlich und durch die Uneinsichtigkeit der alten Führungsclique verursacht, die ihre korrupte Macht behaupten wollten, doch sein Vater war nicht schuld daran. Überhaupt war er, als Sohn des Emperadors, seinem Vater und dem Reich verpflichtet. Je eher der Krieg vorbei war, desto besser.
Orlando bemerkte, dass eine Frau in einer Ecke stand und anscheinend von einem grobschlächtigen Kerl belästigt wurde. Er landete den Gleiter und stieg aus. Beim genauen Hinsehen erkannte er Uthe Scorbit, die ehemalige Sozialministerin des Terrablocks.
Orlando eilte hin.
»Frau Scorbit, ist bei Ihnen alles in Ordnung?«
Sie sah ihn an und da war es um Orlando geschehen. Ihr Blick faszinierte ihn. Sein Herz schlug höher. Wieso hatte er früher nicht so für sie gefühlt? Schnell riss er sich zusammen und konzentrierte sich auf den Halunken vor ihr.
»Nun, die… dieser Mann möchte mir seine Dienste anbieten. Aber ich will nicht.«
»Dann verschwinden Sie besser!«
Der Typ starrte Orlando an. Er war einen Kopf größer, kahlköpfig und blickte ziemlich finster drein.
»Ich will der Lady doch nur ihre schweren Taschen tragen und ihr einen Drink spendieren.«
Orlando wurde langsam ungeduldig.
»Die Dame wünscht Ihre Gesellschaft nicht. Nun gehen Sie. Sie haben es hier immerhin mit einem Admiral des Quarteriums zu tun.«
Orlando drehte sich um und gab einigen vorbeimarschierenden Grautruppen ein Zeichen. Sofort waren sie bei ihm. Der grimmige Mann drehte sich um und musterte die Soldaten. Dann lächelte er verlegen.
»So war das nicht gemeint.«
Er entfernte sich so rasch er konnte. Uthe Scorbit lächelte Orlando an. Wieder fühlte er sich im siebten Himmel. Ihm war schon früher ihre Schönheit aufgefallen, doch etwas war geschehen, so dass er plötzlich nur sie sah. Hatte er sich verliebt?
»Ich danke Ihnen, Orlando. Wer weiß, was der Typ noch mit mir angestellt hätte.«
»Wieso sind Sie allein unterwegs? Wo ist ihr Mann?«
»Das müssten Sie doch wissen. Er spielt Soldat für die Liga Freier Terraner. Ich habe das so satt …«
Sie sah auf den Boden, schien das eben Gesagte zu bereuen.
»Ich war hier, um Einkäufe zu machen. Um frische Luft zu atmen, nicht mehr diese künstliche Atmosphäre auf der Raumstation.«
Sie gingen ein Stück durch die Fußgängerzone. Orlando spürte, dass es Uthe nicht gut ging. Aber es stand ihm nicht zu, danach zu fragen. Er versuchte es diplomatisch.
»Das Leben einer Soldatenfrau ist hart. Wieso hat sich Remus Scorbit wieder für das Militär entschieden?«
»Er meint, er kann nicht still dasitzen, während … während das Quarterium alle knechtet.«
Orlando fühlte sich in seiner Ehre gekränkt.
»Ihr Mann – bei allem Respekt – weiß nicht, was er sagt. Das Quarterium ist sicherlich nicht perfekt, doch es ist ein vereintes Reich der Menschheit. Wir haben in Cartwheel erreicht, was in der Milchstraße noch immer ein unerreichbares Ideal darstellt. Meinem Vater ist es zu verdanken, dass der Traum von der Einheit aller lemurischen Völker Realität geworden ist.«
Uthe sah ihn an und lächelte erneut.
»Aber es gehen doch auch bei Ihnen schlimme Dinge vor, Orlando. Oder sind das alles nur Lügen?«
Er wusste nicht, was er darauf sagen sollte.
»Uthe, überzeugen Sie sich doch selbst. Ich lade Sie gerne dazu ein. Im Frühjahr vielleicht? Dann können Sie sich selbst davon überzeugen, was Wahrheit und was Lüge ist!«
»Oh, ich weiß nicht …«
»Auch Brettany würde sich bestimmt freuen. Sie waren doch früher eng befreundet. Auch wir haben frische Luft und Kultur im Quarterium.«
Sie lachte. Orlando war sich sicher, gepunktet zu haben.
»Nun, ich werde es mir überlegen. Sie haben ja etwas bei mir gut, Orly. Schließlich haben Sie mich gerettet. Ich weiß ja, wie ich Sie erreichen kann.«
Orlando bedankte sich. Ihre Reaktion gab ihm Hoffnung. So ungewöhnlich diese Verabredung auch war. Aber er stand dazu. Sie war zwar verheiratet, doch offenbar war ihr Mann mehr damit beschäftigt, das Quarterium zu bekämpfen, als sich um seine liebreizende Frau zu kümmern. Was sie gesagt hatte … Orlando konnte Scorbit nicht mehr leiden. Diese Frau hatte so einer wie er nicht verdient!
»Orlando, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, wie man so schön sagt.«
»Danke, ich werde das Fest mit meiner Familie und unseren Gästen von der LFT verbringen. Den beiden Rhodans, Bull und Gucky.«
»Oh? Das klingt ja nach Entspannung.«
Orlando nickte. Sicher überzeugte sie das von den friedlichen Absichten des Quarteriums.
»Ich hoffe es. Es tat gut, Sie wieder zu sehen. Frohe Weihnachten.«
Er riss sich zusammen und drehte sich um. Ohne zurückzublicken, ging er zu seinem Gleiter. Als er drinsaß und sich in Sicherheit wähnte, wagte er, ihr noch einmal hinterher zu starren. Nun lächelte er. Er hatte sie aus einer bedrohlichen Lage gerettet und sie würde vielleicht im Frühjahr zu Besuch kommen. Uthe war eine Frau von Klasse und Format. Sie würde zu ihm passen. Eigentlich war er überzeugt davon. Ihr Platz war an seiner Seite. Es gab nur noch das Problem mit Remus Scorbit, aber das würde sich irgendwie lösen. Er würde einen Weg finden.
Der Sohn des Emperadors erledigte seine Besorgungen, so schnell es ging. Seine Gedanken waren bei Uthe. Dann flog er mit dem Gleiter zu seiner Raumfähre. Er machte sich auf den Weg nach Paxus, zurück zu seiner Familie.
Dem Schicksal auf die Beine helfen
»Was willst du, nackte Kreatur?«
Ich war nicht nackt. Ich trug meinen Hut. Doch der Ylors musterte mich abfällig, wohl unentschieden, ob er einen Happen von mir nehmen oder sich angewidert abwenden sollte.
»Ich möchte mit deinem Herrn und Meister sprechen. Mit dem Fürsten höchstpersönlich.«
Der Ylors verzog das braune, ledrige Gesicht. Finster fletschte er die dolchscharfen Zähne. Besonders die langen Eckzähne blitzten scharf und drohend, als warteten sie nur darauf, sich genüsslich in meinen Hals zu schlagen.
»Wieso sollte ich dem Fürsten einen nackten, tätowierten Husaaven melden?«
Ich lachte und breitete die Arme aus, lachte und schwang mit den Hüften und dem Gemächt. Der Ylors wich einen Schritt zurück. Ich zwinkerte ihm zu. Er war zwar von mächtiger Statur, doch kein Reinblütiger. Keiner der Alten, wie der Fürst. Es war ein junger Ylors, der offenbar noch nicht im kollektiven Gedankenaustausch stand. Denn er bediente ein kleines Sprechgerät und hielt Rücksprache mit dem Kommandanten des Postens.
Der Fürst lebte mehrere Millionen Kilometer von hier entfernt. Es dauerte schier endlos, bis Antwort kam. Ich wurde ungeduldig und sprach: »Freund, sage dem Fürsten, ein Ewiges Gefängnis liege in der Galaxie Siom Som.«
»Was?«
Der Ylors verstand meine Worte nicht, doch ich trug ihm auf, sie wörtlich an den Fürsten zu übermitteln. Und es geschah, wie ich erwartet hatte. Jetzt ging es schnell. Der Ylors führte mich über aschigen Boden an trostlosen, blätterlosen Bäumen vorbei zum Posten seines Kommandanten. Alles jenseits des Waldes mit dem Dorf. Der Kommandant eskortierte mich wortlos in den Kommunikationsraum. Ich sah Projektoren und Kameras, die mein Ich aufzeichneten, doch nun stellte sich der Ylors vor mich und deutete auf meinen Beutel mit der Kleidung.
»Anziehen!«
Ich kicherte und streifte Hose und Hemd über.
Dann erschien das Bild des Fürsten von mir. Ganz anders sah er aus, als seine Ylors im toten Wald. Die Haut war weiß, glatt wie ein Kinderpopo. Das wallende, glänzend schwarze Haar war zu einem Zopf gebunden. Nur die großen Augen, die spitzen Ohren und die dolchartigen Eckzähne unterschieden ihn von einem Buuraler. Der Fürst saß auf einem Thron aus rotem Samt.
»Sprich, Prediger!«
»Die Hohepriesterschaft hat den Riffspäher entsandt.«
»Das ist mir bekannt. Er wird Siom Som entdecken und erforschen. Erzähle mir etwas, was mir unbekannt ist.«
Ich lachte und kraulte meinen Bart.
»Heureka«, rief ich. »Heureka, denn seine Rückkehr wird eingeleitet. Ein Ewiges Gefängnis liegt in Siom Som.«
Der Fürst der Ylors erhob sich überrascht.
»Wo?«
»Das Wissen würde dir nichts nutzen, denn kein Ylors könnte das Gefängnis betreten. Es bedarf Wesen mit Reinheit. Tugendhafte Wesen, nicht Diener der Finsternis, Diener des Chaos. Zumindest der Definition nach jene, an denen die Verräter vor Äonen hätten Gefallen finden können.«
»Seit wann sind Hexen und Kahabas tugendhafte Geschöpfe? Oder ein Kosmokrat?«
Der Fürst lächelte abfällig.
»Ich spreche von Bewohnern des Riffs, Herr. Ja, ja, die beste Garantie für einen geläuterten Feind wären tugendhafte Riffaner, nicht wahr? Ich habe welche auserwählt. Sie wissen noch nichts von ihrem Schicksal.«
Der Fürst schwieg und nahm wieder Platz. Er schien Gefallen an meinen Ausführungen zu finden. Ich fuhr fort: »Mächtiger Herr, lasst ein zweites Raumschiff unbehelligt von Amunrator starten. Ich habe alles in die Wege geleitet und schon vor längerer Zeit die Gannel ausgesucht. Während die Tugendhaften ahnungslos sind, habe ich andere instruiert, damit die Dinge ihren Lauf nehmen.«
»Gut, wir werden beobachten. Doch es gibt zwei Gefängnisse.«
»Ich denke, das wird sich finden.«
Der Fürst beendete die Verbindung. Die Ylors ließen mich ziehen. Endlich konnte ich die Kleidung wieder ausziehen und meine Wanderung in ungestörter Nacktheit fortsetzen. Ich streifte durch den Nebel, vorbei an ausgemergelten Gestalten, an Wesen der Nacht, blass, fahl und blind. Und ihnen allen rief ich zu: »Heureka, der Herr wird zurückkehren. Nistant wird zurückkehren!«
Die vier Kleinen aus Amunrator
»Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.«
Secc Grindelwold blickte noch dümmer drein, als sonst. In seinem Gesicht stand Angst. Das grüne Haar wirkte wirrer, als sonst.
»Wieso? Was hast du denn?«
Secc deutete auf Wilzy. Der stets labernde Gannel war ein seltsamer Vertreter ihres Volkes. Klein, grünhaarig, glupschäugig und pummelig, redete er ununterbrochen, ungefragt und dazu noch kompletten Unsinn. Er war bei allen gefürchtet. Denn jene, denen er sich mit watschelndem Gang näherte, um ihnen seine Aufmerksamkeit zu »schenken«, mussten ihn lange Zeit ertragen.
»Wilzy ist auch nur ein Gannel, wie wir alle«, verteidigte ihn Daccle Dessentol.
Beide waren vom Aussehen her eher schlicht und wenig attraktiv für ihre Klassenkameradinnen. Secc hatte sehr viele Sommersprossen. Sein wirres, grellrotes Haar, die hagere Figur waren nichts für Mädchen. Aber auch Daccle mit seinen großen Sehverstärkern, der großen Zinkennase und den kurzen, borstigen blaugrünen Haaren entsprach nicht den gannelschen Schönheitsidealen.
Secc seufzte.
»Ja, schon, abgesehen davon, dass er viel redet und glaubt, wir seien seine Freunde. Wo soll denn das noch enden?«
Wilzy hatte die beiden inzwischen erreicht. Aus seinen Sehverstärkern blickte er sie fragend an und seufzte erst einmal.
»Tja, tja. Und sonst?«
Secc verdrehte die Augen. Daccle stieß ihn an. Er sollte Wilzy nicht von vornherein das Gefühl geben, total unerwünscht zu sein.
»Uns geht … es gut«, antwortete Daccle. »Und dir? Alles im Licht der Sonnen?«
Innerlich seufzte er. Eigentlich wusste Daccle, dass der alte rideryonische Spruch »Alles im Licht der Sonnen« für Wilzy der Anlass sein würde, sein Leid zu klagen. Dabei fragte man dies rein als Floskel. Wenn etwas nicht im Licht der Sonnen war – wenn man es mit der finsteren Schattenseite assoziierte – galt es als übel und schlecht. Und darüber sprach man nicht.
Wilzy fasste sich an den Bauch. Daccle wusste, was kommen würde.
»Nein, mein Herz. Schnief, jammer die heul. Es tut weh. Wie alles in meinem verkorksten Dasein.«
»Dann wollen wir dich nicht weiter beim Leiden stören«, sagte Secc und machte kehrt. Daccle packte seinen Freund am Kragen und riss ihn zurück.
»Hast du den Aufbruch des Spähers verfolgt? Toll, nicht?«
Die Gannel-Kolonie war auf der Schattenseite des Rideryon angesiedelt und lebte in den unterirdischen Anlagen von Amunrator. So waren jene zehntausende Gannel in den Genuss gekommen, den Start der RYDOM mitzuerleben, während die meisten ihres Volkes und der anderen Rideryonen nichts davon mitbekamen, da der Aufbruch im Grunde genommen ja streng geheim war. Nur die Bewohner der unterirdischen Stadt und vermutlich die Ylors wussten davon. Wann der Hohepriester Zigaldor, der Anführer all jener Rideryonen, die sich der Gemeinschaft bewusst waren, die Öffentlichkeit informieren würde, stand ganz offenkundig in den Sternen.
Wilzy nickte.
»Ja, habe ich. Ich habe ganz exklusiv auf dem Sender Ridervision 50012 mit einer speziellen Kamera das besondere Ereignis verfolgt. Damit habe ich euch einiges voraus, auch wenn ich mich natürlich nicht in den Vordergrund stellen möchte. Trotz Geldnot habe ich mir nämlich ein Abo-Paket von Ridervision 50012 gesichert und kann damit sehr viel mehr sehen, als die Zuschauer der öffentlichen Sender. So auch die Begegnung mit dem Termetor. Mashree hat das souverän gelöst.«
»Aha …«, meinte Daccle nur.
Allein diese Stadt besaß viele speziell codierte TV-Sender. Denn aus rechtlichen Gründen durften nur die Bewohner in einem Umkreis von dreitausend Kilometern die Sender empfangen. Und auch das natürlich nur, wenn sie für das Abo bezahlten. Die Idee stammte von Hamamesch und Persy, deren Artgenossen auch den Sender leiteten.
»Soll ich euch noch davon erzählen, was Ridervision 50012 sonst noch so zu bieten hat?«, fragte Wilzy. Er nahm seine Brille ab, um sie zu reinigen. Daccle fiel zum ersten Mal seine recht schuppige Haut auf. Eigentlich ungewöhnlich in seinem Volk. Zeugte von einem Mangel an Reinheit.
Secc tippte Daccle an.
»Da kommt schon die nächste Nervensäge.«
Er zeigte auf ein Mädchen mit langen, struppigen blauen Haaren und einer Stupsnase. Wie immer trug sie die besten Kleider. Sie konnte es sich leisten, da ihre Familie reich war. Einflussreiche Beamte im rideryonischen Ordnungsamt von Amunrator. Es hieß, sie würden sogar Nistant einen Strafzettel ausstellen, wenn er eine Widrigkeit begehen würde. Natürlich würde das niemals jemand herausfinden, denn der Erbauer des Riffs war seit Jahrmillionen Chrons tot.
Lariza Bargelsgrund hatte die Gruppe erreicht.
»Habt ihr schon die Aufgabe gelöst?«
»Welche Aufgabe?«, fragte Secc verstört.
»Na, die von Lehrer Snaffrull. Immerhin geht der Unterricht gleich weiter. Hallo, wo lebt ihr denn?«
Daccle sah verlegen auf den Boden. Das hatte er ganz vergessen. Die Aufregung um Mashrees Abflug war zu groß gewesen. Alles andere war ihm sekundär erschienen. Natürlich auch die Aufgabe des stets übel gelaunten Snaffrull. Schlecht, denn der kopflose Dychoo wurde immer so aggressiv.
»Ach, seufz und jammer. Ich habe wieder Herzweh. Ich glaube, ich bin krank und melde mich vom Unterricht ab. Dann fragt Snaffrull auch nicht nach der Aufgabe.«
»Wilzy Wltschwak! So wirst du nie etwas aus dir machen«, rügte Lariza ihn.
»Bist du meine Mama? Wohl kaum. Aber lästert nur über mein verkümmertes Leben. Mein arg gebeuteltes Schicksal in Pein und Schmerz. Was wisst ihr von der Mühsal und den Höllenqualen meines Daseins? Gar nichts. Vielleicht habe ich Glück und auf dem Weg zum Arzt werde ich überfahren oder von Termetoren getötet. Dann ist das Leid endlich vorbei und keiner wird eine Träne um mich weinen. Ich werde ein leeres, kaltes und einsames Grab bekommen, irgendwo fern aller Gannalen, fern aller Freunde, auf der Schattenseite …«
»Halt die Klappe!«, riefen Secc und Lariza.
In diesem Moment ertönte das Signal. Die Pause war vorbei. Daccle bekam nun auch Herzflattern, wenn er an den Wutausbruch seines Lehrers dachte. Vielleicht gab es aber noch Hoffnung.
»Lariza, du hast doch bestimmt die Lösung. Kannst du uns die kurz erklären?«
Sie seufzte und sah die drei Jungs mit einer Mischung aus Überheblichkeit und Mitleid an. Natürlich musste sie wieder die kluge Beamtentochter spielen. Besonders Secc nervte das Gehabe, da seine Eltern nur Mechaniker waren. Daccles Vater – seine Mutter war bereits tot – war Logistiker. Lariza hatte sich nie direkt über die Berufe der anderen Eltern lustig gemacht, doch sie überbewertete in Gesprächen stets den ihrer Eltern. Dabei waren sie nun auch keine hochrangigen Spezialisten. Aber Lariza wollte Wissenschaftlerin werden, Raumfahrerin im wissenschaftlichen Bereich, und deshalb wollte sie ihre Intelligenz zeigen. Bei Daccle kam das nicht an: Er fand Lariza an sich ja sehr nett, doch heute war sie wieder so eingebildet.
»Selbst wenn ich wollte, begreift ihr wohl kaum so schnell, wovon die vier Thermodynamischen Sätze handeln, oder?«
»So also lautete die Aufgabe«, erinnerte sich Secc gedehnt.
Lariza verdrehte die Augen und zog von dannen. Zögerlich folgten ihr die drei. Daccle hatte eigentlich immer gute Noten, doch ebenso viele Tadel und Einträge aufgrund seiner etwas leichtfertigen Auslegung der Schulregeln und seines mangelnden Lernverhaltens. Er verstand aber auch nicht, wieso sie an so einem Tag – an dem ein Späher aufbrach – zur Schule mussten. Das war doch ein Feiertag. Die Miskatoor-Feen arbeiteten heute nicht, ihre Kinder gingen auch nicht zur Schule. Genauso die Manjor und Vessyl. Aber Dychoo und Gannel mussten natürlich vorbildlich arbeiten. Es wurde auch erwartet, dass alle Generationen sich in den Dienst des Kulturaustausches stellen würden. Natürlich stand es den Bewohnern Amunrators frei, die Unterwelt zu verlassen, doch es wurde nicht gern gesehen. Dabei wirkten ja nur sehr wenige Generationen wirklich an einem Austausch mit. Es verging viel Zeit zwischen den Besuchen in anderen Galaxien.
Darüber hinaus teilte er insgeheim Larizas Wunsch. Daccle würde gern mit Mashree tauschen. Er malte sich aus, wie es wäre, wenn Secc, Lariza und er anstatt des Harekuul und seiner beiden Begleiter auf der RYDOM wären. Doch das war nur ein Traum. Er würde hier versauern in der dunklen Stadt Amunrator und vermutlich auf den Spuren seines Vaters als Mechaniker seine Tage verbringen.
Mürrisch marschierte er in die Klasse und lümmelte sich auf den viel zu harten Stuhl. Wenig später stapfte Snaffrull ins Zimmer.
Wie lautet der erste Satz der Thermodynamik?
Die telepathische Stimme schmerzte in Daccles Kopf. Er hatte das Gefühl, als sei die Frage direkt an ihn gerichtet worden.
Nun? Secc Grindelwold?
Secc zuckte zusammen.
»Ich?«
Snaffrull wartete mit aufmerksamem Schweigen. Er teilte sich nie einem Einzelnen mit, sondern nahm immer mit der ganzen Klasse telepathischen Kontakt auf. Daccle betrachtete seinen Lehrer. Drei Beine, ein stämmiger Torso mit vier Armen. Dort, wo bei den meisten Wesen der Kopf war, gab es nichts. Die Augen befanden sich, wo Daccle den Brustkorb hatte. Snaffrull sah ein bisschen aus wie eine weibliche Gannel, doch was wie Brüste wirkte, waren seine Augen.
Einen Mund besaß ein Dychoo nicht. Ohren auch nicht. Er hatte ja keinen Kopf. Die Atmung erfolgte über den Rücken. Äußerungen nahm er telepathisch wahr. Dychoo waren ein seltsames Volk. Ruhige, intelligente Vertreter der Gemeinschaft des Resif-Sidera. Unfreundlich und neunmalklug. Dychoo waren Einzelgänger, sie scheuten sogar die Gesellschaft ihrer Artgenossen. Anderen Spezies gingen sie noch gründlicher aus dem Weg.
Für einen Dychoo war der Beruf des Lehrers eine besondere Herausforderung. Grundsätzlich mochte es keiner von ihnen, sich zahlreichen Andersartigen gegenüberstehen oder -sitzen zu sehen und mit ihnen Zeit verbringen zu müssen. Entsprechend mürrisch war der Unterrichtende. Daccle fragte sich, wieso der überhaupt den Lehrerberuf ergriffen hatte, statt ein einsiedlerischer Jäger oder dergleichen zu werden.
Daccle Dessentol, hast du auch etwas zum Unterricht der Physik beizutragen? Wir haben jetzt weder Biologie noch Ethik. Die Eigenschaften der Dychoo interessieren niemanden.
Autsch! Daccle hatte vergessen, dass der Telepath natürlich seine Gedanken lesen konnten. Nicht die aller Lebewesen, doch junge Gannel waren noch nicht in der Lage, einen Mentalblock zu errichten. Mist!
Also Secc, der erste Satz!
Die Brüste, nein, die Augen von Snaffrull vergrößerten sich. Sie wurden spitz und ziemlich lang.
Secc wurde bleich. Benommen starrte er auf die beweglichen Sinnesorgane des Dychoo, stotterte herum und wusste die Antwort nicht.
Noch jemand, der nicht gelernt hat? Daccle? Wilzy?
Es war besser, ehrlich zu sein. Sie konnten dem Dychoo sowieso nichts vormachen. Der Lehrer las alles in ihren Gedanken. Immerhin meldete Lariza sich fleißig. Sie wusste natürlich die Antwort. Snaffrull nahm sie auch dran.
»Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik ist der Satz der Energieerhaltung: Jedes System besitzt eine extensive Zustandsgröße innerer Energie. Diese kann sich nur durch den Transport von Energie in Form von Arbeit und Wärme über die Grenze des Systems ändern.
Die Energie eines abgeschlossenen Systems bleibt unverändert. Verschiedene Energieformen können sich demnach ineinander umwandeln, aber Energie kann weder aus dem Nichts erzeugt werden noch vernichtet werden. Deshalb ist ein Perpetuum Mobile erster Art unmöglich.«
Gut, Lariza Bargelsgrund. Schlecht, Daccle Dessentol, Secc Grindelwold und Wilzy Wltschwak! Ihr seid interessiert an Mashree, dem Späher, richtig? Doch der kennt die Thermodynamik. Ihr werdet nie so werden, wie er. Ihr endet als Bettler und Hausierer in einer öden, primitiven Region des Rideryon! Dann könnt ihr ungestört weiterträumen.
Daccle wäre vor Scham am liebsten im Erdboden versunken. Der Unterricht ging die ganze Zeit so weiter. Sie hatten keine Ahnung und Snaffrull hackte auf ihnen herum. Als endlich die Sirene ertönte, bekamen die drei noch eine zusätzliche Aufgabe über die drei freien Tage. Sie sollten einen Artikel über Entropie schreiben, über ihren Zusammenhang mit der Thermodynamik.
Das bedeutete wohl drei freie Tage vor dem Rechner und haufenweise physikalische Formeln, die weder Secc noch Daccle verstanden. Sie hatten nur eine Hoffnung: Lariza!
*
»Nein! Ich habe etwas Besseres zu tun, als die ganzen Hola-Tage mit euch zu lernen!«
»Was denn? Alleine zu lernen?«, fragte Secc zynisch.
Lariza blieb stehen.
»Secc Grindelwold, du solltest lieber dankbar sein, dass ich dir schon so oft geholfen habe. Ohne mich wärst du schon dreimal sitzen geblieben. Aber was habe ich von dir als Lohn erhalten?«
Secc schwieg. Daccle musste lachen. Lariza hatte schon recht. Sie alle hatten ihr viel zu verdanken.
»Ich habe dich mal gefragt, ob wir uns einen Film zu zweit anschauen wollen. Aber du hast abgelehnt«, sagte Wilzy seufzend. »Ich bin dir sicherlich zu fett und zu hässlich. Ein abstoßendes Getier, gemieden von allen Mädchen auf dem Rideryon. Ein Monster, ein Biest …«
»Jetzt ist gut. Ich habe nur nicht angenommen, weil ich sowieso nichts vom Film mitbekommen hätte. Du hättest ja die ganze Zeit geredet, Wilzy Wltschwak!«
Wilzy starrte auf den Boden. Dann fasste er sich an den Bauch und verzog das Gesicht zu einer leidvollen Grimasse.
»Ich habe eine Idee«, meinte Secc.
»Na das kann ja was werden«, erwiderte Lariza schnippisch.
Secc bedachte sie mit einem bösen Blick.
»Ihr kennt doch den wunderlichen Professor Wackls in der Bergsiedlung? Mein Onkel Rusus kennt den ganz gut. Wackls kann uns bestimmt helfen. Er soll sehr kinderlieb sein.«
Daccle fand die Idee gar nicht so schlecht. Professor Wackls war zwar ein wunderlicher Kauz, aber ein hervorragender Physiker. Er hatte in der Schule sogar mal als Dozent unterrichtet, bevor er in den Ruhestand gegangen war. Er lebte auf Überridd. Das war ein Ort, den viele mieden, weil er so nah an der Oberfläche zur Schattenwelt war. Wackls lebte in einem Observatorium. Er beobachtete die Thol-Monde und Galaxien. Das ging natürlich nur auf Überridd und nicht in den Tiefen von Amunrator. Der Bau eines Teleskopstollens hätte Unsummen verschlungen. Er lebte sehr abgeschieden und ihr Weg führte an Termetoren-Wachen vorbei. Daccle war nicht wohl bei der Sache, aber der konnte ihnen helfen, wenn Lariza nicht wollte.
»Macht doch, was ihr wollt. Wenn ihr auf meine Hilfe keinen Wert legt, kriegt ihr sie auch nicht«, zeterte Lariza und ging.
»Mädchen sind wunderlich«, sinnierte Secc.
Daccle stimmte ihm zu.
»Was meinst du, Wilzy? Wilzy?«
Daccle sah zu ihm herüber. Wilzy reagierte nicht. Er stand in einer Ecke, hatte seinen Kommunikator ausgepackt und tippte wild darauf herum, als sei er allein. Daccle schüttelte den Kopf.
»Falls du mit willst, Wilzy, dann treffen wir uns in drei Zeiteinheiten vor der Schule. Secc, du machst das mit deinem Onkel klar.«
Vorfreude
22. Dezember 1306 NGZ, SOLARIS STATION
»Pah, alles Humbug!«
Perry Rhodan verdrehte die Augen. Wieso musste Bully sich ständig beschweren?
»Das ist wohl die Höhe, dass wir mit diesem Verbrecher unterm Tannenbaum sitzen und Oh Du Fröhliche trällern. Ich weiß immer noch nicht, wieso ich diesem Schwachsinn zugestimmt habe …«
»Weil wir mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier dem Frieden ein Stückchen näherkommen können, Onkel Reginald.«
Diesmal musste Rhodan seinem exzentrischen Sohn zustimmen. Obgleich Mike sich in letzter Zeit einige Frechheiten herausgenommen hatte, die in ihm alte Erinnerungen wachriefen, unangenehme Erinnerungen, die er lieber für immer hätte ruhen lassen. Sein Verhalten, seine ganze Art rief längst vergangene Zeiten wach und schmerzhafte Erinnerungen an Mory und Suzan.
Und heute? Wieder in die Maske des Roi Danton geschlüpft, hatte sein Sohn sowohl seinen eigenen Vater als auch ihre Gegner Cau Thon und die de la Siniestros an der Nase herumgeführt. Mit allen hatte er doppeltes Spiel getrieben. Obwohl seine Schadenfreude wohl irrational war, freute er sich, dass diese Charade für seinen Sohn wohl nicht ganz so glimpflich ablaufen würde. Stephanie, die skandalumwitterte Tochter Siniestros, hatte ihre Krallen nach ihm ausgestreckt und trachtete danach, ihn zu heiraten. Natürlich wollte Mike das nicht, doch Perry gönnte seinem Sohn, dass er sich vor dieser aufdringlichen Person retten musste.
»Michael hat recht. Wenn wir mit den de la Siniestros ein Weihnachtsfest verbringen, können wir in gelöster Atmosphäre über alles reden. Außerdem können wir diese Familie besser studieren. Falls sie unsere Feinde sind, kann das sehr nützlich sein.«
»Das denken die sicher auch«, meinte Bully trotzig und kratzte sich am Hinterkopf.
Perry seufzte. Bully bockte. Aber vielleicht war es auch gut so. Wenn Perry selbst die Situation zu blauäugig einschätzen sollte, war Bully ein wichtiger Gegenpol. Rhodan nahm noch einmal die Einladung. Er hatte sie in Papierform erhalten, als Schriftrolle mit einem Siegel aus Wachs. Es passte bestens zu Emperador de la Siniestro. Am 22. Dezember waren sie zu einem Festbankett auf dem Madrider Königsschloss nach Siniestro eingeladen. Am 23. Dezember sollten sie morgens früh mit der Jacht des Emperadors, der BUTRAGUENO, zur Winterwelt Ves-Som auf der Südseite von Siom Som aufbrechen. Dort hatte der Emperador seit kurzem ein Ferienhaus. Zusammen mit dessen Kindern, dem Posbi Diabolo und Cauthon Despair würden Bully, Mike, Gucky und er eine Woche dort verbringen.
Das waren nicht nur die Weihnachtsfeiertage, sondern auch Silvester und Neujahr. Am 2. Januar war die Rückreise in die Milchstraße geplant. Doch Perry bezweifelte, dass es harmonische Weihnachten geben würde.
Dennoch! Diese Zusammenkunft der aktuell mächtigsten Männer der Menschheit – sah man von Bostich ab, der sicher nicht mitfeiern würde – war eine Chance auf Frieden.
Solche Gelegenheiten ließ Perry Rhodan niemals aus. Er stand auf und blickte auf das Sternenportal, welches immer näher kam. Schon bald würden sie mit der LEIF ERIKSSON hindurch fliegen und Paxus erreichen. Die Zentralwelt Cartwheels war so fern und doch so nah. Auch die Technologie des Sternenportals war bis dato unbekannt. Es war die Technik der höheren Mächte, zu denen DORGON zweifellos gehörte. Die erste Erwähnung fand das Sternenportal in den Erzählungen des Osiris. Demnach hatte der Kosmokrat AMUN vor mehr als einhunderttausend Jahren den Kemeten von der Existenz eines solchen Portals erzählt.
Doch wie lange gab es sie wirklich? Wer hatte sie erbaut? War es DORGON oder waren es Kosmokraten? Wie funktionierten sie? Sie wussten es nicht, obwohl sie diese Technik seit 1285 NGZ benutzten, also seit einundzwanzig Jahren! Alles, was sie wussten, war, dass sie die Koordinaten des Zielortes eingaben, diese als Signal an die Stationen sendeten und beim Durchflug durch das Portal direkt an die Gegenstation gebracht wurden.
Terranische Wissenschaftler zogen Vergleiche mit dem Sonnensechseck. Prinzipiell funktionierte das Sternenportal ähnlich, nur gab es hier keine Sonnen. Woher nahm das Portal die notwendige Energie für die vielen Transporte?
Perry Rhodan fand es müßig, ohne weitere Anhaltspunkte darüber nachzudenken. Sie hatten zurzeit andere Probleme. Zuhause erholte sich die Menschheit von der SEELENQUELL-Zeit und trotzte einem immer stärker werdenden Kristallimperium. Außenpolitisch schrammte die LFT immer nur knapp an einer Katastrophe vorbei. Die Waffenlieferungen an die USO und die saggittonisch-akonische Allianz waren brisant. Sollte das Quarterium je herausfinden, dass die LFT hinter den Lieferungen steckte, würde es sicherlich zum Krieg kommen.
Doch Perry durfte nicht untätig bleiben. So sehr er auch ein Blutvergießen zwischen Menschen ablehnte, wollte er doch den unterdrückten Völkern aus Estartu und Cartwheel helfen. Er hatte ein schlechtes Gewissen, wenn er an den heldenhaften Kampf der Saggittonen dachte, insbesondere ihres Kanzlers Aurec. Trotzdem: Rhodan war verantwortlich für die Liga Freier Terraner. Aurecs Kriegseintritt war moralisch und ethisch korrekt, aber ein schwerer taktischer Fehler seinem eigenen Volk gegenüber. Also konnte Perry ihn nicht unterstützen. Und darin war er konsequent.
Aurec war naiv gewesen, als er den Zusicherungen des Quarteriums Glauben geschenkt hatte. Perry Rhodan wollte diesen Fehler nicht wiederholen. Er wollte nicht irgendwo in der Ferne kämpfen, denn sonst nahm das Kristallimperium Terra im Handstreich. Die Verantwortung für die Bürger der LFT hatte oberste Priorität. Deshalb war ihm eine diplomatische Lösung des Konfliktes so wichtig.
Und das Treffen mit dem Emperador eben hierfür ausschlaggebend.
»Wir erreichen Paxus«, meldete Pearl Ten Wafer, die Kommandantin der LEIF ERIKSSON via Interkom.
Rhodan bemerkte, dass er, versunken in seine Gedanken, den Flug durch das Sternenportal und die Reise durch den Hyperraum über zehn Lichtjahre gar nicht wahrgenommen hatte. Vor ihnen entfaltete sich ein eindrucksvolles Bild. Tausende quarteriale SUPREMO-Raumer kreisten in genau festgelegten Umlaufbahnen um die Hauptwelt des Reiches. Auf bestimmten Routen erreichten und verließen Handels- und Privatraumschiffe den Planeten. Die LEIF ERIKSSON ordnete sich in den Verkehr ein. Zwei Dutzend SUPREMO-D-Raumschiffe eskortierten sie. Das Schiff bekam eine Position im Orbit zugewiesen. Perry Rhodan, Reginald Bull, Gucky und Michael Rhodan würden mit einer Space-Jet nach Siniestro fliegen.
»Nun sind wir da«, sagte Bully gedehnt.
»Ein vertrauter Anblick für mich«, meinte Mike, der sich mal wieder als Roi Danton verkleidet hatte. »Schließlich bin ich hier ein gern gesehener Gast.«
»Als zukünftiger Schwiegersohn des Emperadors?«, lächelte Perry süffisant.
»Würde dir denn Steph als Schwiegertochter gefallen, Paps?«
Rhodans Lächeln gefror. Ein Alptraum! Stephanie gehörte zu dem Schlag Frauen, die er überhaupt nicht leiden konnte. Arrogant, nymphomanisch, gierig und stets nur auf den eigenen Vorteil bedacht.
»Sir, das Gepäck ist bereits verladen. Die Space-Jet steht bereit«, meldete Ten Wafer per Funk. Rhodan bedankte sich höflich und gab Bully und Mike ein Zeichen. Auf dem Weg zum Hangar trafen sie endlich auf Gucky.
»Servus«, grüßte der Mausbiber. »Wird Zeit, dass wir zur Nazi-Weihnachtsfeier aufbrechen.«
Bully stieß einen Pfiff aus. Rhodan versuchte, Guckys Aussage zu überhören.
»Zeige unseren Gastgebern deine Abneigung bitte nicht überdeutlich, Kleiner. Wir sind hier, um Frieden zu erwirken.«
»Du kennst mich doch, Großer. Bully und ich schaukeln das schon mit unserem diplomatischen Feingefühl.«
Michael fing lauthals an zu lachen. Während Gucky einstimmte, starrte Bully die beiden böse an. Er grummelte etwas Unverständliches vor sich hin und hatte es plötzlich eilig, zur Space-Jet zu gelangen.
»Nun, mein Sohn, du wirst bestimmt mit den beiden Töchtern de la Siniestros beschäftigt sein.«
Mike grinste.
»Oui, Monsieur. Ich tendiere aber eher zu Miss Brettany. Sie ist lieblich, hat ein großes Herz und besitzt, ganz im Gegenteil zu ihrer Schwester, die Fähigkeit zu lieben.«
Rhodan schmunzelte.
»Brettany würde ich als Schwiegertochter akzeptieren, mein Junge. Doch sieh dich vor. Wir wissen nicht, wie sich alles entwickeln wird. Liebe zum potentiellen Feind wäre fehl am Platze.«
Mike stemmte die Hände in die Hüften.
»Gib mir bitte keine Ratschläge, Papa! Ich habe schließlich die letzten Monate mit den de la Siniestros verbracht und bin nicht ganz unbeteiligt an diesem Treffen. Also sollte eher ich es sein, der dir Tipps gibt!«
Perry blieb bei diesem kleinen Ausfall seines Sohnes gelassen. Natürlich hatte Mike schon viel über das Quarterium in Erfahrung gebracht und sich offenbar auch das Vertrauen der mächtigsten Familie erschlichen. Perry kannte aber auch seinen Sohn. Mike war ein Romantiker, der sich gern und schnell verliebte. Brettany war eine besondere Frau. Ähnlich wie ihr Bruder Orlando war sie edel. Eine richtige Lady, wie man sie aus Atlans Erzählungen oder aus Geschichtsbüchern kannte. Sie wirkte auf ihn zwar naiv, aber keineswegs dumm. Vielleicht eher zu gutgläubig. Oder war es nur Maske? Rhodan war gespannt, all die de la Siniestros näher kennenzulernen. Auf jeden Fall wusste er auch, dass Michael sich recht schnell in Brettany verlieben konnte. Sollte die ganze Situation jedoch eskalieren und es wirklich zu einem Krieg zwischen der LFT und dem Quarterium kommen, wäre das keine gute Konstellation.
Noch schlimmer wäre jedoch, wenn Stephanies Verführungskünste Erfolg hätten. Perry traute seinem Sohn eine solche Dummheit durchaus zu, zumal er eingeräumt hatte, bereits das Bett mit Siniestros zweifelhafter Tochter geteilt zu haben. Noch immer bezweifelte er die Aufrichtigkeit seines Sohnes in allem, was das Verhältnis zwischen LFT und Quarterium betraf. Doch hier musste er einfach darauf vertrauen, dass sein Sohn das Richtige tat. Es blieb ihm schlicht und einfach keine andere Wahl.
*
Perry musterte seine Begleiter. Bully und er trugen blaue Galauniformen mit den Abzeichen der LFT. Reginald hatte es sich nicht nehmen lassen, seine Uniform standesgemäß mit Orden aus Zeiten des Solaren Imperiums zu schmücken. Michael war wieder als Roi Danton gekleidet. Ein roter Frack über dem blütenweißen Rüschenhemd, ebenso weiße Hosen und schwarze, kniehohe Stiefel. Die langen Haare waren zu einem Zopf geknotet. Immerhin hatte er auf die Schminke und die lächerliche Perücke verzichtet. Es war erst einige Tage her, dass Perry seine Kleidung als Karnevalskostüm bezeichnet hatte. Da war Mike regelrecht ausgerastet. Sein Verhalten war und blieb ihm immer noch absolut unverständlich.
Gucky trug seine gelbe Uniform mit dem roten Streifen in der Mitte. Davon hatte er wohl mehr als dreihundert Ausfertigungen. Gut, dass Perry ein passendes Geschenk für den Mausbiber bereits vor Wochen ausgesucht hatte. Er war gespannt, wie der Ilt darauf reagieren würde. Es war schon erstaunlich, wie sehr der Mausbiber die Riten der Terraner übernommen hatte. Weihnachten, Hanukah, Ashura, Songkrann, Thanksgiving oder auch Halloween – wann immer es etwas zu feiern gab, war der Ilt mit dabei.
Vom Gleiter aus war bereits das prächtige Königsschloss von de la Siniestro zu erkennen. Im fahlen Mondschein wirkte es sogar etwas gruselig. Wie ein Gespensterschloss, fand Rhodan. Er blickte aus dem seitlichen, dreieckigen Fenster. Schnee, so weit das Auge reichte. Darüber konnte sich keiner beschweren: Die Welt Siniestro mit ihren üppigen Wäldern, Tälern und Gebirgsketten war idyllisch.
Sie erinnerte Rhodan an das alte Europa aus dem Mittelalter. Zumindest hatte er es sich so immer vorgestellt. Es gab nur wenig Industrie oder Städte auf Siniestro. Die Nachbarwelt von Mankind war eher ein Ausflugsort für Naturverbundene: Herrenhäuser, Farmen und Ferienanlagen dominierten das naturbelassene Gebiet. Die wirklich einzig hochmoderne Stadt war Isabellaport. Dort befand sich auch der einzige öffentliche Raumhafen des gesamten Planeten.
»Seid ihr bereit für diese illustre Familie?«, fragte Perry schließlich. »Wenn wir uns gut benehmen, können wir vielleicht einen Frieden erwirken. Bedenkt dies.«
Michael verzog die Mundwinkel.
»Was denkst du, was ich seit Monaten hier mache? Doch jetzt rapidement«, er klatschte in die Hände. »Auf ein fröhliches Weihnachtsfest.«
Bully verdrehte die Augen.
»Ja, ganz prächtiges Fest …«
Mike begann plötzlich ein Lied zu pfeifen. Irgendwie kam Perry die Melodie bekannt vor. Und dann, sein Vater konnte es kaum fassen, begann er zu singen.
»Allons enfants de la Patrie, …«
Cauthon Despair
Perry Rhodan, Reginald Bull, Gucky und Roi Danton befanden sich auf dem Weg zu uns. Ihr Gleiter war nur noch wenige hundert Meter vom Schloss entfernt, zumindest nach der Anzeige meines Peilsenders. Es wurde Zeit für die Charade. Als ob das Treffen mit Rhodan irgendetwas brachte. Damit wurden keine Probleme gelöst.
Ich beobachtete die de la Siniestros. Orlando zupfte seine Uniform zurecht, der Emperador saß mit aufgesetztem Lächeln auf seinem Thron und Peter de la Siniestro wies das Personal an, stramm zu stehen. Die beiden Töchter verließen just in diesem Moment ihre Zimmer. Stephanie trug ein enges, schwarzes Kleid mit einem herausstellenden statt verhüllenden Dekolleté und zwei langen und tiefen Beinausschnitten, darunter schwarz glänzende, bis deutlich über die Knie reichende Stiefel. Ihre Schwester Brettany bildete den kompletten Kontrast: Sie trug eine lang herabfließende rote Robe.
»Ich kann es gar nicht erwarten, bis Roi mir um den Hals fällt«, sagte Stephanie und kicherte. »Wenn wir erst einmal Terra beherrschen, werde ich …«
»Steph, was redest du? Wir treffen uns heute mit Perry Rhodan, dem Terranischen Residenten. Er regiert Terra.«
Stephanie betrachtete ihre Schwester mit einem eigentümlich mitleidigen Blick. Dann lachte sie lauthals heraus. Brettany war das sichtlich unangenehm.
»Wie naiv du doch bist! Meine Heirat mit Michael Rhodan wird Perry Rhodans Ende bedeuten. Er wird abdanken und wir werden regieren. Deshalb machen wir das alles doch, Kleines!«
Brettany schüttelte den Kopf.
»Du denkst immer nur an deinen eigenen Vorteil. Liebst du Michael denn überhaupt?«
»Ihn? Nein. Wieso? Ich liebe seine Position und die Möglichkeiten, die er mir und dem Quarterium bietet.«
Stephanie fuhr sich mit der rechten Hand effektvoll durch ihre dunkelblonde Mähne. Sie war zweifellos eine sehr erotische Frau. Sexy, sinnlich, einfach alles, was ein Mann sich physisch wünschte. Doch ihr Herz und ihre Seele waren zutiefst verdorben. Sie hätte eine gute Tochter des Chaos abgegeben.
Brett war das genaue Gegenteil. Sie hatte ein zartes, weiches Gesicht, strahlend blaue Augen und seidene, goldene Locken. Natürlich war auch sie schön. Sie strahlte jedoch keine so aggressive, offene Erotik aus, wie ihre Schwester. Brettany war schüchtern, zurückhaltend. Sie verkörperte die klassische Version einer junge Dame. Ich fand sie weitaus anziehender, als Stephanie.
Brettany sah ihre Schwester traurig an. Offenbar empfand auch sie etwas für Roi Danton. Doch Gefühle zählten in ihrer Welt nicht. Stephanie agierte wie eine Adlige aus alten Zeiten. Sie war ihrem Vater sehr ähnlich, der schließlich aus der Epoche des ausgehenden Absolutismus stammte. Der Emperador hatte den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, die Französische Revolution und Napoleon miterlebt.
Damals hatte man in adligen Kreisen oftmals der Politik wegen geheiratet. Die Prinzessin des einen Landes wurde mit dem Thronfolger einer anderen Nation verheiratet, damit beide Länder enger miteinander verbunden waren. So sollte es wohl auch zwischen Stephanie und Roi Danton laufen. Ich fragte mich jedoch, ob Stephanies Plan in der heutigen Welt aufging. Sie glaubte offenbar, Danton fest in ihren Händen zu halten.
Der Gleiter hielt vor dem Schloss. Das Surren erstarb. Leises Gemurmel, dann öffneten die Diener die große Eingangstür. Perry Rhodan, Reginald Bully, Gucky und Roi Danton betraten den Saal.
»Oh, Roi, Liebster!«, rief Stephanie und eilte die Treppe hinunter. Sie warf sich ihm um den Hals. Brettany warf mir einen verzweifelten Blick zu. Es fiel ihr schwer, ihre Gefühle für Danton zu verbergen.
»Kommen Sie, Brettany. Begrüßen wir die Gäste.«
Mit traurigen Augen nickte sie. Brett wirkte zerbrechlich und weckte in mir Beschützerinstinkte. Sie war wunderschön und so liebenswert. Dieser blonde Engel passte überhaupt nicht in solch eine Familie.
Aus dem Thronsaal des Emperadors kamen die Herren des Hauses, Don Philippe und seine Söhne Orlando und Peter. In gebührendem Abstand folgte Diabolo. Der Posbi und ich betrachteten die überschwängliche Begrüßung aus gebotener Distanz.
»Perry, es freut mich, dass Sie meine Einladung angenommen haben«, begrüßte der Emperador ihn und umarmte Rhodan übertrieben freundlich. »Mein Dank gilt Ihnen allen, meine Herren. Sie sind sicher hungrig.«
Er gab einem Diener, der gekleidet war wie ein Lakai aus dem 18. Jahrhundert, ein Zeichen. Der Mann nickte und begab sich in die Küche. Offenbar wurde aufgedeckt.
»Dann sind wir wohl überflüssig?«, fragte Diabolo.
»Nun, wir werden nicht speisen und nicht trinken. Was sollen wir dort?«
»Uns den ersten Eklat anschauen. Das dürfte sicherlich amüsant werden, Despair …«
Der Sarkasmus des Posbi war unüberhörbar. Er spielte offensichtlich auf Peter oder Stephanie an, die beide ein Talent besaßen, sich daneben zu benehmen. Wenngleich aus verschiedenen Gründen: Steph setzte ihr Verhalten stets mit eiskalter Berechnung ein, sie wollte ihr Gegenüber demütigen. Peter hingegen war ein Idiot durch und durch. Ich verstand es immer noch nicht, wie man diesen Dilettanten zum Oberbefehlshaber des quarterialen Heeres machen konnte. Gott sei Dank war es meinen Generälen und mir gelungen, ihn von wichtigen Entscheidungen fern zu halten.
Ich durfte gar nicht dran denken, wie Peter vorgeschlagen hatte, in einer beispiellosen Militäraktion zehn Millionen Infanteristen mit getarnten Transportern in den Dunklen Himmel zu fliegen und auf Etustar abzuladen, um den Rest der Rebellen zu vernichten. Ob und wie die »getarnten« Transporter dort ankamen und wie sie sich gegen die Wachflotten wehren sollten, war ihm egal. Er kalkulierte Verluste in Millionenhöhe ein.
Wir hatten dem Pockengesicht, wie er von vielen verächtlich genannt wurde, eine kleine »Elitegruppe« zur Verfügung gestellt. Die »Holsteiner« bildeten die Leibwache der kaiserlichen Familie. Peter war den ganzen Tag damit beschäftigt, sie zu drillen. Eine wenig Vertrauen erweckende Gruppe. Sie bestand aus Söldnern, Vorbestraften und ehemaligen Offizieren meiner 501. Division, die ich aufgrund ihrer Brutalität aussortiert hatte.
Oberbefehlshaber war Major Yrek da Mott, ein adliger Arkonide und guter Nachbar der de la Siniestros. Allesamt unsympathische Personen.
Die Gäste und die Gastgeber hatten inzwischen Platz genommen. Aus Höflichkeit setzte ich mich dazu, obwohl ich natürlich nichts aß. Dazu hätte ich meine Maske abnehmen müssen. Das wollte ich nicht. Ich sah zu Brett, die mit glänzenden Augen den funkelnden Weihnachtsbaum betrachtete.
Weitere geladene Gäste erschienen. Finanzminister Michael Shorne, Arbeitsminister Diethar Mykke, die Generäle Mandor da Rohn und Red Sizemore sowie von der LFT Militär-Attaché Henry Portland und Botschafter Lester Slone.
Es verwunderte mich, dass niemand von der Cartwheel Intelligence Protective anwesend war. Offenbar wollte der Emperador den Kontakt mit den Geheimdienstlern vermeiden. Genauso erstaunlich – aber sehr weise – war, dass Jenmuhs nicht an diesem Essen teilnahm.
»Einen Toast«, sprach der Emperador. »Auf einen menschlichen Frieden.«
Die anderen hoben die Gläser. Gucky blieb demonstrativ sitzen, fühlte sich offenbar übergangen. Ich verübelte es ihm nicht. Dieser Trinkspruch war nicht sehr weitsichtig von Emperador de la Siniestro.
»Wie wäre es, wenn wir generell auf den Frieden anstoßen?«, fragte Bully. »Wann werden die Kriege in M 87 und den estartischen Galaxien beendet sein?«
Rhodan räusperte sich. De la Siniestro blickte überrascht drein.
»Sobald alle Gegner besiegt sind«, sagte ich drohend.
Bull sah mich finster an. Er konnte mich nicht leiden. Ich verübelte es ihm nicht.
»Wirtschaftlich gesehen sollte der Krieg bald beendet sein. Dann können wir in den neuen Gebieten gewinnbringenden Handel treiben«, sagte Shorne. »Ich schätze, das Wachstum wird sich deutlich erhöhen. In den neuen Kolonien werden viele Unternehmen ihre Fabriken aufbauen.«
Shorne steckte sich ein Stück blutiges Steak in den Rachen. Genüsslich und mit einem selbstgefälligen Grinsen kaute er darauf herum.
»Und wieso soll das so lukrativ für die Firmen sein?«, wollte Bull wissen.
Shorne lachte.
»Das ist doch klar, Mann, eine volkswirtschaftliche Binsenweisheit. Kaum Lohnkosten. Die Eingeborenen arbeiten für ein Butterbrot und ein Ei. Weniger Kosten, mehr Gewinn, mehr Wachstum, mehr Geld. Das führt im Quarterium zu steigendem Wohlstand.«
»Für die Menschen.«
»Richtig.«
Shorne grinste. Bullys Kopf lief rot an. Perry Rhodan sah besorgt zu ihm herüber.
»Wann gedenkt das Quarterium die Rechte für Extraterrestrier wieder einzuführen?«
Rhodans Frage war an den Emperador gerichtet. Dieser nahm zuerst einen Schluck aus seinem verzierten Rotweinglas.
»Wenn der Krieg vorbei ist. Sobald Frieden in allen Teilen des Reiches herrscht, können wir eine neue, friedliche Koexistenz mit den Extraterrestriern aufbauen.«
Der Emperador bemerkte, dass Rhodan ihm nicht glaubte. Bull schüttelte den Kopf, Gucky knabberte still an einer Karotte und Roi wechselte tiefe Blicke mit Stephanie. Offenbar hatte sie ihm doch wieder den Kopf verdreht.
»Glauben Sie mir, Señor Rhodan. Ich wünsche mir nichts mehr als Frieden. Gerade zu dieser Zeit …«
Er klang richtig überzeugend. Natürlich würde es niemals Frieden geben ohne MODRORs Zustimmung. Oder? Manchmal wusste ich es selbst nicht. MODROR ließ uns in dieser Hinsicht viele Freiheiten. Immer wieder hatte Cau Thon zwar angedeutet, dass es irgendwann zum Krieg gegen die LFT kommen würde. Vielleicht konnten wir dies aber verhindern. Die lemurische Menschheit sollte vereint das Universum beherrschen, statt sich in einem Bürgerkrieg zu zerfleischen.
»Die Frage über Krieg und Frieden beinhaltet doch, ob sich die Interessen der Gegner irgendwann wieder decken oder nicht«, stellte Diethar Mykke fest.
Der feiste Terraner glotzte eigentümlich in die Runde und schob sich noch ein Stück Fleisch in den Mund. Als er aufgekaut hatte, fügte er hinzu: »Wenn die LFT unsere Rassenpolitik und die Kolonisierung der neuen Gebiete akzeptiert, haben wir doch unseren Frieden.«
Starr sah er Perry Rhodan aus seinen Glubschaugen an.
»Doch wenn die LFT die USO und Saggittonen mit Waffen und Raumschiffen unterstützt, wackelt der Frieden sicherlich!«
Rhodan blieb gelassen.
»Mykke, ich habe nicht dreihundert Menschenleben lang den Kosmos bereist, um mit Ihnen zu diskutieren. Futtern Sie mal still weiter, während ich mich mit kompetenteren Menschen an diesem Tisch unterhalte.«
Viele lachten über Rhodans Bemerkung. Selbst der Emperador schmunzelte und Shorne verschluckte sich beim Lachen. Nur Mykke blieb ruhig. Aber sein runder Kopf lief rot an. Die Hände umklammerten die Serviette. Die Bemerkung war ihm offensichtlich sehr unangenehm.
»Abschließend möchte ich sagen, dass wir in den nächsten Tagen sicherlich Kompromisse erreichen können. Genau zu diesem Zweck haben wir uns in dieser beschaulichen Zeit auch zusammengefunden!«
Rhodan hob sein Glas in Richtung des Emperadors, der die Geste lächelnd erwiderte. Die Gesellschaft diskutierte belangloses Zeug. Selbst Peter war auffallend still. Ob er Beruhigungsmittel bekommen hatte? Stephanie flirtete weiter mit Roi Danton, Orlando unterhielt sich angeregt mit Bull über die Militärtaktik im Solaren Imperium, Rhodan ließ sich von Portland über den Zustand von Kathy Scolar, Nataly Andrews und Jaaron Jargon informieren und Gucky unterhielt sich mit Brett.
Er brachte sie sehr oft zum Lachen. Ihre Augen glitzerten. Ich lehnte mich zurück und beobachtete die beiden. Es tat mir gut, ihnen zuzusehen. Sie lenkten mich von meinem düsteren Leben ab. Ich stellte mir vor, eine Frau wie Brettany an meiner Seite zu haben. Wie es wohl war, eine Frau zu haben? Oder eine Freundin?
Sinnlos, Gedanken daran zu verschwenden. Meine Sehnsucht nach Liebe war stets unerfüllt geblieben. Jene Damen, die ich auserkoren hatte, mich zu lieben, fanden einen schrecklichen Tod. Zantra Solynger hatte mich einst eiskalt abserviert und war ebenso skrupellos von MORDRED-Söldnern auf Sverigor dahingeschlachtet worden. Sanna Breen war durch mein eigenes Schwert gestorben. Doch sie geisterte noch als Konzept DORGONs durch die Gegend, auch wenn es inzwischen lange her war, dass ich sie gesehen hatte. Und Myrielle Gatto war entsorgt worden. Brettany war immer nett zu mir gewesen, hatte mich in den acht Jahren nie als Freak oder Monster gesehen. Doch ich hatte Abstand zu ihr gewahrt, da es nicht im Interesse des Emperadors oder seiner anderen Kinder gewesen wäre, wenn Brett und ich … ach, ich schalt mich einen Narren. Als ob so eine engelsgleiche Frau sich in mich verlieben würde.
Ich stand auf und ging auf den Balkon. Das Gerede war mir zuwider. Politische Floskeln ohne Inhalt! Bis auf Gucky und Brettany gab es keine ehrlichen Seelen in diesem Raum. Selbst Perry Rhodan verbarg sich hinter einem diplomatischen Schutzschirm. Allenfalls Reginald Bull, stur und taktlos wie immer, strahlte Ehrlichkeit aus.
Ich blickte auf die schneeweiße Landschaft. Noch sanken Flocken vom Himmel. Ein idyllisches Bild in diesen – in jeder Hinsicht – frostigen Tagen. Krieg überall und wir waren der Verursacher. Meine Vision von einem Imperium der Ordnung war längst in weite Ferne gerückt. Ein blutiger Weg stand uns noch bevor, bis alle Menschen geeint waren. Vielleicht war es der falsche Weg – die Mittel, die wir wählten, waren es auf jeden Fall. MODROR zwang uns zur Gewalt, doch die Quarterialen nahmen die Befehle des Kosmotarchen bereitwillig an. Der Pakt mit dem Teufel zog uns immer tiefer in den Höllenpfuhl hinein. Ein gottesfürchtiger Mensch hätte Angst, auf ewig im Fegefeuer zu brutzeln. Doch ich durchlebte die Hölle bereits zu Lebzeiten. Mein Leben war eine einzige Plage. Die Aufgabe meines Daseins bestand darin, diese Menschheit neu aufzubauen, aber die Früchte dieser Arbeit, den Frieden und die Harmonie, würde ich nie erleben. Ich hoffte, in der letzten Schlacht von der letzten Kugel getötet zu werden. Doch bis dahin, war es noch ein weiter Weg.
Ich hörte Schritte. Die klackenden Absätze verrieten, dass eine Frau den Balkon betrat.
»Es ist richtig kalt geworden.«
Brettany. Offenbar suchte auch sie die Ruhe. Ich drehte mich um. Sie wollte wohl kaum über das Wetter reden.
»Was betrübt Sie?«
Ich war mir nicht sicher, ob wir uns duzen oder siezen sollten. Wir hatten das in den acht Jahren nie endgültig geklärt. Brett hatte mich oft geduzt, doch ich war zu schüchtern gewesen und hatte sie dann wieder gesiezt. Sicherlich hatte sie das auch verwirrt.
»Roi und meine Schwester. Sie hat ihn völlig in der Hand. Ich hatte gehofft, dass er etwas für mich empfinden würde, aber offenbar interessiert sich niemand für so eine altbackene Jungfer wie mich …«
Ich wusste es besser. Brettany war die reine Unschuld, ein süßer Engel. Sicher gab es keine »Die Schöne und das Biest«-Romanze zwischen uns, doch in diesem Moment tat sie mir leid, dass mein Herz schmerzte.
»Brettany, Sie sind eine bezaubernde, großmütige Frau. Sie werden den Mann Ihrer Träume sicherlich finden. Die Romanze zwischen Stephanie und Roi dürfte politischer Natur sein. Sowohl die LFT als auch das Quarterium erhoffen sich einen Vorteil durch diese Liaison.«
»Aber ich dachte, dass Roi und sein Vater verschiedener Meinung sind. Wie sollte eine Heirat der LFT nutzen?«
»Danton würde niemals seinen Vater verraten. Leider glaubt Ihr Vater dies. Nun, ich werde auf Danton achten. Er treibt ein doppeltes Spiel. Seine Loyalität gilt der LFT.«
Brett sah nachdenklich auf den Boden.
»Vielleicht wollte er deshalb nichts mit mir zu tun haben. Weil er mein Herz nicht brechen wollte?«
Das klang sogar plausibel.
»Vermutlich«, sagte ich knapp.
Sie lächelte.
»Dann besteht noch Hoffnung.«
Ich wollte ihr nicht widersprechen. Natürlich bestand keine Hoffnung. Außerdem war sie sterblich. Ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit. Offenbar verstand Brettany dies nicht. Sie war ein liebenswerter, aber auch naiver Engel, glaubte immer an das Beste im Menschen. Es war ein Wunder, dass sie noch nicht bitter enttäuscht wurde. Sollte sie jemals die Wahrheit über das Imperium ihres Vaters herausbekommen, würde sie das wahrscheinlich umbringen.
Der seltsame Professor
Vor ihnen ragte das Observatorium auf. Daccle Dessentol staunte noch immer, dass alles so problemlos funktioniert hatte. Seccs Onkel Rusus hatte ein Treffen arrangiert und Professor Wackls hatte der Termetoren-Wache die Erlaubnis für die Einreise der Kinder erteilt. Das Observatorium war einige hundert Meter von der Passage entfernt. Sie befanden sich nun draußen auf der Schattenseite des Rideryon. Hier gab es kein Sonnenlicht. Nur die Monde von Thol sowie weit entfernte Galaxien schimmerten am Firmament. Daccle fragte sich, welcher der leuchtenden Punkte wohl die Galaxie war, die Mashree auskundschaften würde. Ewige Finsternis herrschte auf der Hälfte von Rideryon. Sie war die Heimat der Ylors und anderer Kreaturen, die in Gruselgeschichten Erwähnung fanden. Doch Daccle war sich durchaus bewusst und inzwischen alt genug, um zu wissen, dass die Ylors keine Märchenlegenden waren, sondern eines der mächtigsten Völker Rideryons.
Der Anblick der Sterne und Monde war etwas, was Daccle bisher nur einmal während eines Ausflugs erlebt hatte. Er verbrachte sein ganzes bisheriges Leben in Amunrator. Nur einmal waren sie mit Gleitern in der unterirdischen Straße zur Sonnenseite geflogen und hatten die ganzen Ferien über in Ajinahstadt gewohnt. Das war ein Erlebnis gewesen! Ajinahstadt war so ganz anders als Amunrator. Es war heller, freier. Die Gebäude waren von edlem Weiß, die Türme, Tempel und Statuen schimmerten golden. Der blaue, freie Himmel! Vögel und andere Flugwesen! Freiheit, duftende Luft zum Atmen! Nicht so ein unterirdischer Käfig wie Amunrator.
Daccle würde viel lieber jeden Tag die Sonnen sehen, statt das Kunstlicht der Stadt.
Doch Amunrator lag Zehntausende von Kilometern von der Tagesseite entfernt. Ein kurzer Ausflug war nicht möglich. Transmitter waren nur der Hohepriesterschaft des Nistant vorbehalten. Zivilisten konnten sie nicht benutzen. Es hieß, kein normaler Bürger könnte in seinem Leben die Gänze Rideryons sehen. Die Gannel konnten sich auf Computern natürlich diverse Bilder, Videos und Hologramme des bekannten Resif-Sidera ansehen, doch die Orte selbst besuchen, war ihnen nicht möglich, dazu war es zu gigantisch. Zahlreiche Völker auf Rideryon hatten keine Vorstellung von der gesamten Ausdehnung. Viele solcher Kulturen existierten in primitiver Abgeschiedenheit. Das Resif-Sidera war groß genug dafür.
Daccle sah hinüber zu Wilzy und Secc. Beiden war auch nicht ganz wohl. Doch was sollte ihnen hier schon passieren? Daccle blickte sich um. Hinter ihnen lag die Passage. Ein großes, in den Fels gehauenes Tor aus Stahl. Der Boden war steinig. Die Gegend von Felsen und Hügeln übersät. Ab und an schwirrten einige Sammlerdroiden an ihnen vorbei. Wahrscheinlich schürften sie nach Karasonerz. An einigen Stellen schimmerte der Felsen grünlich. Dort gab es diesen wertvollen Rohstoff.
»Hat jemand Erz?«, fragte Wilzy. Doch niemand verstand seine Anspielung, die für ihn witzig war. Er grinste.
Das Gebäude von Professor Wackls stand allein auf einem Hügel. Keine anderen Siedlungen weit und breit. Das bedeutete aber auch, dass es hier keine Außenweltsiedlungen gab.
Sie gingen ein paar Schritte weiter.
»Bestimmt sind wir bald tot«, meinte Wilzy.
Schritt für Schritt wuchs Daccles Angst. Was, wenn hier doch etwas geschah? Plötzlich blieb er stehen. War da etwas hinter der Wand? Ein Schatten? Secc schien es auch gesehen zu haben. Er sah Daccle besorgt an.
»Hey, wartet auf mich!«
Daccle glaubte, gleich tot umzufallen, so tief saß der Schreck. Dann erkannte er die Stimme.
»Lariza, was machst du hier?«, fragte Secc verblüfft.
»Ich habe auch eine Einladung vom Professor erwirken können. Ich will euch drei Deppen nicht alleine lernen lassen.«
Daccle ignorierte Larizas Beleidigung und ging weiter. Knarrend schloss sich das Tor nach Amunrator. Wenige Sekunden später schimmerte der blaue Schutzschirm davor. Nun waren sie auf sich selbst gestellt. Wenn nun die finsteren Kreaturen der Schattenwelt über sie herfielen, waren sie des Todes.
Das Observatorium wirkte zerfallen. Kaum ein Licht brannte. Blätterlose Bäume umwuchsen das Grundstück. Der milde Wind brachte ihre Äste zum Knarren und Knacksen. Es klang, als würde jemand an ihnen vorbeihuschen.
»Wir sollten uns mal beeilen«, fand Secc und ging schneller.
»Jungs sind Feiglinge«, bemerkte Lariza, hielt aber Seccs Tempo mit und lief sehr dicht neben ihm. Endlich erreichten sie den Eingang zum Observatorium. Sie standen vor einer verschlossenen Tür. Sie war kunstvoll verziert. Ein Spruch stand in Bogenschrift darüber.
»Freunde des Kosmos sind willkommen.«
Klang recht freundlich, fand Daccle. Er klopfte an, doch nichts geschah. Dann versuchte er die Tür zu öffnen. Ohne Erfolg. Eine Klingel war auch nicht vorhanden. Die Geräusche hinter ihnen wurden immer bedrohlicher. Waren da vielleicht Stimmen?
»Wir sollten lieber umkehren«, schlug Lariza vor.
Daccle bemerkte, dass sie nun auch Angst hatte.
»Egal, wie wir uns entscheiden, wir werden sterben. Aber ich bestimmt als Erster und am grausamsten …«
»Wenn du nicht gleich deine Klappe hältst, erwürge ich dich eigenhändig. Langsam und grausam, Wilzy Wltschwak!«
Lariza starrte den manisch-depressiven Gannel wütend an. Plötzlich öffnete sich die Tür nach vorn. Daccle wich aus. Er kannte solche Türen gar nicht. Wieso ging die nach vorn und nicht zur Seite auf? Licht drang aus dem Türspalt. Nach einer Weile und ziemlich lautem Knarren stand die Tür offen. Eine Gestalt kam auf sie zu. Mittelgroß, dick und mit leicht humpelndem Gang. Auf der faltigen Haut waren Altersflecken nicht von Sommersprossen zu unterscheiden. Das wirre, weiße Haar strebte in alle Richtungen. Die Person verneigte sich kurz und offenbarte dabei, dass in der Mitte des Kopfes alle Haare ausgefallen waren.
»Professor Wackls?«, fragte Secc.
»Ja, so ist es, Kinderchen. Kommt herein. Ich habe auf euch gewartet. Kommt, kommt!«
Die vier tauschten schnelle Blicke, dann folgten sie dem dicklichen Gannel ins Observatorium. Daccle sah sich um. Alles war sehr dunkel und unaufgeräumt. Es wirkte chaotisch. Eine lange Treppe führte sie in einen großen Saal.
»So, hier sind wir. Nehmt Platz. Möchtet ihr eine heiße Schokolade? Oder einen Carynth-Cocktail?«
Wackls kicherte seltsam.
Die vier Kinder nahmen auf einer schmuddeligen Couch Platz. Lariza fühlte sich augenscheinlich besonders unwohl, zumindest interpretierte Daccle ihren Gesichtsausdruck so. Secc schien der Dreck am wenigsten auszumachen, aber die Grindelwolds galten schon immer als etwas schlampig.
Wilzy hockte versunken auf dem Rand der Couch und widmete sich tippend seinem Kommunikator. Daccle fragte sich, was er damit wohl machte. Ihm schrieb doch sowieso nie einer eine Nachricht.
»Also, Secc, dein Onkel Rusus hat mir erzählt, dass ihr Strafaufgaben zu lösen habt?«
»Ich nicht!«, hob Lariza hervor.
»Wieso bist du dann hier?«
»Weil ich trotzdem etwas lernen möchte. Darum bin ich freiwillig mitgekommen. Wissen ist Macht und ich will später mächtig sein. Eine große, renommierte Wissenschaftlerin.«
Wackls nickte. »Du bist ein kluges Mädchen!«, lobte er sie. Lariza strahlte. Die Streberin! Manchmal ging sie Daccle extrem auf den Keks.
»Entropie ist ein schweres Thema. Ja, ja. Die meisten wissen eigentlich nichts darüber, manche etwas, aber ich weiß mehr, als andere wissen, wisst ihr?«
Daccle hatte seine Probleme, dem Professor zu folgen.
»Die Entropie ist leicht zu erklären. Kleines, wachsendes Chaos in der Ordnung. Ein Mini-Chaotarch in der Welt der Kosmokraten, versteht ihr? Das Thoregon, der Dritte Weg. Jenseits von der starren Linie entwickelt sich eine Unordnung, ein Gegensatz zur Ordnung. Es entsteht immer, man kann es nicht verhindern …«
Wackls lachte hysterisch. Daccle verstand zwar, was er meinte, doch irgendwie war ihm der Typ nicht geheuer.
Auch wenn wohl seit vielen Äonen kein Rideryone mehr Kontakt zu den Hohen Mächten gehabt hatte, so war ihnen durchaus eine gewisse Kosmologie bewusst. Nach jedem Kulturaustausch waren neue Erkenntnisse hinzugekommen. Das Wissen der neuen Völker wurde aufgenommen und dokumentiert. Zumindest die aufgeklärten Völker des Resif-Sidera wussten mit den Begriffen Kosmokraten, Chaotarchen und Thoregon etwas anzufangen.
»Ich kann es euch auch genauer erklären. Die Entropie ist ein Maß für Unwissenheit. Die Entropie bleibt nur dann unverändert, wenn die Prozesse reversibel verlaufen. Reale Zustandsänderungen sind immer mit Energieverlusten verbunden, wodurch sich die Entropie erhöht. Eine Verringerung der Gesamtentropie in einem geschlossenen System ist nicht möglich. Aber die Entropie kann lokal verkleinert werden, wenn sie an anderen Orten des Systems entsprechend anwächst.
Die maximale Entropie in einem Raumbereich wird durch ein Schwarzes Loch realisiert. Da keine Information durch den Ereignishorizont nach außen dringt, ist es der Zustand maximaler Unwissenheit.«
Stille. Daccle versuchte, die vielen Worte zu verstehen. Secc brach schließlich das Schweigen.
»Das bedeutet, dass bei einer Mathematikarbeit immer maximale Entropie in meinem Kopf herrscht?«
Die anderen lachten los.
»So einfach ist es nicht«, sagte der Professor.
Ein rostiger, zylinderförmiger Roboter mit großen, gelb leuchtenden Augen schwirrte herbei. Er teilte ihm etwas in einer ihnen unbekannten Sprache mit. Nur Wackls schien zu verstehen. Er sah uns besorgt an, dann kicherte er wieder übertrieben freundlich.
»Wisst ihr, ich will euch etwas zeigen. Habt ihr schon einmal ein Raumschiff gesehen?«
Ein Raumschiff? Kaum ein Wesen in Amunrator besaß ein Raumschiff. Das war hier nur den Manjor und Harekuul und ein paar Gannel vergönnt. Auf der Sonnenseite gab es mehr Raumschiffe. Sie flogen zu den Monden von Thol, betrieben Handel. Man brauchte schon allein ein kleines Raumschiff, um überhaupt über die Weiten von Rideryon zu reisen. Doch sie selbst hatten noch keines gesehen. In Amunrator war es eher eine Seltenheit.
Daccle überlegte, ob es vielleicht sogar verboten war, ein Raumschiff zu bauen. Zumindest kam keiner in Unterriff auf die Idee. Wo hätte er denn auch eines bauen sollen? In den Höhlen? Die großen Raumhäfen gab es in Ajinahstadt. Dort hatte er sie gesehen. Oder auf Commerza, der fliegenden Handelsstadt der Hamamesch.
Sie folgten ihm einige Etagen höher. Die stählerne Treppe ächzte bedrohlich, als würde das Gerüst jede Minute unter ihrer Last nachgeben und einbrechen. Das kümmerte Secc, Wilzy und Daccle nicht. Sie wollten das Raumschiff des Professors erblicken. Nur Lariza war nicht beeindruckt. Offenbar war sie eingeschnappt.
»Wissen Sie, Professor, dass ein Raumschiff nur mit dem Segen der Nistant-Priesterschaft gebaut werden darf? Nistant, der Sargomoph wollte nicht, dass wir einfach so ins Universum reisen, sondern nur zum Kulturaustausch!«
»Ich weiß, Lariza Bargelsgrund. Aber ich bin Forscher und Realist. Nistants Hohepriester wollen nicht, dass sich die Rideryonen außerhalb des Systems verbreiten. Darum unterbinden sie gleich den Bau von Raumschiffen. Aber ihr wisst doch selbst, dass es Tausende kleine Raumschiffe gibt, die vom Rideryon zu den Thol-Monden reisen.«
Auch Lariza widersprach diesmal nicht. Dennoch war die vorherrschende Meinung, dass Raumfahrer nur mit dem Segen der Hohepriesterschaft Rideryon verlassen durften. Nur in Ajinahstadt erhielten sie von den Manjor die Genehmigung. Obgleich es Gerüchten zufolge auch Gesetzeslose gab, die mit Raumschiffen ihre Raubzüge durch den Leerraum zwischen den Thol-Monden verübten. Außerdem bezweifelte wohl jeder, dass die Beherrscher der Schattenseite einen Manjor um Erlaubnis fragten.
Sie folgten Wackls bis zum kleinen Hangar. Dort stand das Raumschiff. Es war vielleicht zwanzig Meter lang und drei Meter breit. Die Hülle schimmerte im feinen grünen Erz. Das Schiff selbst war keilförmig gebaut. Die Triebwerke befanden sich an dem breiten, unteren Ende. Es sah nicht schlecht aus, fand Daccle.
»Wofür brauchen Sie ein Raumschiff?«, fragte Secc.
»Es ist mein Traum, die Sterne zu bereisen, die ich all die Jahre beobachtet habe. Das Resif-Sidera reist seit Äonen durch das Weltall, entlädt hier und da in anderen Galaxien Lebewesen, um die fremden Galaxien neu zu besiedeln. Rassen werden assimiliert und in die Gemeinschaft eingegliedert. Doch es gibt noch viel mehr. Warum nicht mal fremde Völker besuchen und ihre Kultur kennen lernen? Warum darf nur der Späher das tun? Ich will es auch. Ich will mehr über den Kosmos erfahren, seine Rätsel lösen!«
Daccle bemerkte ein Leuchten draußen. Zuerst dachte er an die Sammlerroboter, doch das Licht teilte sich auf, bewegte sich sehr unruhig. Das waren mehrere Wesen mit Lampen. Sie marschierten in ihre Richtung. Secc bemerkte es auch.
»Wir sind tot«, meinte Wilzy. »Das ist unser Ende. Eine Horde Ylors marschiert auf uns zu.« Er schluchzte auf. »Wir werden grausam sterben.«
Daccle blickte Professor Wackls fragend an.
»Ist das so? Sind das wirklich diese Furcht erregenden Ylors? Wieso bewegen die sich so nahe an Überpassagen?«
Es war selten, dass Ylors nahe den Passagen zwischen den unterirdischen Städten und ihrem Reich auftauchten. Die Ylors ließen meist die Unterstadtrideryonen in Ruhe und sahen auch keine Bedrohung in ihnen, wenn sie auf der dunklen Seite des Riffs auf der Oberfläche forschten. Wackls druckste etwas herum, musste husten und sich räuspern.
»Nun ja, ich fürchte, sie suchen mich …«
»Wieso?«
»Ich habe für den Bau meines Raumschiffs einige Teile bei den Ylors gekauft, aber vergessen, sie zu bezahlen. Nun sind sie wohl etwas wütend auf mich.«
Erneut kicherte er irre. Die vier Gannel wechselten vielsagende Blicke. Daccle fragte sich, wie ein Gannel aus Amunrator auf die Idee kam, mit Ylors Handel zu treiben. Es gab durchaus Vasallenvölker im Dienste der Ylors, aber Gannel gehörten nicht dazu.
»Und was machen wütende Ylors mit Ganneln?«, fragte Lariza.
»Foltern und verspeisen«, antwortete Wilzy.
»Ich habe nicht dich gefragt!«
»Er hat aber recht«, sagte Wackls. »Ylors sind extrem gefährliche und bösartige Kreaturen. Sie werden das Observatorium niederbrennen, uns grausam foltern und dann, wenn sie von der Anstrengung Hunger haben, braten und auffressen. So sind die Sitten bei denen.«
Daccle war geschockt. Er wusste, dass sie hier ganz schnell weg mussten. Für eine Flucht war es aber bereits zu spät. Die Ylors erreichten das Observatorium und klopften ans Eingangstor.
»Gibt es einen Fluchtweg?«
Wackls schüttelte den Kopf. Das Geschrei der Kreaturen wurde lauter. Es klang schrill und dumpf zugleich. Daccle stellte sich ihre Körper vor. Ylors bewohnten die Schattenwelt, lebten in den finstersten und kältesten Teilen Rideryons. Sie waren einem Gannel nicht unähnlich, doch ihre Ohren waren spitz, genauso wie ihre Zähne. Die Gesichter waren deformiert und entstellt. Sie scheuten das Licht, einige starben sogar unter Einwirkung von Sonnenstrahlen. Der Legende nach saugten sie das Blut ihrer Opfer und fraßen ihr Fleisch. Ylors waren ebenso intelligent wie gefährlich. Das wussten die Gannel aus den vielen Kriegen, die sie gemeinsam mit den Manjor gegen die Ylors geführt hatten.
Kein vernünftiger Rideryone machte freiwillig Geschäfte mit denen. Professor Wackls schien wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben. Und jetzt? Die Fluchtwege waren versperrt. Es gab nur noch einen Ausweg für Daccle und seine Freunde.
»Professor, fliegt Ihr Raumschiff?«
Wackls sah Daccle entgeistert an.
»Ja, ja, natürlich. Das ist die Lösung! Wir fliegen in den Kosmos. Weit weg von den Ylors.«
»Spinnt ihr? Wenn unsere Eltern das wüssten«, regte sich Lariza auf. »Ich steige da nicht ein!«
»Alternativ wirst du von den Ylors gegessen. Was ist dir lieber?«, fragte Secc und lächelte sarkastisch.
Lariza schlug ihm auf die Schulter.
»Sei du bloß ruhig. Wessen idiotische Idee war es denn, zu dem beknackten Professor zu gehen?«
Secc schwieg. Wilzy watschelte in Richtung des Raumschiffs und stöhnte unüberhörbar.
»So oder so sind wir am Ende. Aber mir wird es noch viel schlimmer als euch ergehen. Wahrscheinlich habt ihr einen schönen, schnellen Tod und ich werde bei lebendigem Leibe von den Ylors abgeknabbert, Bissen um Bissen …«
Daccle schob Wilzy in das Raumschiff. Lariza und Secc folgten sofort. Der verrückte Professor saß schon im Pilotensitz. Die Ylors waren in das Observatorium eingedrungen. Ihre Schreie klangen erschreckend.
»Bereit?«, rief Wackls. »Dann los. Start!«
Daccle wurde in den Sitz gepresst. Lariza fing an zu schreien und Wilzy jammerte, dass das Ende gekommen sei. Das Raumschiff schoss aus dem Hangar in Richtung Weltall. Dann plötzlich verschwanden die Sterne um sie herum und ein graues Wabern umschloss das Schiff.
»Wo sind wir?«, fragte Secc.
»Im Hyperraum, kleiner Grindelwold. Wir reisen mit Überlichtgeschwindigkeit«, erklärte Wackls.
»Wieso? Bringen Sie uns sofort zur nächsten Passage von Amunrator. Wir wollen nach Hause!«, forderte Lariza.
Der Professor schwieg. Daccle schwante Übles. Der Professor hatte nicht vor, sie zurückzubringen. Er wollte irgendwohin fliegen.
»Wisst ihr, das Ganze war nicht geplant. Aber da wir nun schon unterwegs sind und ich eine Crew habe, können wir gleich in die Galaxis Siom Som fliegen.«
»Wohin?«, fragte Daccle.
»Siom Som, meine Kleinen. Dorthin ist auch Mashree der Späher unterwegs. Der nackte Prediger mit dem Hut hat mir die Koordinaten gegeben. Wir werden unsere eigenen Erkundungen machen und das ganze Resif-Sidera wird von Wackls dem Entdecker sprechen. Naja, ihr werdet sicher auch erwähnt werden. Vielleicht merken sie sich sogar eure Namen.«
Lariza verdrehte die Augen. Secc vergrub das Gesicht zwischen den Händen und Wilzy rang in apokalyptischer Stimmung die Hände. Irgendwie hatte Daccle Dessentol sich eine Nachhilfestunde in Physik ganz anders vorgestellt.
Weihnachten in Siom Som
Perry Rhodan war froh, als die letzten unsympathischen Gäste gegangen waren. Weder Shorne noch Mykke konnte er leiden. Sie passten hervorragend in das System des Quarteriums.
Er saß mit einem Brandy vor dem Kamin. Der Emperador neben ihm. Sie waren allein. Roi vergnügte sich mit Stephanie, Gucky war irgendwo und Bully musste sich Peters Spielzeugsoldaten ansehen und fachmännische Kommentare über die Stärke von Peters Eliteeinheit »Holsteiner« abgeben.
Was ging in dem Emperador vor, fragte sich Rhodan? Dieser alte Spanier war nicht nur ganz offiziell der älteste Mensch Terras, er war innerhalb kürzester Zeit zu einem der wichtigsten Menschen aufgestiegen. Beherrscher des Quarteriums, Zellaktivatorträger. Hatte Rhodan de la Siniestro unterschätzt? Früher hatte er ihn als harmlosen Greis angesehen, doch von Jahr zu Jahr hatte sich der Emperador höher gearbeitet und stand nun an der Spitze einer intergalaktischen Großmacht. Strebte er nach mehr? Wollte er auch seine ursprüngliche Heimat Terra und die LFT erobern?
Was waren seine Motive für die Kriege? Und stimmten die Meldungen über Deportationen und Internierungslager? Rhodan befand sich in einer verzwickten Situation.
»Sie haben viel geleistet«, sagte Rhodan. »Doch wieso führen Sie den Krieg? Er ist doch unnötig.«
Rhodan ging forsch an die Sache heran. Der Emperador nippte an dem Glas und starrte ins knisternde Feuer.
»Wieso haben Sie früher so gehandelt, wie Sie es getan haben? Sie haben den Arkoniden ihre Vorherrschaft in der Milchstraße abgenommen und Kriege gegen Andromeda geführt.«
Rhodan empfand diese Verdrehung der Tatsachen als unangenehm. Die Terraner hatten damals reagiert, nicht agiert.
»Wir haben uns immer nur verteidigt. Das Solare Imperium hat nie einen Krieg begonnen. Alles, was wir wollten, war den Kosmos zu erforschen, die Menschheit in eine bessere Zukunft zu leiten. Außerdem haben wir im Auftrag von ES gehandelt.«
»Auch wir wollen wir die Menschheit in eine bessere Zukunft leiten und handeln im Auftrag von Höheren Mächten. Das Quarterium ist ein auserwähltes Reich. Uns gehört die Zukunft.«
»Wieso muss diese Zukunft auf Blut und Knochen aufgebaut werden? Gibt es keine friedlicheren Wege?«
Der Emperador schwieg. Rhodan hatte das Gefühl, als wollte de la Siniestro diesen Weg gar nicht einschlagen. Welchen Mächten diente er? Das ganze Quarterium war geheimnisvoll. Hatte ES etwas damit zu tun? Oder DORGON? Rhodan konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese beiden Entitäten solch ein brutales Vorgehen unterstützten. Dennoch, ES war immer für eine Überraschung gut gewesen. Hatte er das Geistwesen je verstanden?
Rhodan entschied sich für die direkte Frage: »Welchen Entitäten dienen Sie denn?«
»Das darf ich Ihnen noch nicht mitteilen, Rhodan. Es wäre das Beste, Sie vertrauen mir.«
Der Emperador blickte Rhodan direkt an. Seine gelblichen Augen, die tiefen Falten in seinem Gesicht ließen ihn wie eine lebendige Mumie erscheinen.
»Wir sind Spielbälle der Entitäten, sind ihre Schachfiguren. Doch wir können das Beste daraus machen. Auch ich suche einen unblutigen Weg, doch Sie müssen mir dabei helfen.«
»Und wie?«
»Die Estarten, Saggittonen und Akonen müssen ihre Niederlage akzeptieren. Die LFT und USO sollen sich heraushalten. Wir handeln einen Frieden aus und gestehen den Saggittonen und Akonen Autarkie zu. Am besten, sie siedeln nach Andromeda um.«
»Die Saggittonen mussten schon einmal umziehen. Glauben Sie, dass sie noch einmal ihre Heimat verlassen wollen?«
»Pah«, rief de la Siniestro ungehalten und stand auf. Er ging zum Kamin und wärmte sich die Hände. »Die haben sich doch noch gar nicht an die neue Heimat gewöhnt. Da fällt der Abschied nicht so schwer.«
Nun stand Rhodan auch auf und stellte sich neben den Spanier.
»Ein Gegenvorschlag: Wir wäre es, wenn Sie sich aus den besetzten Gebieten zurückziehen und den Estarten und Saggittonen ihre Freiheit wiedergeben.«
De la Siniestro sah ihn entgeistert an. Seine Mundwinkel zuckten. Die scharf gezeichneten Furchen in seinem Gesicht wurden tiefer.
»Das ist unmöglich.«
»Wieso?«
Er wandte sich ab und wanderte durch den Raum.
»Wir haben auch unseren kosmischen Auftrag. Und wir müssen ihn erfüllen. Tun wir dies nicht, ist die Menschheit verloren, wohlbemerkt die gesamte Menschheit. Mehr kann und darf ich dazu nicht sagen.«
Er blickte flüchtig zu Rhodan herüber und schien mit sich zu ringen.
»Es ist spät, Señor Rhodan. Bereiten Sie sich für den Abflug vor. Wir wollen pünktlich in Siom Som sein. Guten Abend!«
De la Siniestro verließ das Zimmer und ließ Perry wie einen begossenen Pudel stehen. Der Unsterbliche schleuderte im Zorn das Glas in den Kamin. Klirrend zerbarst es im Feuer.
Das würden bestimmt fröhliche Weihnachten! Rhodan kochte vor Zorn.
*
Drei Stunden später erreichten Perry Rhodan, Reginald Bull, Gucky und Michael Rhodan die BUTRAGUENO, Siniestros Yacht. Eine Schleuse von zweihundert mal zweihundert Metern im Erdboden öffnete sich. Die BUTRAGUENO schwebte an die Oberfläche. Sie ähnelte einem spanischen Schiff aus dem 18. Jahrhundert. Ein Beweis mehr, dass de la Siniestro ein Nostalgiker war.
Unangenehm beißender Wind wehte Rhodan ins Gesicht. Es war bitterkalt auf Siniestro. Höchste Zeit, dass sie ins warme Schiff stiegen. Zwei Gleiter fuhren vor. Die fünf de la Siniestros, Despair und Diabolo stiegen aus. Aus der BUTRAGUENO kamen ebenfalls drei Gestalten, die allesamt nicht unbedingt freundlich aussahen.
Despair erreichte Rhodan und die anderen als Erster.
»Bereit für ein harmonisches Weihnachtsfest unter Freunden?«
Rhodan bemerkte den Sarkasmus.
»Wer sind die dort?«
»Der Kapitän der Jacht, unser Palastverwalter und der Copilot«, erklärte Despair.
Der Kapitän, ein graubärtiger, hoch gewachsener Mann, hieß Alonso Calvallo und stammte natürlich aus Spanien. Der Verwalter sah besonders fies aus. Halbglatze, speckiges Gesicht, kleine Schweinsaugen. Er hieß Martyn Hubba und kam aus dem Bundesstaat Polen. Der Copilot war unscheinbar. Ein Olymper namens Byll Hazz.
»Ist alles bereit, Hubba?«, fragte Despair.
Ein feistes Grinsen ließ das ohnehin dicke Gesicht noch breiter erscheinen.
»Ja, Sir, Mister Despair. Alles ist vorbereitet. Die Tellerköpfe haben schön sauber gemacht. Eine hat nicht gespurt, da habe ich sie exemplarisch bestraft, Sir.«
»Mon dieu, darf ich wissen, was mit ihr geschehen ist?«
»Natürlich, Sir. Ich habe sie ausgepeitscht«, erzählte Hubba zufrieden.
Rhodan war sprachlos. Die anderen auch. Keiner wollte jetzt einen Konflikt mit den de la Siniestros riskieren, doch es zeigte deutlich, wie wenig sich das Quarterium um die Rechte der Außerirdischen scherte.
Don Philippe und seine Familie hatten Rhodan und die anderen erreicht.
»Alles bereit? Dann können wir mal. Auf ein frohes Weihnachtsfest.«
Er ging voran. Die anderen folgten ihm. Perry bemerkte an Bullys rotem Kopf, dass sein Freund kurz vor einem Wutanfall stand. Rhodan zog ihn beiseite.
»Keine Unbeherrschtheiten. Wir sind hier, um einen Frieden zu erwirken. Falls das nicht klappt, lernen wir zumindest viel über einen potentiellen Feind.«
»Was sollen wir schon über die noch lernen? Das sind alles ausgemachte Arschlöcher, einer wie der andere!«, knurrte Bully.
Rhodan legte seine Hand auf Bullys Schulter.
»Schon gut. Ich kann sie auch nicht leiden. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt.«
Bully zog grummelnd weiter. Michael nickte seinem Vater zustimmend zu. Es überraschte Perry, dass ausgerechnet sein Sohn so viel Verständnis an den Tag legte.
Perry stieg in die Jacht ein. Wenige Minuten später startete das Raumschiff, dreißig Minuten später hatten sie das Sternenportal passiert und befanden sich in Siom Som. Von hier aus war es ein Flug von vierzehn Stunden, bis sie die Eiswelt Ves-Som erreichten. Dort stand das Ferienhaus des Emperadors.
Langsam fragte sich Perry, ob die Idee wirklich so gut gewesen war. Hoffentlich endete nicht alles in einem Eklat.
*
Orlando de la Siniestro dachte über die Begegnung mit der liebreizenden Uthe Scorbit auf Wolfenstein nach. Er hatte sein Herz an sie verloren. Diese neue Begegnung war anders als die früheren. Seit Jahren hatte er sie nicht mehr gesehen, zuletzt im Jahre 1299 NGZ. Damals hatte sie sich aus Cartwheel verabschiedet und war mit Remus wieder nach Terra gezogen.
Sie war zurückgekehrt. Und nun hatte er sofort sein Herz verloren, als er sie wiedersah. Doch sie war verheiratet. Seine Ehre verbot es ihm, etwas mit einer verheirateten Frau anzufangen. Offensichtlich war sie jedoch unglücklich. Vielleicht konnte er sie davon überzeugen, sich scheiden zu lassen. Er würde ihr ein guter, treusorgender Ehemann sein. Orlando kannte Scorbit schon seit Jahren. Ein Abenteurer, wie sein verwegener Freund Jonathan Andrews. Offenbar war Scorbit so davon überzeugt, dass das Quarterium abgrundtief böse war, dass er sich lieber in einen Kampf stürzte, als ein treusorgender Ehemann zu sein. Das machte ihn für Orlando doppelt unsympathisch. In jeglicher Hinsicht war Remus nun ein Konkurrent für ihn.
Orlando betrachtete ein holografisches Bild von Uthe. Er hatte die Datenbank des Quarteriums abgefragt. Da gab es massenweise Material über die ehemalige Sozialministerin des Terrablocks.
»Was gaffst du dir da für Fotos an?«
Orlando deaktivierte rasch die Holografie. Peter stürmte in das Zimmer. Sein Bruder war plump wie immer.
»Ich habe gestern dem Bull meine Holsteiner gezeigt. Der war beeindruckt, das sage ich dir. Es gibt keine Truppe, die so gut ist, wie meine Holsteiner. Auch Despairs 501. nicht!«
»Da hast du gute Arbeit geleistet, mein Bruder.«
In Wirklichkeit hielt Orlando die Holsteiner für eine üble Truppe von Verbrechern. Es gefiel Orlando überhaupt nicht, dass sie als Leibgarde seiner Familie dienten. Auf der anderen Seite gab es keine Gefahren auf Siniestro und Paxus. Und so wurde Peter davon abgehalten, sein Amt als Oberbefehlshaber des Heeres auszuüben. Zweifellos war Peter völlig unfähig, durch und durch ein schlechter Soldat und Stratege. Doch er liebte ihn und wollte ihm diese Enttäuschung ersparen. Orlys Vater dachte genauso.
»Was wirst du mir zu Weihnachten schenken?«, fragte Peter und lümmelte sich auf das Bett. »Ich habe mir dieses Jahr ein Geschütz gewünscht. Das möchte ich im Garten aufstellen und mit den Holsteinern Schießübungen abhalten.«
Orly verdrehte die Augen. Er wusste von diesem beknackten Wunsch seines Bruders. Natürlich würde er kein echtes Geschütz bekommen. Vor fünf Jahren hatte ihr Vater ihm einen Panzer geschenkt. Peter war damit quer durch Siniestro gefahren und hatte Tiere erschossen. Leider hatte er dabei auch zwei Nachbarn schwer verletzt. Es kostete viel Überzeugungskraft und jede Menge Geld, die Nachbarn von einer Anklage abzubringen. Wer weiß, was Peter mit einem Geschütz alles anstellte.
»Lass dich überraschen. Ist schließlich auch eine Überraschung.«
»Ich will es jetzt wissen. Oder ich sage Vater, dass du dir heimlich Fotos von Uthe Scorbit anguckst. Bist du scharf auf die?«
Orlando atmete tief durch. Wie hatte Peter das nur herausgefunden?
»Das ist mein Privatleben und geht dich nichts an. Ich habe Vater auch nichts von deinen diversen Eskapaden mit dieser Sylke Stabum erzählt …«
Orlando dachte mit Grausen daran zurück. Er hatte die beiden mehrmals in flagranti erwischt. Bei ihren Spielchen benutzten sie unter anderem Waffen als stimulierende Spielsachen. Es war widerlich, regelrecht anormal. Vater hätte einen Schock bekommen.
Peter sprang auf.
»Ich hasse dich! Eines Tages werde ich der größte Feldherr aller Zeiten sein. Dann behandelt ihr mich nicht mehr wie einen Vollidioten. Ihr werdet schon sehen. Ich werde Rhodan töten und Terra erobern. Jawohl!«
Jetzt reichte es Orlando. Er stand auf, doch Peter gab schon klein bei und lief weg. Orlando fragte sich, wie es mit seinem Bruder weiterging. Er war eine Gefahr für alle. Er verschloss die Tür und aktivierte wieder Uthes Bild. Seine bedrückenden Gedanken waren wie weggewischt. Sein Herz sang voller Freude, wenn er sich vorstellte, wie sie wohl in einem Brautkleid aussehen würde.
Weihnachtstradition
Sie hatten Ves-Som erreicht. Der ganze Planet war von einer weißen Schneedecke bedeckt. In Perry Rhodan kam für einen kurzen Moment etwas Besinnlichkeit auf. Er erinnerte sich, wofür Weihnachten eigentlich stand: Familie, Liebe und Frieden, nicht Geschenke oder ein großes Fest. Es ging darum, mit seinen Nächsten eine friedliche Zeit zu verbringen. Nein, nicht nur mit seinen Nächsten, mit allen Menschen, mit allen Lebewesen.
Dafür lohnte es sich, immer zu kämpfen, und es passte zu ihrer neuen Mission. Immer wieder gab es Kreaturen, die den Frieden störten, die aus ihrer Gier heraus Kriege führten und Unschuldige töteten. Nicht nur Sterbliche, auch höhere Entitäten. Was war seine Aufgabe, als dies zu verhindern? Eine nie endende Aufgabe, aber gerade deshalb besaß er seinen Zellaktivator.
Die Jacht landete. Brettany und Stephanie stürmten wie kleine Kinder heraus. Gucky teleportierte ihnen nach. Die drei bekriegten sich in einer Schneeballschlacht. Stephanie wirkte in diesem Moment richtig sympathisch, doch Perry war sich sicher, dass es nur Maskerade oder ein Anfall von Gefühlen war. Dabei war ihm klar, dass es selten das absolut Böse unter Menschen gab. Jedes Scheusal hatte auch irgendwo seine liebenswerten Seiten. Selten gab es reines Schwarz oder Weiß in der Gesinnung eines Lebewesens.
Michael stieß auch hinzu und wurde von den beiden Siniestro-Schwestern »eingeseift«. Gucky spielte natürlich unfair und bombardierte die drei gleich mit mehreren Schneebällen, die er telekinetisch auf sie schleuderte.
»Erfrischend, nicht?«, fragte de la Siniestro.
»Die Jugend ist zumeist erfrischend und hoffnungsvoll. Auch wenn Mike rein biologisch nicht unbedingt mehr zur Jugend zählt.«
Rhodan lachte.
»Dennoch benimmt er sich manchmal noch sehr unreif. Kommen Sie, Don Philippe. Suchen wir Ihr Domizil auf.«
Der alte Spanier nickte und sie gingen aus dem Raumschiff. Perry genoss die kalte, klare Schneeluft. Sie befanden sich in einem Tal. Rechts von ihnen lag ein gefrorener See, links ein großer Berg. Direkt voraus das Haus des Emperadors. Dahinter ein gewaltiger Nadelwald. Alles wirkte sehr terranisch. Keine exotischen Pflanzen oder Oberflächenstrukturen. Perry fragte sich, ob der Emperador bei der Gestaltung der Welt nicht etwas nachgeholfen hatte.
Bully, Despair, Orlando und Peter waren schon vorausgegangen. Peter blieb stehen, nahm etwas Schnee und warf ihn kichernd auf Gucky. Der Mausbiber hielt den Schneeball telekinetisch fest, drehte den Ball ein paarmal um seine eigene Achse und schleuderte ihn Peter direkt ins Gesicht. Peter fing an zu schreien, dann zu weinen. Der Emperador war über das Verhalten seines jüngsten Sohnes sichtlich geschockt. Orlando packte seinen Bruder und zog ihn in Richtung des Hauses.
»Ich habe alles vorbereitet«, berichtete Martyn Hubba und grinste über beide fette Wangen. »Das Lichterfest beginnt jetzt, Eure Majestät.«
»Gut, gut«, sagte der Spanier nur.
Flutlicht begrüßte sie beim Betreten des Grundstücks. Eine weihnachtliche Melodie spielte, Lichterketten, leuchtende Rentiere und Weihnachtsmänner drehten sich auf dem Dach im Kreis. Das Prunkstück war ein gewaltiger Weihnachtsbaum auf dem Hof.
»Oh, das ist wunderschön«, freute sich Brettany und lachte herzlich.
»Klimbim«, meckerte Peter.
Perry bemerkte an Bullys ausgeglichenen Gesichtszügen, dass der Anblick sogar seinem Dicken gut gefiel. Die Kinder de la Siniestros stürmten – bis auf Orlando, der ganz normal ging – in das Haus. Michael rannte mit. Er benahm sich wie ein Teenager. Ob das auch Maskerade war? Perry wusste es nicht. Vielleicht freute sich Michael auch nur so. Es war schon manchmal seltsam, welche banalen Dinge, wie als Beispiel dieser Weihnachtsschmuck, das Herz der Unsterblichen höher schlagen ließ. Er selbst war an diese Art der Entspannung nicht mehr gewöhnt. Es war etwas Besonderes für ihn. Wie viele Weihnachten hatte er in irgendeinem Krieg irgendwo, Millionen Lichtjahre von zu Hause, verbracht? 693 Weihnachtsfeste musste er in einem Stasefeld verschlafen. Meist war Weihnachten nur eine traurige Erinnerung an seine Jugend. Und doch berührten ihn solche Festtage, denn dann präsentierte sich die Menschheit von der besten Seite. Das war das größte Geschenk für ihn: Hoffnung, Hoffnung auf bessere Zeiten.
*
Nach einer Weile hatten alle ihre Zimmer bezogen und ausgepackt. Perry sah auf das Chronometer. Es war der 23. Dezember, 19 Uhr Standardzeit. Auf diesem Planeten wurde es, dazu passend, jetzt auch Nacht. Fast war alles ein wenig zu perfekt auf dieser Weihnachtswelt, fand Rhodan.
Perry betrachtete das Haus. Es war vielleicht zweihundert Quadratmeter groß. Eine simple Holzhütte. Sie erinnerte ihn an Almhütten aus den Alpen. Bestimmt hatte der Emperador dies absichtlich so gestaltet.
Auf jeden Fall wirkte es beschaulich und idyllisch. Rhodan wanderte durch die Gänge. Die Einrichtung war rustikal und dennoch altmodisch elegant. Es gefiel ihm hier. In der oberen Etage befanden sich die Schlafzimmer der Familie und der Gäste. Unten waren ein großer Empfangssaal, der Speiseraum, die Küche und das groß angelegte Wohnzimmer. Die Quartiere der Dienerschaft befanden sich im Nebengebäude.
Hier würden sie also eine volle Woche verbringen. Gemütlich war es auf alle Fälle. Rhodan fragte sich nur, ob die Gesellschaft in Ordnung war. Er ging die Stufen hinab und traf auf den Verwalter Hubba.
»Sir«, grüßte Hubba ihn.
Perry Rhodan musterte ihn abfällig. Normalerweise zeigte er seine Ablehnung nicht, doch Hubba war ihm von Grund auf unsympathisch.
»Wollen Sie nicht wieder Ihre Sklaven auspeitschen?«
Hubbas feistes Grinsen gefror.
»Ich tue nur meine Pflicht, Sir. Ob Tellerköpfe, Flattermänner oder Gurken, sie müssen dem Menschen nun einmal dienen. Das ist ihr natürlicher Platz. Und tun sie das nicht, muss ich sie maßregeln.«
Rhodan war nahe an einem Wutanfall.
»Hören Sie auf, abwertende Begriffe für diese Lebewesen zu finden. Es sind Gataser, Somer und Swoon, von denen Sie reden. Denkende und fühlende Wesen, die ihre Würde haben und Schmerz empfinden.«
Hubba schwieg. Er blickte sich Hilfe suchend um. Orlando de la Siniestro schien das Gespräch verfolgt zu haben. Er wandte sich an Martyn Hubba und Perry Rhodan.
»Gibt es Probleme, meine Herren?«
»In der Behandlung von Extraterrestriern haben wir beide anscheinend grundlegende Differenzen«, sagte Rhodan kühl.
»Hubba, da wir Weihnachten haben, möchte ich, dass kein einziger Nichtmenschlicher misshandelt oder bestraft wird. Während unserer gesamten Zeit auf Ves-Som gilt mein Befehl.«
»Aber …?«
Hubba glotzte verständnislos den ältesten der de la Siniestro-Söhne an. Perry war überrascht über Orlandos Entscheidung, schätzte sie jedoch wenig. Was war schon eine Woche? Wahrscheinlich wurden sie zu Beginn des neuen Jahres dafür doppelt so schlimm misshandelt. Das ganze System war falsch. Der Menschheit ging es gut im Quarterium, denn sie lebte auf Kosten der Extraterrestrier. Das war nur einer der vielen unhaltbaren Zustände. Und anstatt diese zu bekämpfen, verbrachte Perry Rhodan fröhliche Weihnachten mit dem Verantwortlichen dieses brutalen Regimes. Rhodan erntete dafür zu Hause heftige Kritik bei der politischen Linken. Die er zu schätzen wusste, denn viele interessierte es gar nicht. Die Kriege in den estartischen Galaxien, in Cartwheel und M 87 waren weit weg. Das öffentliche Interesse innerhalb der LFT war gering. Es gab nur wenige, die für die Rechte der Nichtmenschen und Saggittonen demonstrierten. Diese jedoch mit einer seltsamen Hartnäckigkeit.
Hubba baute sich vor Orlando auf und protestierte.
»Ihr Vater hat mir freie Hand gegeben!«
»Und ich untersage es Ihnen jetzt. Nun gehen Sie, Hubba!«
Hubba glotzte ihn böse an und zog ab. Perry blickte dem Mann hinterher. Dann betrachtete er Orlando. Der gut aussehende Sohn des Emperadors wirkte adrett in seiner Uniform, voller Stolz und Ehrgefühl. Und dennoch ließ er solche Verbrechen zu. Wie passte das zusammen? Das Quarterium war seltsam. Einerseits baute es auf alte Traditionen des Solaren Imperiums. Andererseits ignorierte es dabei die Rechte für Lebewesen, die im Solaren Imperium immer peinlichst genau beachtet wurden. Sie nutzten ihr Militär auch nicht zur Defensive, sondern zur Offensive. Quarterium und Solares Imperium waren einander oberflächlich ähnlich, aber gleichzeitig auch grundverschieden.
Offenbar legten die Verantwortlichen des Quarteriums viel Wert auf Ehre und Anstand. Doch wieso führten sie dann Kriege und unterdrückten die Nichtmenschen? Das passte alles nicht zusammen. Und was war mit dieser Artenbestandsregulierung? Bisher hatte de la Siniestro das Thema stets vermieden, untersagte Besuche von humanitären Organisationen auf Objursha und verharmloste die Internierungslager. Doch was ging wirklich dort vor?
Perry unterbrach seine Überlegungen und blickte zu Orlando, der ihn fragend ansah. Was erwartete de la Siniestro nun? Ein Dankeschön? Wofür? Für etwas, was eigentlich selbstverständlich war?
*
»Mon dieu, das war beeindruckend …«
Roi drehte sich zur Seite und atmete erst einmal tief durch. Stephanie lag neben ihm. Der Kerzenschein spiegelte sich in ihren Augen. Sie lächelte ihn an. In diesem Moment sah sie wie ein Engel aus, doch er wusste genau, dass sie keiner war. Stephanie war gar nicht fähig, jemanden zu lieben, sich um ihn zu kümmern und eine andere Person, als sich selbst, in den Vordergrund zu stellen.
In den Monaten, in denen Roi in Cartwheel verweilte, hatte er Stephanie gut kennengelernt. Sie hatte ihre besonderen Vorteile: Sie war eine außergewöhnliche Liebhaberin, verstand es, einen Mann zu bezirzen, zu umgarnen und ihm jede Hemmung zu nehmen. Es machte auch Spaß, mit ihr auszugehen. Sie war klug und wunderschön, aber auch berechnend, kaltherzig und machtbesessen. Das Schlimmste war ihre Skrupellosigkeit.
Danton hatte viel über die de la Siniestros in Erfahrung gebracht. Insbesondere über Stephanie, denn über die gab es am meisten zu erfahren. Sie stand in Verbindung mit der staatlichen Übernahme von INSELNET, war wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass Guy Pallance Chefintendant wurde.
Sie soll auch nicht ganz unschuldig am Tode von Pace Joharr gewesen sein. Ihr Ruf als Männerfresserin war groß, die Anzahl ihrer Liebhaber anscheinend gewaltig. Böse Zungen behaupteten, man könnte damit eine ganze Division füllen. Das war der Hauptgrund, warum Roi ihr misstraute. Eine so junge Frau, die durch so viele Betten gegangen war, konnte für ihn nicht dauerhaft begehrenswert sein. Er hätte niemals für sie tiefere Gefühle entwickeln können. Dennoch war es wichtig, die Beziehung zu ihr aufrechtzuerhalten. Nur so bekam er einen Einblick in das Herz der quarterialen Regierung. Und er genoss ihre Gier. Stephanie war inzwischen eingeschlafen. Roi nutzte dies, um sich wieder anzuziehen und ins große Wohnzimmer zu gehen.
Er wärmte sich am knisternden Kaminfeuer. Plötzlich überkam ihn das Gefühl, sich einen schönen Cognac einschenken zu können. Er drehte sich um und stand unvermutet Orlando gegenüber.
»Auch wieder da?«
Roi blickte auf das Chronometer. Es war erst 21 Uhr. Direkt nach seiner Ankunft war er mit Stephanie ins Bett gefallen. Roi machte einen Diener und ging zur Bar.
»Cognac?«, fragte er Orlando.
»Nein«, sagte dieser knapp. »Whiskey.«
Roi füllte den Alkohol in die Gläser, ging zurück und setzte sich neben Orlando.
»Wie ist es, Sohn dieses Herrschers zu sein«, fragte er Orlando. Der de la Siniestro sah Danton überrascht an. Roi lächelte. »Mir kannst du es ruhig sagen, ich bin schließlich auch der Sohn eines Regenten.«
Orlando schien darüber nachzudenken. Dann nickte er.
»Es ist schwer. Ich versuche immer, ihm gerecht zu werden. Ich möchte, dass er stolz auf mich ist.«
Danton nippte von seinem Cognac.
»Das kenne ich gut. Es kann zu einer fixen Idee werden. Unsere beiden Väter sind die wohl wichtigsten Terraner zurzeit. Ich hoffe, dass sie sich nicht so bald bekriegen …«
Orlando sah Danton seltsam an. Roi versuchte aus seinem Gesichtsausdruck zu lesen, doch er kam zu keinem Ergebnis. Was ging in Orlando vor? Auf wessen Seite stand er?
»Sicher ist im Quarterium nicht alles richtig. Dennoch hat mein Vater ein Reich der Menschheit geschaffen, Arkoniden, Terraner und alle ihre Kolonialvölker vereint. Auch Akonen und Saggittonen werden sich noch eingliedern. Deinem Vater ist das nie gelungen. Er sollte uns den Weg ohne Einmischung gehen lassen. Doch er spielt sich auf, als würde ihm das Quarterium gehören!«
Da lag der Hund begraben. War es geknickter Stolz? Beschmutzte Ehre? Ein Gefühl von Minderwertigkeit gegenüber seinem Vater?
»Mein Vater mischt sich doch kaum ein. Das hat er früher schon ganz anders gemacht. Doch wir können auch nicht tatenlos zusehen, wie unsere Freunde, die Estarten und Saggittonen, vernichtet werden. Ich verstehe das Quarterium und deshalb will ich vermitteln …«
Orlando sah Danton kalt an.
»Im Bett meiner Schwester?«
»Hups …«
Roi sah verstohlen zu Boden. Es war Zeit, wieder etwas mehr Maske aufzusetzen. Er hob die Hände und seufzte.
»Was sollte ich tun? Sie ist wie ein Wirbelwind. Keine Chance, ihr zu widerstehen …«
Orlando lachte abfällig.
»Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Dass du …, pardon Monsieur, Ihr, mit meiner Schwester schlaft oder dass Ihr euch mit dieser Natter einlasst. Egal, Ihr macht kein gutes Bild dabei. Ich traue Euch nicht, Danton. Ihr treibt ein doppeltes Spiel und ich warne Euch!«
»Heute? Kurz vor Weihnachten?«
Orlando stand auf und warf wütend das Glas in den Kamin.
»Jederzeit! Mischt Euch nicht in die Angelegenheiten des Quarteriums ein und spioniert uns nicht unter dem Deckmantel der Freundschaft aus. Mein Vater glaubt an Euch. Enttäuscht Ihr ihn, werde ich Genugtuung fordern!«
Orlando warf Roi einen letzten, eiskalten Blick zu. Dann verließ er den Raum. Das waren klare Worte gewesen. So hatte sich Roi das Gespräch nicht vorgestellt. Naja, immerhin schien ihm wenigstens der weibliche Teil der de la Siniestros zu Füßen zu liegen.
Cauthon Despair
Am Morgen des 24. Dezember 1306 NGZ waren wir aufgebrochen, um einen Weihnachtsbaum zu fällen. Ich hatte das Vergnügen, mit Brettany und Gucky einen passenden Baum aussuchen zu dürfen. Es schneite ziemlich heftig draußen. Mir machte es wenig aus, aber um Brett machte ich mir Gedanken. Völlig umsonst. Sie lief freudig aus dem Haus und schien sich über die Schneemassen zu freuen. Gucky schwebte im Schneidersitz einen Meter über dem Boden.
»Morgen«, brummte er.
»Ach? Müde?«
»Sprich mich noch einmal in einer Stunde an. Bully hat mir seinen selbst gebrannten Vurguzz gegeben. Wir haben Meiern gespielt. Nach jeder verlorenen Runde gab’s dieses Gesöff. Igitt …«
Ich lachte leise. Gucky war jemand, der es bei fast jedem Wesen schaffte, das Herz zu erreichen. Selbst ich mochte ihn gern. Der Ilt war immer so offen, so vertrauensvoll. Er wollte jedermanns Freund sein, konnte aber auch entsprechend handeln, wenn es sein musste. Wenn der Mausbiber kämpfte, tat er es jedoch mit einem eigenen Charme und Humor.
Sicher war er auch mal ernst. Doch dies bewahrte er bestimmt für seine einsamen Stunden auf. Einsamkeit. Er musste schrecklich einsam sein, als Letzter seiner Art. Ich verstand ihn gut. Wir beide waren uns im Grunde genommen sehr ähnlich. Er spielte den Clown, ich das Monster. Doch wir beide blieben trotz des Respekts, den man uns entgegenbrachte, einsam. Auch in Gucky musste der Wunsch nach einer Frau und einer Familie lodern, besonders in dieser Zeit.
»Wir können den Gleiter nehmen. Falls ihr gut zu Fuß seid, es sind knapp zwei Kilometer bis zum Wald«, sagte ich.
»Gehen wir zu Fuß. Ist doch ein schönes Wetter«, fand Brettany.
»Nö«, meinte Gucky und packte uns. In der nächsten Sekunde befanden wir uns direkt im Wald. Der faule Ilt hatte uns teleportiert. Typisch für ihn, bloß keinen Schritt zu viel tun. Der Nadelwald war dicht. Wir würden wohl keine Probleme haben, einen passenden Weihnachtsbaum zu finden. Bereits nach wenigen Minuten hatte Brettany einen ausgewählt.
»Der ist doch perfekt!«
Ihre Augen glitzerten. Sie freute sich wie ein kleines Kind über diesen Baum. Ich verstand sie nicht. Freude war für mich sowieso ein Fremdwort. Menschen, die unentwegt lachten, waren mir suspekt. Waren sie nur schrecklich naiv oder spielten sie eine hinterhältige Charade? Bei Brettany kannte ich die Antwort. Sie war naiv. Ihr großes Herz war voller Liebe und Freude. Immer wieder wünschte ich mir solch eine Frau an meiner Seite, doch es war Wahnsinn. Selbst wenn Brettany mich lieben würde, war eine Bindung unmöglich, denn meine dunkle Seele würde die ihre verzehren. Ich befand mich zu lange im Sog des Chaos, um noch ausbrechen zu können. Ich hatte zu viele Morde begangen, zu viele Schlachten geschlagen und zu viele Freunde verraten.
Für mich gab es kein Zurück mehr. Der Weg meines Meisters MODROR war auch der meine.
»Dann schwinge deine Axt oder dein Schwert«, sagte Gucky und grinste über beide Wangen. »Oder soll ich ihn telekinetisch umstupsen?«
Ich nahm das als Herausforderung an und zog das Caritschwert. Ein normales Schwert hätte niemals so einen gewaltigen Stamm durchschlagen können. Mein Schwert mit der Caritlegierung durchschnitt das Holz einfach. Nach zehn Schlägen war ich durch. Der Baum kippte nach hinten und fiel donnernd zu Boden.
»Gut, den Rest mache ich«, meinte Gucky, während er an dornigen Büschen herumspielte.
»Autsch!« Der Mausbiber taumelte nach hinten.
»Oh nein«, rief Brettany. Sofort kümmerte sie sich um ihn. »Sieh doch, du blutest …«
Besorgt tupfte sie mit einem Taschentuch auf die winzige Wunde. Gucky blickte traurig aus seinen braunen Kulleraugen. Damit erweichte er Bretts Herz sofort.
»Demnach wirst du den Baum nicht telekinetisch zurücktragen?«, vermutete ich. Der faule Simulant guckte mich Mitleid erregend an und schüttelte langsam den Kopf. Ich seufzte. Dann rief ich per Interkom unseren liebenswürdigen Verwalter Martyn Hubba herbei. Hubba war nach zehn Minuten endlich bei uns.
»Ich verlade den Baum sofort, Sir. Welche Ehre. Schafft es die Ratte dort nicht?«
Gleich darauf sauste Hubba in die Luft und wirbelte im Kreis umher. Er schrie. Gucky hingegen lachte. Dann ließ er ihn fallen.
»Niemand bezeichnet den Retter des Universums als Ratte. Der Verletzung zum Trotz werde ich den Baum telekinetisch bis zum Haus tragen. Oder gleich hin teleportieren. Sollte auch machbar sein. Vielleicht riskiere ich Wundbrand oder eine Blutvergiftung, aber ich werde es tun. Damit ihr einen Weihnachtsbaum für dieses Fest habt …«
»Oh, Gucky«, sagte Brett und drückte ihn. »Du bist so lieb!«
Ich verdrehte die Augen. Gucky ergriff den Baum. Schon war er mitsamt der Tanne verschwunden. Ich half Brett in den Gleiter und stieg selbst ein. Hubba ließ ich im Schnee liegen. Ein Fußmarsch tat ihm sicherlich gut.
Epilog
Hört ihr mich, ihr Toren? Hört niemand meinen lautlosen Schrei? Ist er im Nichts der Leere erstickt? Wird er von den psionischen Mauern der Kahaba unterdrückt?
Welch Leid, all die Millionen Chroms. Völlig allein! Abgeschnitten von meinem anderen Selbst war ich unfähig zu handeln. Körper vom Geist getrennt, Physis und Psyche von den anderen Daseinsformen abgetrennt. Selbst der bösartigste Chaotarch hätte sich keine schlimmere Strafe einfallen lassen können.
Doch kein Chaotarch hat dieses Urteil über mich gefällt. Es war die Kahaba. Später unterstützt durch ein Bündnis abtrünniger Hoher Mächte.
Tagein, tagaus grübele ich darüber nach. Mehr bleibt mir auch nicht. Meine Gedanken laufen im Kreis. Jeden Tag denken, denken, denken. Nur nachdenken immer wieder und wieder.
Ist da wer?
Da ist doch jemand.
Ein leiser Funke, ein schwaches Lichtlein zwischen den Sternen der Unendlichkeit flackert vor meinem geistigen Auge auf. Es kommt mir bekannt vor. Es erinnert mich an … an … Heimat!
Ja, an die Heimat Rideryon.
Ich strenge meinen Geist an. Lausche in den Weltraum hinaus, vorbei an Sternen, an Planeten mit ihren Bevölkerungen, weiter hinaus, hinaus und immer weiter. Bis zu einem Raumschiff. Da ist sie! Ich fühle ihre Gedanken. Sie stammt aus dem Resif-Sidera, aus der Heimat. Sie ist eine Gannel, entstammt einem Volk aus dem Rideryon, einem neuen, welches ich nicht kenne. Das verwundert mich nicht: Ich sitze wohl seit unzähligen Millionen Chroms in diesem Gefängnis fest. Da hat sich auf dem Rideryon viel verändert.
Hörst du mich, Mädchen? Hilf mir! Folge meinem verzweifelten Ruf.
Hilf mir, kleine Gannel!
Hilf Cul’Arc!
ENDE
Wir bekommen zum ersten Mal einen Einblick in das geheimnisvolle Rideryon und seine Bewohner, die offenbar jemanden in den estartischen Galaxien suchen. Mehr darüber schildert Nils Hirseland in Band 93:
NISTANTS SCHATTEN
DORGON-Kommentar
Auch in diesem Roman wollen wir uns wieder mit einem Aspekt der aktuellen Kosmologie der Bulk-Universen beschäftigen. Im Mittelpunkt steht heute unser normaler, vierdimensionaler Raum, der auch als Einstein-Raum bezeichnet wird.
Jürgen Freier
Standardmodell der Kosmologie
Die Kosmologie beschäftigt sich mit dem Ursprung, der gesamten Evolution und den großräumigen Strukturen des Universums. Aktuell besteht der Konsens der Kosmologen darin, dass das Universum insgesamt flach (Krümmung gleich null) ist, expandiert und die Dynamik des heutigen Kosmos von der Dunklen Energie beherrscht wird. Mittlerweile hat sich ein Standardmodell der Kosmologie herausgebildet, in dem ein Satz kosmologischer Parameter mit unterschiedlichen Methoden sehr exakt bestimmt wurde. Zu diesen Parametern gehören:
- Die Hubble-Konstante, die ein Maß für die Expansionsgeschwindigkeit des Universums ist.
- Die Dichteparameter unterschiedlicher Energieformen im Universum. Die beherrschende Energieform ist, mit einem Anteil von etwa zwei Dritteln, die Dunkle Energie. Daneben gibt es etwa ein Drittel Beimischungen von der Dunklen Materie. Die uns vertraute »normale« Materie (z. B. Elektronen, Positronen, Myonen und Neutrinos), aus der wir auch selbst bestehen, spielt für die Dynamik des Kosmos keine Rolle und kommt nur in Spuren (wenige Prozent) vor, d. h. der sichtbare Kosmos (Planeten, Sterne und Galaxien) umfasst nur einen verschwindend kleinen Teil unseres gesamten Universums.
- Die Summe dieser Energieformen erlaubt eine Aussage über die Krümmung des Universums. Der totale beobachtete, dimensionslose Dichteparameter liegt ziemlich genau bei dem Wert 1, was ein flaches Universum nahelegt. Das Universum kann deshalb wie ein Euklidischer Raum aufgefasst werden, in dem die Sätze der ebenen Geometrie gelten. Eine leichte Unsicherheit liegt jedoch darin, ob dieser Wert wirklich exakt eins ist. Dies ermöglicht als Alternativen zum flachen Universum hyperbolische Universen mit positiver Krümmung (z. B. Dodekaeder-Universum) oder negativer Krümmung (z. B. Horn-Universum). Durch neue Messdaten, wie sie beispielsweise nach dem Start des Planck-Satelliten (2007) zu erwarten sind, versprechen sich die Astro-Physiker eine Klärung, in welcher Art von Universum wir eigentlich leben.
Als heute allgemeiner Konsens gilt weiterhin, dass der »normale« vierdimensionale Raum, der bisher für unsere Beobachtungen zur Verfügung steht, im Bereich des Makrokosmos durch Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie (ART) und im Bereich des Mikrokosmos durch Plancks Quantentheorie beschrieben wird.
Aus der ART werden die Entstehung von Sternen, Galaxien und ihren Clustern, den Galaxienhaufen und Superhaufen abgeleitet. Galaxien bilden global eine wabenförmige Struktur im Universum. Auf den Knotenpunkten (Vertices) der Waben sitzen die Galaxiensuperhaufen, während ihr Inneres leer ist. Die letztgenannten »Hohlräume« oder Leerräume bezeichnet man als Voids, die eine Ausdehnung von 50 bis 100 Megaparsec (Mpc) haben. Das entspricht etwa 150 bis 300 Mio. Lichtjahren (Lj).
Allgemein wird heute davon ausgegangen, dass unser gegenwärtiges Universum ein Alter von etwa 13,7 Milliarden Jahren hat. Für das Universum als Ganzes wird das Urknall-Modell favorisiert. Es besagt, dass vor etwa 13,7 Milliarden Jahren aus einer Singularität heraus Raum und Zeit geboren wurden. Die Raumzeit des Universums ist nicht statisch, sondern dynamisch. Kurz nach dem Urknall ereignete sich eine Phase überlichtschneller und beschleunigter Expansion des Universums. Diese Epoche heißt Inflation. Sie ist in der Kosmologie notwendig, um die Zeitskalen der Entwicklung des Universums – das rapide Wachstum – zu erklären. In dieser Phase dehnte sich das Universum mit exponentiellem und überlichtschnellem Wachstum aus.
Der wichtigste und zugleich rätselhafteste Bestandteil unseres Universums ist die Dunkle Energie. Es gibt aktuell eine Reihe von sehr unterschiedlichen kosmologischen Modellen, die eine Aussage über ihre Natur machen wollen, die allerdings alle bis jetzt noch nicht experimentell verifiziert werden konnten. Das Problem der Dunklen Energie ist sicherlich das schwerwiegendste der gegenwärtigen Physik, denn weder Astrophysik noch Teilchenphysik können dafür eine befriedigende Lösung geben.
GLOSSAR
Manjor
Ein Intelligenzvolk des Rideryon.
Die Manjor sind wolfsähnliche Wesen. Sie werden zwischen 1,70 und 2,10 Meter groß, besitzen sechs Arme und zwei Beine und sind am ganzen Körper beharrt. Manjor gehören zur Führungsriege des Riffs. Sie gelten als gute Kämpfer und sind hochintelligent. Viele Manjor, wie zum Beispiel der Hohepriester Zigaldor, sind Mitglieder in der Hohepriesterschaft des Nistant.
Die Manjor scheinen so etwas wie eine Führungsrolle auf dem Rideryon einzunehmen und gehören zu den ältesten Völkern, die das System Resif-Sidera besiedeln.
Gannel
Gannel sind ein Intelligenzvolk des Rideryon. Sie sind humanoid und kleinwüchsig. Die Haut ist von Flecken und Sommersprossen übersät. Gannel übernehmen viele Position innerhalb des Rideryon. Sie sind als Allrounder bekannt.
Harekuul
Die Harekuul sind eine Spezies des Rideryon. Ihr Aussehen ähnelt am ehesten einem Zentauren. Sie sind intelligente Wesen und beherrschen die Raumfahrt. Harekuul sind für ihre physischen und psychischen Stärken bekannt. Vertreter des Volkes sind meist tapfer und ehrbar. Die Harekuul sind in der Völkergemeinschaft des Rideryon fest integriert und gehören – wie die Manjor – zu den führenden Völkern.
Bekannte Harekuul:
Mashree: Der Späher des Rideryon. Nach einer langen Ausbildung wurde er auserwählt, um den ersten Erkundungsflug nach Siom Som zu bestreiten.
Tashree: Mashrees Bruder, hoher General der rideryonischen Armee.
Dychoo
Intelligenzvolk des Rideryon.
Die kopflosen Wesen verständigen sich mit Hilfe von Telepathie. Sie haben drei Beine, vier Arme und einen stämmigen Torso. Die Augen befinden sich dort, wo sich bei Menschen die Brüste befinden, und sie sehen auf den ersten Blick auch so aus.
Einen Mund besitzt ein Dychoo ebenso wenig wie Ohren. Er nimmt alles telepathisch wahr. Die Atmung erfolgt über den Rücken. Dychoo sind seltsame Wesen. Einerseits sind sie ruhige, intelligente Vertreter der Rideryonen, andererseits auch sehr unfreundlich und neunmalklug.
Die DORGON-Serie ist eine nicht kommerzielle Publikation des PERRY RHODAN ONLINE CLUB e. V. — Copyright © 1999-2016
Internet: www.proc.org & www.dorgon.net • E-Mail: proc@proc.org
Postanschrift: PROC e. V.; z. Hd. Nils Hirseland; Redder 15; D-23730 Sierksdorf
— Special-Edition Band 92, veröffentlicht am 30.01.2017 —
Titelillustration: Lothar Bauer • Innenillustrationen: –
Lektorat: Alexandra Trinley • Digitale Formate: René Spreer