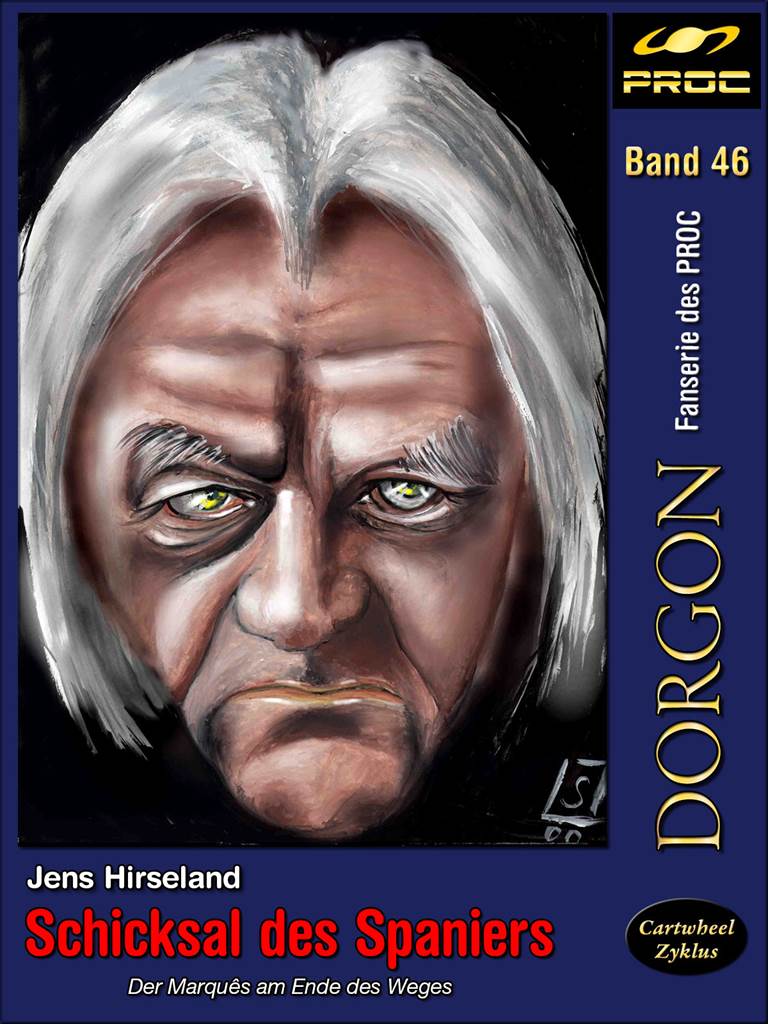
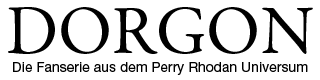
Band 46
Cartwheel-Zyklus
Jens Hirseland
|
Was bisher geschah Im Jahre 1298 NGZ scheint ein neues Zeitalter über die Insel Cartwheel herein zu brechen, denn Cauthon Despair überbringt ein Friedensangebot MORDORs, das das gesamte Projekt DORGONs in Frage stellt. Cartwheel strebt nach der Unabhängigkeit und dank Perry Rhodan scheint sich dieser Traum zu verwirklichen. Doch auch finstere Wolken ziehen über die Insel. Der Supermutant Rijon hatte für Tod und Zerstörung gesorgt, ehe Gucky ihn stoppen konnte. Doch der wahre Verbrecher war Michael Shorne, der gewissenlose Genexperimente vornehmen ließ. Derweil verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Marquês immer mehr. Ist seine Zeit gekommen? Ist es das SCHICKSAL DES SPANIERS…? |
Hauptpersonen Uwahn Jenmuhs – Der Arkonide will die Unabhängigkeit für sich ausnutzen. Cauthon Despair – Er verkündet Cartwheels Selbstständigkeit. Perry Rhodan – Der Terranische Resident appelliert an eine friedliche Zukunft. Marquês von Siniestro – Sein Alter macht sich bemerkbar. Stephanie de la Siniestro und Toran Ebur – Zwei machthungrige Menschen, die vieles gemeinsam haben. Anica – Sie wird zum Objekt der Begierde. Rosan Orbanashol, Wyll Nordment, Remus und Uthe Scorbit – An ihnen will Jenmuhs Rache nehmen. |
1. Unabhängigkeit
Paxus, 4.August 1298 NGZ
Die IVANHOE war nach Cartwheel zurückgekehrt. Cauthon Despair hatte umgehend eine Konferenz des Paxus-Rates, an der auch Perry Rhodan teilnahm, einberufen. Auch Xavier Jeamour und Henry Portland waren anwesend.
Als sich alle Ratsmitglieder im großen Konferenzsaal von Paxus versammelt hatten, ergriff der Mann mit der silbernen Rüstung das Wort: »Sehr geehrte Mitglieder des Paxus-Rates! Ich begrüße Sie und bin froh, dass Sie alle meiner Bitte, sich heute hier zu versammeln, gefolgt sind.«
Despair macht eine kurze Pause, um seine Worte wirken zu lassen.
»Ich bringe äußerst positive Nachrichten für die Insel«, fuhr er dann fort. »Alle Regierungen der hier ansässigen Völker haben ihre Zustimmung zur Unabhängigkeit Cartwheels gegeben.«
Die Ratsmitglieder, zunächst überrascht, dann natürlich hocherfreut, jubelten und applaudierten. Uwahn Jenmuhs, der Vertreter Arkons, blieb hingegen skeptisch.
»Alle? Auch der Imperator hat zugestimmt?«, fragte der feiste Politiker misstrauisch.
»Ja, auch das arkonidische Imperium hat zugestimmt«, verkündete Despair mit stolzer Stimme. »Nur die Konstrukteure des Zentrums bilden eine Ausnahme, da sie den Pelewon und Mooghs keine Autonomie gewähren wollen. Aber ich bin sicher, dass dies in Nachverhandlungen noch erreicht werden kann.«
»Ich kann Ihren Optimismus nicht nachvollziehen«, sagte Torsor, der Vertreter der Pelewon mit drohendem Unterton, blieb aber ansonsten ruhig. »Die KdZ sind unflexibel und eigensüchtig. Sie haben sich bis heute nicht zu einem Kompromiss durchringen können. Aber eines Tages werden auch wir unseren eigenen Staat erhalten, da bin ich sicher.«
Despair nickte ihm zu und ging nicht weiter auf die Worte des Pelewon ein. Er wandte sich wieder an den Rat. »Perry Rhodan kann Ihnen meine Worte bestätigen, falls Sie noch Zweifel haben sollten. In den nächsten Tagen werden Sie Botschaften von ihren jeweiligen Regierungen erhalten, die Ihnen die Details erläutern werden.«
Despair nahm Platz und Perry Rhodan erhob sich. »Verehrte Ratsmitglieder. Ich bestätige die Worte von Cauthon Despair. Cartwheel erhält volle politische Souveränität. Wir alle sind der Meinung, dass man auf diese Weise am besten den Aufgaben, die hier auf die Völker warten, gerecht werden kann. Die Milchstraße und alle anderen Galaxien sind zu weit abgelegen, als dass man dort wirklich gerechte Entscheidungen für die Völker, die nun hier leben, treffen könnte. Das müssen der Paxus-Rat und die hier ansässigen Regierungen tun. Und das können sie nur, wenn sie volle politische und wirtschaftliche Autonomie besitzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf diese Weise alle davon profitieren können. Die terranische Regierung spricht sich auch für die Souveränität der Völker der Pelewon und Mooghs aus. Ich appelliere an die Verantwortlichen der Okefenokees, diesen beiden Völkern die Unabhängigkeit zu gewähren. Frieden kann nur dauerhaft gewährleistet werden, wenn allen Völkern und Wesen Gerechtigkeit widerfährt.«
Der Abgesandte der Okefenokees, Carjul, blieb trotz Rhodans Mahnung regungslos.
»Der Zusammenhalt aller Völker ist von größter Wichtigkeit, um den Kampf gegen MODROR gewinnen zu können. Grundlage dieses Zusammenhaltes bildet die Cartwheel-Agenda, die ich aus vollem Herzen unterstütze. Ich wünsche den Völkern Cartwheels auf ihrem Weg alles Gute«, endete der Terranische Resident unter großem Beifall.
Die Nachricht von der Unabhängigkeit Cartwheels schlug wie eine Bombe unter der Bevölkerung und den Medien ein. Es gab große, spontane Freudenkundgebungen. Die Stimmung war durchwegs positiv. In den kommenden Tagen trafen von allen Regierungen die Bestätigungen der Unabhängigkeit ein. Nur die Okefenokees blieben unnachgiebig.
Am 8. August 1298 NGZ erklärte Ratspräsident Sruel Allok Mok, genannt Sam, die Unabhängigkeit Cartwheels sowie die Verabschiedung der Cartwheel-Agenda, die die Verfassung der Insel bildete. Sam erklärte den Tag zum nationalen Feiertag aller Völker Cartwheels. Auf Mankind wurden er, Perry Rhodan und der Marquês von Siniestro ausgiebig gefeiert.
Aus den Chroniken Cartwheels
Zwei Tage später verabschiedete sich Perry Rhodan von den Verantwortlichen. Sam, Joak Cascal, Cauthon Despair und der Marquês hatten sich auf dem Raumhafen New Terranias eingefunden.
Rhodan wandte sich zuerst an den Somer. »Ich wünsche dir und dem Paxus-Rat alles Gute. Möge die Unabhängigkeit den ersehnten Frieden bringen.«
»Ich werde alles dafür tun. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder«, entgegnete Sam.
Rhodan wandte sich an den Marquês. »Marquês, ich lege die Verantwortung für die LFT-Bevölkerung in Ihre Hände.«
»Dort ist sie gut aufgehoben«, versicherte Don Philippe, der sichtlich erschöpft wirkte. Die Termine und Feierlichkeiten der letzten Tage schienen ihm zugesetzt zu haben.
Perry ging weiter zu Cascal. »Cascal, alter Haudegen, wenn du Hilfe brauchst, lasse es mich wissen.«
Joak lächelte. »Geht klar. Und wenn du meine Hilfe brauchst, kannst du – wie immer – auf mich zählen.«
Zum Schluss kam Cauthon Despair an die Reihe. »Cauthon, ich bin froh, dass du wieder auf den richtigen Weg gefunden hast. Ich hoffe, dass deine Aufgabe hier in Cartwheel dir den inneren Frieden geben wird, den du gesucht hast.«
»Das wird sie, Perry. Sei unbesorgt«, versicherte Despair treuherzig.
Rhodan nickte zufrieden. Der unsterbliche Terraner war überzeugt, das Richtige getan zu haben. Er verabschiedete sich noch einmal und begab sich dann an Bord der LEIF ERIKSSON. Kurz darauf verließ der Raumer Mankind und machte sich auf den Rückflug zur Milchstraße.
2. Machtgier
Diethar Mykke interessierten all diese Ereignisse herzlich wenig. Er hatte andere Sorgen.
Die Tante seiner Frau Judta, Dorys Gheddy, und deren Söhne Charly und Ian machten ihm die Verwaltung von Bohmar Inc. streitig.
Dorys war schon immer das schwarze Schaf der Familie gewesen. In Diethars Augen war sie eine nichtsnutzige Säuferin. Und ihren zwielichtigen Söhnen traute er schon gar nicht. Deshalb gingen Diethar und seine Frau vor Gericht, um sich als Betreuer Ottilies zu behaupten. Ihr Anwalt machte ihnen Hoffnung. Als Tochter war Judta automatisch die nächste Verwandte und somit Betreuerin Ottilies und aller damit verbundenen geschäftlichen Dinge, solange Ottilie niemand anderen für ihre Betreuung oder die Leitung des Unternehmens bestimmte.
Während man auf fast ganz Mankind die Unabhängigkeit feierte, trafen sich Mykkes und Gheddys vor Gericht. Die Richterin war eine rundliche, rothaarige Frau mittleren Alters, die das Verfahren unverzüglich eröffnete. Nachdem die Formalitäten geklärt waren, fragte die Richterin, ob es keine Möglichkeit einer gütlichen Einigung gäbe.
Diethar Mykke erhielt das Wort. »Nein, euer Ehren, da sehe ich keine Möglichkeit. Ich und meine Frau wurden von Frau Braunhauer gebeten, sie zu unterstützen. Diese Aufgabe können wir mit bestem Gewissen und ohne Hilfe von außen durchführen. Die Firma braucht eine starke Führung, um im harten Wettbewerb bestehen zu können. Daher benötigen wir schnellstens Klarheit in dieser Angelegenheit.«
»Das Gericht wird eine Entscheidung fällen, wenn es die Zeit dafür gekommen hält, Herr Mykke«, erwiderte die Richterin pikiert.
Mykkes Anwalt ergriff das Wort. »Euer Ehren, die Angelegenheit ist doch völlig klar. Meine Mandanten sind von Frau Braunhauer um Hilfe gebeten worden. Nur weil die zwielichtige Verwandtschaft in der Hoffnung, etwas von dem Kuchen abzubekommen, plötzlich aufgetaucht ist, ändert sich nichts daran.«
»Einspruch, euer Ehren«, meldete sich der Anwalt der Gheddys zu Wort und trat auf das Richterpult zu. »Auch meine Mandanten wurden von Frau Braunhauer um Hilfe gebeten. Wir haben ein Schriftstück, das diese Aussage beweist.«
Der Anwalt übergab der Richterin das Beweisstück. Diese studierte es aufmerksam. Diethar Mykke nahm das Ganze beunruhigt zur Kenntnis.
Als die Richterin den Brief zu Ende gelesen hatte, sagte sie: »Dieser Brief ändert den Sachverhalt. Er ist von Ottilie Braunhauer an ihre Schwester Dorys Gheddy gerichtet. Er enthält private Dinge, wie zum Beispiel den schlechten Gesundheitszustand der Braunhauers. Ich verlese nun die für den Fall relevante Passage. Frau Braunhauer schreibt: Da es Vatichen und mir ja so schlecht geht, könnten du und deine Söhne doch hierher ziehen und Vatichen bei der Leitung der Firma unterstützen. Deine Söhne sind jung und können Vatichen sicher wichtige Arbeiten abnehmen. Es wäre schön, wenn ihr bald kommen könntet. Vatichen würde sich auch erkenntlich zeigen und euch an der Firma beteiligen, denn es ist Inges Wunsch gewesen, dass Bohmar Inc. ein Familienbesitz bleibt.«
Als die Richterin endete, war Mykkes Kopf hochrot angelaufen. Er ahnte, was nun folgen würde.
»Aus diesem Brief, den Frau Braunhauer geschrieben hat, geht deutlich hervor, dass sie der Familie Gheddy ein Angebot gemacht hat, nach Mankind zu kommen, um an der Leitung der Firma mitzuwirken. Dies verkompliziert die Angelegenheit. Dennoch wird das Gericht noch heute eine Entscheidung fällen. Bis dahin zieht sich das Gericht zurück.«
Missmutig sah Mykke hinüber zu dem Platz, an dem die Gheddys saßen und triumphierend lächelten.
Nach einer halben Stunde, für beide Parteien eine quälende Wartezeit, erschien die Richterin und verkündete ihr Urteil: »Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Da nicht eindeutig festgestellt werden kann, wem die Leitung der Firma zufällt, wird beiden Parteien, zu je 50 Prozent, die Leitung zugeteilt. Diese Regelung gilt solange, bis Ottilie Braunhauer wieder genesen ist und in der Lage ist, selbst eine Regelung zu treffen. Das Gericht verweist darauf, dass es sich hier um eine Familienangelegenheit handelt und fordert beide Parteien auf, sich zu einigen und an das Wohl der erkrankten Frau Braunhauer zu denken, ohne dabei die Gerichte zu belasten. Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger. Es besteht die Möglichkeit Revision, innerhalb von einer Woche, gegen dieses Urteil einzulegen. Die Verhandlung ist geschlossen.«
Diethar und Judta waren wie vor den Kopf gestoßen. Judta weinte hemmungslos. Allein die Tatsache, die Kosten des Verfahrens tragen zu müssen, traf sie tief.
Die Gheddys hingegen jubelten.
Ian trat auf Mykke zu. »Tja, dumm gelaufen, Onkelchen. Wir kommen morgen vorbei, um unsere Büros zu beziehen und einige geschäftliche Dinge zu besprechen«, sagte er kalt.
»Damit kommt ihr nicht durch! Ich gehe in Berufung!«, rief Mykke aufgebracht. Am liebsten wäre er auf Ian losgegangen.
Sein Anwalt hielt ihn jedoch zurück und brachte ihn und Judta in einen anderen Raum, wo sie sich setzten. »Beruhigen Sie sich, Herr Mykke. Das Schriftstück Ihrer Schwiegermutter hat die Sachlage verändert. Ich sehe wenig Chance für eine erfolgreiche Berufung. Sie würde nur zusätzliche Kosten verursachen.«
»Bloß nicht! Wir müssen sparen!«, schaltete sich Judta ein. »Und das alles nach der vielen Arbeit, die wir hatten! Das haben wir nicht verdient!«
»Das ist alles die Schuld deiner verrückten Mutter! Ich hoffe, sie krepiert bald!«, rief Mykke wütend.
»Sagen Sie das nicht, Herr Mykke«, meinte der Anwalt. »Wenn Frau Braunhauer stirbt, erben womöglich die Gheddys den Löwenanteil. Nur wenn Ihre Schwiegermutter eine neue Regelung zu Ihren Gunsten trifft, können Sie das Blatt wieder wenden.«
Also mussten Mykkes hoffen, dass sich Ottilie bald wieder erholte.
*
Charly und Ian verloren keine Zeit. Schon am nächsten Morgen bezogen sie zwei Büros innerhalb des Firmengebäudes. Sehr zum Leidwesen von Diethar Mykke, der sich mit der Tatsache, nicht mehr allein das Sagen über das Unternehmen zu haben, nicht anfreunden konnte.
Nachdem alle organisatorischen Dinge geklärt waren, gab es die erste Konferenz, an der auch Neve Prometh teilnahm.
»Nun, Onkelchen, was liegt heute an?«, fragte Charly salopp.
Diethar Mykke warf ihm einen bösen Blick zu, was Neve amüsierte. Sie konnte Mykke nicht ausstehen und fand den charmanten Charly Gheddy durchaus sympathisch.
Ian blickte, wie immer, alle finster an. »Wir wollen an allen wichtigen Terminen teilhaben, Onkel Diethar«, sagte er fordernd.
»Wir haben heute Mittag einen sehr wichtigen Termin mit dem Marquês von Siniestro«, erklärte Mykke in wichtigem Tonfall.
»Mit dem Marquês? Donnerwetter! Das muss ja ein enorm wichtiger Auftrag sein!«, staunte Charly.
Mykke blickte ihn finster an und schüttelte den Kopf. »Leider ist das Treffen von unerfreulicher Natur. Sein seltsamer Sohn Peter hatte den Auftrag für einen 5000-Meter-Raumer erteilt, der den Namen PETER DER GROSSE tragen sollte. Doch das durfte er anscheinend nicht. Jedenfalls will der Marquês den Auftrag stornieren.«
»Das müssen wir verhindern. Wir brauchen diesen wichtigen Auftrag«, forderte Ian.
Mykke verzog das Gesicht. »Ach nein, was du nicht sagst. Darum habe ich mit ihm für heute einen Termin vereinbart, um ihn davon abzubringen.«
»Was dir bei deinem sprichwörtlichen Charme bestimmt gelingen dürfte«, sagte Charly sarkastisch.
Neve musste innerlich lachen. Charly hatte Recht. Wenn Mykke die Verhandlungen übernahm, konnte man den Auftrag wohl endgültig abschreiben.
»Was soll das denn heißen?«, fragte Mykke entrüstet.
»Das heißt, dass Charly zusammen mit dir an der Besprechung teilnimmt«, bestimmte Ian.
»Das kommt überhaupt nicht in Frage!«, lehnte Diethar ab.
Ian sah ihn böse an. »Muss ich dich erst an das gestrige Gerichtsurteil erinnern?«
Mykke dachte einen Moment nach und stimmte schließlich zu.
*
Pünktlich um 12 Uhr traf der Marquês bei Bohmar Inc. ein und wurde von Diethar Mykke und Charly Gheddy empfangen, die ihn in Mykkes Büro geleiteten. Dort nahmen sie Platz.
Natürlich war Don Philippe alles andere als begeistert, Charly zu sehen. Schließlich wurde er von den Gheddy-Brüdern erpresst. Doch für heute, schienen beide das Thema außer Acht zu lassen.
»Ich habe nur wenig Zeit, Señores«, sagte der alte Spanier, der müde wirkte.
»Wir werden uns sicherlich schnell einigen«, meinte Charly und lächelte freundlich.
Neve kam herein und servierte einige Erfrischungen. Der Marquês war sichtlich angetan von der hübschen Sekretärin. Seine Laune besserte sich, was Charly einkalkuliert hatte.
»Es tut mir sehr leid, Señores. Ich kann verstehen, dass Sie enttäuscht sind. Aber mein Sohn Peter ist noch sehr jung. Und wenn man jung ist, hat man Träume«, erklärte Don Philippe. »Sein Traum ist es, ein Schiff wie dieses zu kommandieren, also hat er es bestellt, während ich auf Paxus weilte. Doch dazu hatte er kein Recht. Ich habe diese Transaktion nicht genehmigt und sehe mich leider gezwungen, den Auftrag zu stornieren.«
Mykke lief im Gesicht rot an und wollte etwas entgegnen, doch Charly kam ihm zuvor.
»Das ist natürlich eine peinliche Situation, verehrter Marquês. Doch bitte verstehen Sie auch uns. Wir haben alle unsere Kapazitäten für diesen Auftrag verplant und andere Aufträge dafür abgelehnt. Unsere Verluste wären immens«, sagte er treuherzig. »Durch eine Stornierung kämen wir an den Rand des Ruins. Personalabbau wäre die Folge. Das würde zu einem Vertrauensbruch zwischen der Wirtschaft und der Regierung führen. Das können Sie doch nicht wollen.«
Der Marquês wirkte nachdenklich. »Natürlich nicht. Aber was soll ich machen? 5000 Meter Durchmesser sind ziemlich viel für ein Schiff.«
Charly erkannte, dass der alte Mann müde und unentschlossen war. Dies wollte er ausnutzen.
»Denken Sie doch an das Prestige. Ein Mann wie Sie, der nun Regierungschef einer unabhängigen Regierung ist, braucht doch ein Flaggschiff. Ein Schiff, das die anderen an Glanz überstrahlt. Sicherlich hat die spanische Flotte zu Ihrer Zeit auch solch ein Flaggschiff besessen. Nutzen Sie also dieses Schiff für sich, zu Ihrem Ruhm«
Das wirkte. Charly hatte den richtigen Punkt getroffen.
»Ja, ich glaube, Sie haben recht. Ein Mann meines Standes braucht ein angemessenes Flaggschiff.«
Don Philippe überlegte noch einen Moment, dann raffte er sich auf. »Also gut, junger Mann. Sie haben mich überzeugt. Ich billige den Bau und unterzeichne den Kaufvertrag. Nur eine Änderung möchte ich vorschlagen.«
»Und welche?«, fragte Diethar Mykke misstrauisch.
»Das Schiff soll den Namen EL CID tragen, nach dem großen spanischen Volkshelden.«
»Wird gemacht. Sind wir uns einig?«, fragte Charly erfreut.
Der Marquês lächelte und gab ihm die Hand. »Das sind wir.«
Kurz darauf wurde der Kaufvertrag unterschrieben und der Marquês verabschiedete sich.
Charly und Diethar waren hochzufrieden. »Siehst du, Onkelchen. Ohne mich hättest du das nicht geschafft«, meinte Charly selbstsicher.
Mykke grummelte nur missmutig etwas in sich hinein und ging.
Charly wandte sich an Neve Prometh. »Das muss gefeiert werden, meine Schöne. Darf ich Sie zu einem Glas Champagner einladen?«, fragte er die Sekretärin, in der Hoffnung gleich den Rest des Tages mit ihr verbringen zu können.
»Tut mir Leid, aber ich bin mit schon mit Marvyn verabredet. Vielleicht ein andermal.«
Damit war Gheddy natürlich nicht zufrieden. Ausgerechnet Marvyn, diese Niete, machte ihm Konkurrenz! Aber er würde nicht aufgeben und Neve in sein Bett bekommen, so wahr er Charly Gheddy hieß.
*
Der Marquês begab sich unmittelbar nach der Besprechung in seine Villa. Er fühlte sich nicht wohl. Die letzten Tage hatten ihren Tribut gefordert. Als er, von starken Gliederschmerzen geplagt, in die Vorhalle seines Anwesens schlurfte, empfing ihn Diabolo.
Der Spanier winkte ab und hustete stark.
»Ich muss mich erst mal setzen«, stöhnte er.
Don Philippe trippelte in sein Arbeitszimmer und ließ sich dort ächzend in den Sessel fallen.
»Geht es Ihnen nicht gut, Marquês?«
»Du merkst aber auch alles«, erwiderte der alte Mann missgelaunt.
»Funktionieren Ihre Energieleitungen nicht richtig? Ach ja, bei den Humanoiden nennt man das ja Blutgefäße. Womöglich eine Arterienverkalkung!«
»Verschone mich mit Vorträgen über die menschliche Anatomie!«
»Bitte um Verzeihung, Marquês. Dabei haben Sie doch allen Grund, zufrieden zu sein. Die letzten Tage waren sehr erfolgreich für Sie. Eines Tages werden Sie vielleicht sogar den ganzen Paxus-Rat beherrschen.«
Don Philippe wirkte nachdenklich. Seine Stirn lag in tiefen, runzligen Falten. Er hustete wieder. Speichel floss aus dem Mund über sein Kinn.
»Falls ich diesen Tag noch erlebe. Wahrscheinlich habe ich mir eine Grippe zugezogen. Außerdem macht mir meine Gicht sehr zu schaffen. Sei so gut, Diabolo, und verständige den Arzt. Er soll noch heute kommen. Ich muss bald wieder gesund sein, denn es liegen große Aufgaben vor uns.«
»Wie Sie wünschen.«
Am selben Abend sprach der Arzt des Marquês, ein hoch gewachsener, hagerer Mann mit Halbglatze und einem Dutzendgesicht vor. Er untersuchte den alten Spanier eine ganze Weile in dessen Schlafgemach.
Diabolo wartete draußen, bis der Arzt fertig war. Als Doktor Nölke ging, fragte ihn Diabolo: »Nun, wie geht es dem Marquês?«
Nölke machte ein ernstes Gesicht. »Leider nicht sehr gut.«
»Was fehlt ihm denn?«
»Das kann ich noch nicht genau sagen. Es gibt mehrere Symptome. Auf jeden Fall hat er sich zu sehr überanstrengt. Ich habe ihm strikte Ruhe verordnet. Er kann vorläufig seine Amtsgeschäfte nicht ausüben. Es müssen noch weitere Untersuchungen in meiner Praxis vorgenommen werden. Das ist alles, was ich zu diesem Zeitpunkt sagen kann«, verkündete der Doktor kurzangebunden und ließ den Posbi stehen.
»Na toll. Und was sage ich der Öffentlichkeit?«, fragte sich der Roboter.
»Diabolo!«, hörte der Posbi die krächzende Stimme des Marquês.
Sofort eilte er zu dem kranken Mann, der in seinen Bett lag. Der Marquês trug ein weißes, altmodisches Nachthemd und eine Zipfelmütze auf dem Kopf und bot ein Bild des Jammers.
Hätte Diabolo die Fähigkeit zu lachen gehabt, hätte er es jetzt lauthals getan. Andererseits schien es dem alten Spanier wirklich nicht gut zu gehen. Daher enthielt er sich einer spöttischen Bemerkung.
Diabolo machte stattdessen eine knappe Verbeugung. »Zu Ihren Diensten, Marquês.«
»Diabolo, der Arzt hat mir strikte Ruhe verordnet. Ich werde seine Anweisungen befolgen. Da außerdem noch einige Untersuchungen durchgeführt werden müssen, kann ich die Regierungsgeschäfte vorläufig nicht führen. Ich übertrage daher Joak Cascal alle Vollmachten, bis ich wieder genesen bin.«
»Ich habe verstanden, Marquês. Ich kümmere mich um alles. Außerdem müssen Ihre Kinder informiert werden.«
»Ja ja, aber ich will sie nicht beunruhigen. Wir sagen ihnen, ich hätte eine Grippe. Das Gleiche gilt für die Öffentlichkeit«, erklärte der Marquês. »Stephanie muss in Kürze nach Bostich zu einem wichtigen Staatsbesuch. Darauf muss sie sich voll konzentrieren und darf nicht abgelenkt werden. Die Beziehungen zu den Arkoniden sind von immenser Bedeutung.«
»Natürlich. Ich werde alles zu Ihrer Zufriedenheit ausführen. Sie werden sich bald wieder erholen. In solchen Momenten bin ich froh, ein Posbi zu sein. Wenn bei uns etwas defekt ist, tauschen wir es einfach aus. Aber ihr organischen Wesen seid ja so kompliziert.«
»Ja ja, hör auf zu schwadronieren und geh jetzt.«
Diabolo verneigte sich und machte sich auf, um die Anweisungen des Marquês auszuführen.
Der Marquês nahm Verbindung mit Joak Cascal auf und informierte ihn über die Situation.
Cascal wünschte dem Marquês gute Besserung und war bereit, die Amtsgeschäfte sofort zu übernehmen.
3. Die de la Siniestros
»Herzlichen Glückwunsch, Orly! Du bist hiermit offiziell ins Mutantenkorps aufgenommen.«
Orly de la Siniestro strahlte, als Gucky ihm diese Mitteilung machte. Das war mehr, als er zu hoffen gewagt hatte.
Gucky verschränkte die Arme hinter dem Rücken, zog den Bauch ein, soweit es eben ging, streckte die stolzgeschwellte Brust so weit wie möglich raus und setzte ein wichtiges Gesicht auf.
»Außerdem wirst du wegen deines heldenhaften Einsatzes gegen Rijon befördert und deine Ausbildungsdauer wird verkürzt. Was bedeutet, dass es bald mehr Zaster gibt. Dann kannst du auch einen ausgeben«, sagte Gucky in seiner unnachahmlichen Art.
Orly war sprachlos, was dem Ilt nicht entging.
»Du darfst jetzt sprechen. Ich weiß, dass meine Ausstrahlung so gewaltig ist, dass jeder andere sofort eingeschüchtert in den Hintergrund tritt und sich nicht traut, mich anzusprechen, aber du hast meine gütige Erlaubnis zu reden.«
Jetzt musste Orly lachen. »Ich denke, ich kann uns jetzt schon einen Vurguzz ausgeben.«
»Danke, aber für mich bitte nur Karottensaft. Wenn ich Alkohol trinke, stelle ich die merkwürdigsten Dinge an. Wenn ich nur an die Sache damals auf der BASIS denke... Aber na ja, das gehört jetzt nicht hierher.« Der Ilt winkte ab.
Orly wurde wieder ernst. »Ich möchte dir danken, Gucky. Die Aufnahme ins Mutantenkorps habe ich deiner Fürsprache zu verdanken. Ich werde versuchen, mich deines Vertrauens würdig zu erweisen.«
Gucky nickte. »Das wirst du ganz bestimmt, Orly. Da habe ich keinen Zweifel.«
»Wenn ich doch nur den Schemen kontrollieren könnte. Ich weiß immer noch nicht, wann und warum es aktiv wird«, meinte Orly etwas ratlos.
»Keine Sorge, die anderen und ich werden versuchen, es dir beizubringen«, beruhigte ihn Gucky. »Als Mutant muss man oft viel Geduld haben, mit seinen Fähigkeiten umzugehen. Aber wenn man sie beherrscht, werden sie einem mit der Zeit vertraut und man möchte sie nicht mehr missen.«
»Ich hoffe, dass du Recht hast.«
Gucky stemmte die Arme in die Hüfte und tat beleidigt. »Na hör mal, ich habe immer recht! Ich bin der Überall-zugleich-Töter!«
Bevor Orly etwas entgegnen konnte, summte sein Armbandkommunikator. Es war seine Schwester Brettany. Sie informierte ihren Bruder über den Gesundheitszustand des Marquês.
»Vater ist erkrankt. Er leidet an einer Grippe und muss vorläufig das Bett hüten. Er hätte uns gerne um sich«, sagte sie.
»Verstanden, Brett. Ich komme, so schnell ich kann. Und ich bringe gute Neuigkeiten: Ich bin ins Mutantenkorps aufgenommen worden.«
»Das ist ja toll, Orly. Vater wird sich freuen, das zu hören. Bis bald.«
»Bis bald, Brett.«
Als Orly das Gespräch beendet hatte, verabschiedete er sich von Gucky und machte sich auf den Heimweg.
Kaum war Orly gegangen, meldete sich ein neuer Besucher bei dem Ilt an. Es war ein kleiner Mann in einem Kimono – Sato Ambush.
»Hi, Sato. Mensch, das ist ja eine Überraschung! Wo kommst du denn her?«, fragte Gucky verblüfft.
»Sei gegrüßt, Gucky. Es freut mich, dich noch genauso fröhlich wie eh und je zu sehen. Ich komme direkt von Terra und wollte Cartwheel kennen lernen. Es wird viel Interessantes in der Milchstraße darüber berichtet. Nach der Zeit der Meditation in Japan bin ich mit meiner Psi-Seele und dem Ki in Einklang gekommen und möchte wieder aktiv sein. Ich hoffe, hier eine befriedigende Aufgabe zu finden.«
»Na, das wird sich doch bestimmt machen lassen. Hier gibt es viel für fähige Köpfe wie dich zu tun«, meinte Gucky zuversichtlich.
Sato verneigte sich höflich. Dann deutete er auf Guckys Schreibtisch. »Ich danke dir für deine Wertschätzung. Ich wundere mich, dass jemand wie du in einem Büro arbeitet.«
»Nun ja, dies bringt der Ruhm so mit sich. In dieser Periode der Aufbauzeit werden starke, mutige und kluge Persönlichkeiten gebraucht. Da kam man an mir natürlich nicht vorbei«, erklärte der Mausbiber mit Stolz geschwellter Brust. »Darum habe ich mich bereit erklärt, die Ausbildung einiger vielversprechender Talente hier in Cartwheel zu übernehmen.«
»Das bringt sicher viel Verantwortung und Arbeit mit sich«, meinte der Japaner.
Gucky nickte zustimmend. »Oh ja. Da fällt mir ein, dass du mir dabei eine große Hilfe sein könntest. Wie wäre es, wenn du hier bei mir einsteigst?«
Sato verneigte sich abermals. »Das, verehrter Gucky, wäre mir ein großes Vergnügen.«
Zufrieden rieb sich der Ilt die Hände. »Fein, dann spendiere ich uns jetzt eine Runde Karottensaft.«
*
Als Orly nach Hause zurückgekehrt war, suchte er sofort seinen kranken Vater auf. Der Marquês freute sich, den jungen Mann zu sehen.
»Vater, ich hoffe es geht dir wieder besser«, sagte Orly besorgt.
Der Marquês lächelte. »Ja, es geht mir schon wieder besser. Der Arzt sagt, es ist eine seltene Grippe, daher muss ich eine Weile das Bett hüten. Aber das wird schon wieder.«
»Dann bin ich beruhigt. Ich habe erfreuliche Neuigkeiten. Ich wurde auf Grund meiner Leistungen gegen Rijon ins Mutantenkorps aufgenommen.«
»Das ist schön. Dann ist unsere Familie auch dort würdig vertreten«, freute sich Don Philippe, der sich erschöpft in sein großes Kopfkissen zurücklehnte. »Wenn ich mal nicht mehr bin, möchte ich, dass ihr mein Werk fortsetzt. Ihr vier müsst zusammenhalten, allen Widerständen zum Trotz. In einer Familie kann es immer mal Auseinandersetzungen geben, aber wenn es darauf ankommt, muss die Familie zusammenhalten. Nur dann ist sie stark. Sorge du dafür, Orly. Versprich es mir.«
Orly schluckte. So hatte er seinen Vater noch nie erlebt. Es machte ihm Angst. »Ich verspreche es dir, Vater. Doch nun ruhe dich aus, damit du bald wieder gesund wirst.«
Der Marquês nickte und schenkte seinem Sohn ein gütiges Lächeln. »Ich bin stolz auf dich und deine Leistung, Orly. Nun lass mich bitte allein, damit ich deinen Rat befolgen kann.«
Orly verabschiedete sich und ging hinunter ins Wohnzimmer. Dort saßen seine drei Geschwister Brettany, Stephanie und Peter.
»Orly! Wie schön, dass du wieder da bist«, wurde er von Brettany freundlich begrüßt.
Stephanie und Peter, der eine alte preußische Uniform aus dem 18. Jahrhundert trug, warfen ihm dagegen finstere Blicke zu.
»Wird ja auch Zeit, dass sich Orlando die Ehre gibt. Während unser Vater krank darniederliegt, treibst du dich in der Weltgeschichte herum und spielst Superman«, beschuldigte ihn Stephanie.
»Wie kannst du so etwas sagen, Stephanie! Orly hat es erst vor wenigen Stunden von mir erfahren und ist sofort hierhergekommen!«, stellte Brettany klar.
»Genauso ist es. Ich war eben bei Vater. Er hat sich sehr über meine Aufnahme in das Mutantenkorps gefreut.«
Stephanie sah ihn nur abfällig an und schwieg.
Dafür meldete sich Peter zu Wort. »Mutantenkorps! Wenn ich das schon höre! Das ist doch ein Haufen voller entarteter Freaks! Und so etwas darf ungestraft eine reguläre, militärische Bezeichnung tragen.«
»Das kannst du wohl kaum beurteilen, Peter! Das Mutantenkorps gab es schon zur Pionierzeit des von dir so geschätzten Solaren Imperiums«, verteidigte sich Orly. »Es ist jetzt neu aufgestellt worden und wird uns große Vorteile bringen. Das hat sich gerade erst im Kampf gegen Rijon gezeigt.«
»Das ist ja lächerlich. Es geht nichts über die Schlagkraft einer Flotte und einer Armee!« Peters Gesicht lief rot an, während er sich in Rage redete. »Das kann ich als Militärexperte ja wohl am besten beurteilen.«
Orly verzog unwillig das Gesicht. »Du und Experte! Wie wäre es, wenn du dir endlich mal einen vernünftigen Job suchen würdest, anstatt den ganzen Tag mit deinen Spielzeugsoldaten zu vergeuden? Damit würdest du Vater eine große Freude machen.«
Das war zu viel für Peter. Wütend sprang er aus seinem Sessel, dabei stieß er jedoch versehentlich eine Karaffe mit Orangensaft um, die vor ihm auf dem Tisch stand und verschmutzte damit seine schöne blaue Uniform. Peters Geschwister brachen in Gelächter aus.
»Lass gut sein, Peter. Wir wollen uns vertragen«, sagte Orly versöhnlich. »Es ist Vaters Wunsch, dass wir gut miteinander auskommen. Das sollten wir beherzigen.«
»Nein! Ihr habt über mich gelacht! Ich hasse alle, die über mich lachen!«, schrie Peter seine Geschwister an. »Ich bin ein großer General, das werde ich euch schon noch zeigen!«
»Aber Peter, wir haben es doch nicht so gemeint. Es war nur so lustig«, entschuldigte sich Brettany.
»Du bist halt eine Witzfigur«, fügte Stephanie hämisch hinzu.
Fassungslos rang Peter nach Worten. »Ich... ich hasse euch!«, brach es aus ihm heraus. Dann rannte er aus dem Zimmer.
»Musste das sein, Stephanie?«, fragte Orly vorwurfsvoll.
Stephanie winkte ab. »Ach, lass ihn doch. Der beruhigt sich schon wieder. Ich habe an Wichtigeres zu denken. Übermorgen fliege ich mit Peter zu einem wichtigen diplomatischen Besuch nach Bostich. Dort treffen wir uns mit Uwahn Jenmuhs und Toran Ebur, dem Führer der Zaliter. Darauf muss ich mich vorbereiten.«
»Du hast Recht. Das ist natürlich wichtig«, stimmte Orly zu. »Meinst du, dass Peter das auf die Reihe kriegt?«
»Dafür sorge ich schon. Auf mich hört er. Passt ihr beide solange gut auf Vater auf.«
»Das machen wir«, versprach Brettany.
So verschieden die vier Klone auch waren, den Marquês liebten sie alle abgöttisch.
*
Am nächsten Tag reisten Stephanie und Peter nach Bostich ab. Während Orly bei Don Philippe blieb, machte Brettany mit Uthe Scorbit, die sich mit ihr angefreundet hatte, einen Stadtbummel, um ihrem Vater ein Geschenk zu besorgen. Zufälligerweise trafen sie dort auf Charly Gheddy.
»Das ist ja ein Zufall. Und so ein Glück für mich, dass ich zwei solch bezaubernde Damen treffe. Darf ich die Damen zu einem Kaffee einladen?«, fragte er charmant.
Uthe war davon nicht sonderlich erfreut. Schließlich war er der Neffe der Braunhauers. Und mit Angehörigen dieser Familie hatte sie nicht gerade gute Erfahrungen gemacht. Doch Brettany stimmte zu und so blieb auch Uthe keine andere Wahl.
Da es ein schöner Sonnentag war, setzten sich auf die Terrasse eines Cafés. Als sie ihre Bestellungen aufgegeben hatten, sagte Charly:
»Ich habe von der Krankheit Ihres Vaters gehört. Das tut mir sehr Leid. Ich hoffe, er wird bald wieder gesund.«
»Er leidet an einer seltenen Grippe. In seinem Alter muss er sich sehr schonen«, entgegnete Brettany. »Aber er befindet sich schon auf dem Wege der Besserung.«
Charly nickte bedächtig. »Das freut mich zu hören. Auch meine Mutter wird das sehr freuen.«
»Ihre Mutter?«, fragte Uthe misstrauisch. Schließlich war Dorys Gheddy die Schwester von Ottilie Braunhauer. Da war Vorsicht geboten.
Charly sah die beiden Frauen mit bedeutungsvoller Mine an. »Ich kann Ihnen doch etwas anvertrauen, nicht wahr?«, fragte er geheimnisvoll.
»Aber natürlich«, versicherte Brettany.
»Meine Mutter Dorys und ihr Vater hegen liebevolle Gefühle füreinander. Ich finde das sehr schön, dass auch Menschen ihres Alters noch mal das Glück der Liebe erleben dürfen«, erklärte Charly salbungsvoll.
»Wie bitte?«, fragte Brettany entgeistert. Davon hatte ihr Vater niemals etwas gesagt.
Charly nickte. »Ja, so ist es.«
Plötzlich stand er auf.
»Was für ein Zufall. Da kommen ja meine Mutter und mein Bruder Ian. Bitte erwähnen Sie meiner Mutter gegenüber nichts davon, was ich eben zu Ihnen sagte. Es soll nichts davon bekannt werden.«
Bevor Brettany und Uthe antworten konnten, winkte Charly seine Angehörigen herbei. Mit schlurfenden Schritten nahte Dorys Gheddy, gefolgt von ihrem finster wirkenden Sohn Ian.
Dorys stöhnte, als hätte die ganze Last des Universums auf ihren Schultern zu liegen.
»Ah, ich muss mich mal setzen. Junge Frau, stehen Sie auf und überlassen mir den Stuhl!«, verlangte sie von Uthe.
Uthe wollte zunächst protestieren, aber schließlich war sie Sozialministerin und wollte hilfsbereit gegenüber älteren Menschen sein. Also stand sie auf.
»Aber bitte bleiben Sie doch sitzen. Ich hole noch zwei Stühle«, bot Charly an. Als Charly seiner Mutter den Stuhl brachte, ließ diese sich ächzend nieder.
»Ich brauch jetzt erst mal einen Kaffee und 'ne Zigarette. Ian, bestell mir einen Kaffee. Charly, zünde mir mal eine an!«, befahl sie ihren Söhnen in herrischem Tonfall.
Nachdem Dorys endlich, nach umständlichem Hin und Her Platz genommen hatte, fragte Uthe beunruhigt: »Gedenken Sie und ihre Familie länger auf Mankind zu verweilen?«
»Hä?«, fragte Dorys, da sie offenbar die Formulierung der Frage nicht verstanden hatte.
»Ja, solange es meiner Tante Ottilie schlecht geht, bleiben wir auf jeden Fall«, antwortete Charly statt ihrer.
»Oh, ich hoffe, es geht Frau Braunhauer bald besser.«
Dorys nahm einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette. »Ja, es geht ihr schon etwas besser. Sie ist inzwischen aus dem Koma erwacht. Aber sie ist noch reichlich verwirrt, darum müssen wir uns um sie kümmern.«
Als ob die vorher nicht verwirrt gewesen wäre, dachte Uthe bei sich.
»Es ist schön, wenn eine Familie so zusammenhält«, meinte Brettany warmherzig.
»Unsere Familie besteht aus Aasgeiern. Die Mykkes wollten unsere Tante und uns um die Firma betrügen. Aber das haben wir verhindert, nicht wahr, Mutti?«, meldete sich nun auch Ian in drohendem Tonfall zu Wort.
Dorys nickte zustimmend. »Ja, das haben wir, mein Liebling. Dieser fette Sack und seine dürre Vogelscheuche von Frau werden uns niemals um unser Eigentum betrügen.«
Brettany erschrak vor dem Tonfall dieser Leute. Für diese Frau sollte ihr Vater Gefühle hegen? Das konnte sie kaum glauben. Auch das Äußere der Frau war alles andere als attraktiv. Sie wirkte billig und schlampig.
Uthe hingegen war nicht verwundert. Sie wusste aus eigener Erfahrung, dass die Angehörigen der Familie Braunhauer allesamt gestört waren. Warum sollten die Gheddys da eine Ausnahme machen?
Dorys wandte sich nun Brettany zu. »Sie, mein Kind, sind doch die Tochter von Don Philippe, nicht wahr?«
»Ja, das bin ich«, bestätigte Brett.
»Ich habe gehört, dass es Ihrem Vater nicht gut geht«, meinte die Gheddy. »Das tut mir aber Leid. Ich werde ihn bald mal besuchen kommen. Er kann jetzt die zarte Pflege einer Frau gebrauchen.«
»Mein Vater erhält die bestmöglichste Pflege. Das kann ich Ihnen versichern.«
»Aber natürlich. Doch seelische Betreuung wird ihm sicher gut tun. Also keine Widerrede, mein Kind, ich werde kommen«, sagte Dorys höflich, aber bestimmt.
Brettany war von Haus aus gutmütig und war nicht in der Lage, zu widersprechen. »Also gut, ich werde meinen Vater fragen.«
Dorys strahlte. »Gut so, mein Kind, gut so. Und jetzt brauch' ich einen Schnaps.«
*
Nachdem sich die Gheddys von den beiden Frauen verabschiedet hatten, gingen sie getrennte Wege. Ian und Dorys kehrten in ihre Wohnung zurück, während Charly noch einen Abstecher zu Bohmar Inc. machte. Er hatte ein Auge auf die attraktive Neve Prometh geworfen und wollte sie für sich erobern. Bislang hatte sie jedoch all seine Annäherungsversuche abgewiesen, da sie mit Marvyn Mykke liiert war. Doch Charly war nicht der Mann, der so leicht bei einer Frau aufgab. Deshalb besorgte er einen großen Blumenstrauß und machte Neve in ihrem Büro Aufwartung.
Neve war durchaus erfreut, Charly Gheddy wiederzusehen. Sie fand ihn charmant und witzig. Eigenschaften, die Marvyn leider fehlten, wie sie fand.
»Hallo, schöne Dame. Darf ich Ihnen als neuer Teilhaber der Firma Bohmar Inc. dieses kleine Präsent überreichen?«, fragte Gheddy hochtrabend und überreichte Neve den riesigen Blumenstrauß.
»Oh, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich eine passende Vase habe.«
Charly ging vor die Tür und kam mit einer großen Vase wieder.
»Ich habe an alles gedacht, die Dame«, sagte er und machte eine tiefe Verbeugung.
Neve musste lachen. Das schätzte sie an Charly. Er brachte sie zum Lachen. In der Umgebung der Mykkes herrschte oft eisige Kälte oder Missstimmung, was sich oft auch auf Neves Gemüt negativ auswirkte.
»Darf ich Sie heute Abend zum Essen einladen, schöne Lady?«
Diethar Mykke drängte plötzlich mit seiner ganzen Leibesfülle herein.
Er deutete auf die Blumenvase. »Wat is'n hier los? Sind wir hier im Dschungel, oder was?«
»Eine kleine Anerkennung für eine gute Mitarbeiterin der Firma«, erklärte Charly.
Mykke verzog unwillig das Gesicht. »Gute Mitarbeiterin? Dass ich nicht lache! Ich hab jetzt die Faxen dicke! Prometh, Sie sind gefeuert!«, keifte der korpulente Mann. Sein Gesicht lief dabei rot an. Es war Mykke nach wie vor ein Dorn im Auge, dass Neve mit seinem Sohn ein Verhältnis hatte. Er wäre sie lieber heute als morgen losgeworden.
Charly trat Mykke entgegen. »Einen Moment mal, da haben Ian und ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wir halten Miss Prometh für eine hervorragende Mitarbeiterin. Wenn du sie nicht mehr haben willst, nehme ich sie gern in meinen Dienst.«
Mit so viel Widerstand hatte Mykke nicht gerechnet. Er gab nach. »Ist ja schon gut. Macht doch was ihr wollt, aber kommt mir nicht in die Quere«, murmelte er verärgert und ging wieder in sein Büro zurück.
»Vielen Dank. Der hätte mich glatt an die Luft gesetzt, wenn Sie nicht da gewesen wären«, bedankte sich Neve bei Charly.
Gheddy lächelte entwaffnend. »Dafür schulden Sie mir jetzt ein Essen, Neve.«
Neve lachte. »Also gut, Sie haben gewonnen. Heute Abend kann ich leider nicht, aber morgen Mittag können wir gern essen gehen.«
»Einverstanden, bis dann«, zeigte sich Charly zufrieden. Er war zuversichtlich, Neve bald für sich gewonnen zu haben. Marvyn würde ihm dabei kein großes Hindernis sein.
4. Staatsbesuch auf Bostich
Es war auch ein schöner, sonniger Tag auf Bostich, als Stephanie und Peter de la Siniestro dort zu ihrem Staatsbesuch eintrafen. Ihr Kugelraumer landete auf dem Raumhafen der Hauptstadt Ranton.
Peter war etwas unzufrieden, weil sie nur einen 1500-Meter-Raumer für ihren Flug benutzt hatten. »Das nächste Mal, wenn wir hierher kommen, nehmen wir ein Schlachtschiff, das meiner würdig ist«, maulte er. »Die PETER DER GROSSE!«
Stephanie lächelte hämisch. »Wenn wir ein Schiff nehmen würden, das deiner würdig ist, müssten wir einen Modellraumer für Kinder nehmen.«
»Du bist so gemein zu mir!«, regte sich Peter auf.
»Beruhige dich. Konzentrieren wir uns lieber auf den bevorstehenden Empfang bei Jenmuhs. Du sprichst mit ihm über militärische Dinge, ich kümmere mich um die Diplomatie.«
»Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die arkonidischen Soldaten. Sie sollen die besten der Milchstraße sein«, gab sich Peter versöhnlich.
Kurz darauf verließen die beiden das Raumschiff und schritten die Gangway zum arkonidischen Empfangskomitee herunter. Stephanie trug ein bezauberndes weißes Kleid und Peter hatte eine spanische Generalsuniform des 18. Jahrhunderts angelegt.
An der Spitze der arkonidischen Delegation stand ein gut aussehender, groß gewachsener, muskulöser Zaliter in einer prächtigen blauen Uniform. Er trat auf die beiden Siniestros zu und begrüßte sie.
»Willkommen auf Bostich. Ich heiße Sie im Namen des Erhabenen Kristallkönigs willkommen. Der Erhabene erwartet sie in seinem Palast. Eine Eskorte steht bereit, Sie dorthin zu geleiten.«
Stephanie wusste, um wen es sich dabei handelte. Sie hatte alle Persönlichkeiten im Umfeld von Uwahn Jenmuhs gründlich studiert.
»Ich danke Ihnen für Ihre Freundlichkeit, Toran Ebur. Ich hoffe, der große Anführer der Zaliter wird uns die Ehre erweisen, uns persönlich zum Palast zu begleiten«, erwiderte sie freundlich und hoheitsvoll zugleich.
Der imposante Toran Ebur gab das Lächeln zurück. »Es ist mir eine große Ehre.«
»Vorher will ich aber die Soldaten inspizieren, Thek'Athor!«, machte Peter auf sich aufmerksam, der irritiert darüber war, dass seine Schwester Stephanie mehr Aufmerksamkeit erhielt.
Toran Ebur wandte sich nun ihm zu. »Selbstverständlich. Die arkonidisch-zalitische Garde steht zum Abschreiten bereit.«
Der Zaliter hatte sich offensichtlich ebenso gründlich über die Siniestros informiert, da er ihre Eigenarten kannte.
Kurz darauf schritten die drei, unter den Klängen eines imposanten arkonidischen Militärmarsches, die angetretene Ehrenkompanie ab. Peter, der hier voll in seinem Element war, zeigte sich höchst beeindruckt von der Disziplin der arkonidischen Soldaten. Stephanie langweilte die Militärparade eher. Sie interessierte sich mehr für den blendend aussehenden Toran Ebur.
Als die Ehrenformation abgeschritten worden war, geleitete sie Ebur zu einem Fluggleiter, der sie quer über die Stadt Ranton flog. Der zalitische Führer steuerte selbst.
»Wir hätten auch einen Transmitter benutzen können, doch so haben Sie Gelegenheit, sich die Hauptstadt anzusehen«, meinte Ebur. »Außerdem fliege ich lieber selbst. Das ist aufregender.«
»Das ist eine fabelhafte Idee«, zeigte sich Stephanie erfreut.
Der Zaliter gefiel ihr immer besser. Sie fühlte sich besonders von seinem Äußeren angezogen, aber auch die Art und Weise Toran Eburs behagte ihr.
Nachdem man die prächtige Hauptstadt besichtigt hatte, landete man auf dem Flugfeld von Uwahns Jenmuhs' pompösen Palast. Der Arkonide hatte sich dort einen Prachtbau hingestellt, der sich vor den Palästen von Arkon I nicht zu verstecken brauchte.
Toran Ebur führte seine beiden Gäste vom Flugfeld zum Eingang des Palastes. Dort stand Uwahn Jenmuhs. Links und rechts von ihm ein Spalier von arkonidischen Orbtons. Ein Robotorchester spielte den arkonidischen Imperator-Marsch.
Peter lief es kalt den Rücken herunter. Eines Tages würde auch er solch einen prächtigen Palast wie Jenmuhs haben und dann würden seine Soldaten vor ihm paradieren und er würde sie drillen!
Als sie die Reihen der Soldaten abgeschritten hatten, standen sie vor Uwahn Jenmuhs, der auf Stephanie den Eindruck eines zu fett geratenen Pinguins machte.
Jenmuhs hingegen war von der Schönheit der jungen Frau höchst angetan.
»Ich, der Gos’Shekur – der Kristallkönig – von Bostich, mächtigster Herrscher Cartwheels, begrüße Sie.«
»Habt vielen Dank, Zdhopanda. Mögen sich die Beziehungen unser beider großen Nationen durch unseren Besuch erheblich verbessern. Ich sende Ihnen die Grüße meines Vaters, des Marquês von Siniestro, des Vaters der Menschheit. Er lässt Ihnen durch mich dieses Geschenk zukommen.«
Stephanie winkte einen Begleiter ihrer Delegation heran, der Uwahn Jenmuhs einen alten, wertvollen spanischen Degen aus Toledo übergab.
Der fette Arkonide gab sich interessiert. Er schwang den Degen hin und her.
»Richten Sie Ihrem Vater meinen Dank aus. Doch nun darf ich Sie bitten, mir in mein bescheidenes Domizil zu folgen. Ein kleiner Imbiss wurde für uns vorbereitet.«
Jenmuhs führte die terranische Delegation durch seinen gewaltigen Palast. Stephanie war sicher, dass Jenmuhs absichtlich protzte, um zu demonstrieren, dass er der mächtigste Herrscher innerhalb Cartwheels war. Sie beschloss, sich nicht davon beeindrucken zu lassen.
Nachdem Jenmuhs all seine Reichtümer zur Schau gestellt hatte, begab man sich in den riesigen Festsaal, in dem der »kleine Imbiss«, ein 16-Gänge-Menü der köstlichsten arkonidischen und terranischen Gerichte, serviert wurde.
Stephanie saß neben Toran Ebur, was sie freute. Der Zaliter war der Einzige in Jenmuhs Umgebung, der ihr sympathisch war. Sie begehrte ihn und wollte ihn haben.
Peter saß neben Jenmuhs. Die beiden kamen sich rasch näher, denn Peter teilte viele Ansichten des Arkoniden.
»Ich finde Ihre Armee einfach großartig. Wir können noch viel von ihrem Militär lernen. Ich werde mich zuhause dafür einsetzen, dass unsere Armee auch so gedrillt wird. Schade nur, dass dieser Joak Cascal Verteidigungsminister ist. Er wirkt so unmilitärisch«, meinte Peter verächtlich.
»Das ist wirklich bedauerlich. Sie gäben einen viel besseren Oberbefehlshaber ab. Ich kann diesen Cascal auch nicht ausstehen. Er steht den guten Beziehungen unserer beiden Völker im Weg. Wir wären sehr an terranischen Waffentechniken interessiert, aber Cascal lehnt jeden Austausch ab.«
»Ich hasse ihn so sehr«, zischte Peter, der schon einige Gläser Wein geleert hatte.
Jenmuhs stellte interessiert fest, dass es offenbar Rivalitäten innerhalb der terranischen Führungsschicht gab. Peter schien ein vielversprechender Verbündeter zu sein. Er war nicht der Klügste und leicht zu beeinflussen. Man musste ihn fördern.
»Nur Geduld, mein Freund. Qualität setzt sich am Ende immer durch. Ihr Besuch hier hat dank Ihrer hervorragenden diplomatischen Fähigkeiten die Beziehungen zwischen unseren großen Nationen verbessert«, schleimte Jenmuhs. »Das werde ich Ihren Vater wissen lassen.«
»Vielen Dank. Unsere Nationen sind die wichtigsten innerhalb Cartwheels«, redete sich Peter in Rage. »Wir müssen zusammenhalten, um gegen die Blues, Topsider und andere nichtmenschliche Wesen bestehen zu können. Schließlich stammen wir von demselben Volk ab. Die anderen Völker sind eine Bedrohung für unsere Reiche! Dieser Bedrohung kann man nur militärisch begegnen!«
Jenmuhs war höchst erfreut, das zu hören. Auch er war dieser Meinung.
Schon in den 80ziger Jahren hatte es auf Mashratan ähnliche Bestrebungen gegeben. Ob nun Michael Shorne, Oberst Kerkum, Arno Gaton oder Spector Orbanashol – sie alle hatten die Lemurerabkömmlinge für die Krönung der Schöpfung gehalten. Die Mordred war bestrebt gewesen, die Terraner und Arkoniden zu neuem Ruhm zu führen. Nicht umsonst hatte Jenmuhs damals dort mitgemacht, sich jedoch rechtzeitig wieder abgewandt, als die Mordred begann zu zerfallen.
Und wenn die richtigen Leute an der terranischen Regierung waren, war er einem Bündnis nicht abgeneigt. Schließlich war man jetzt unabhängig und Imperator Bostich war weit weg. Sollten sich er und Rhodan doch gegenseitig vernichten. Jenmuhs wollte sein eigenes Imperium errichten. Dazu war ihm jedes Mittel und jeder Verbündete recht.
»Sie haben Recht, mein Freund. Die Unabhängigkeit Cartwheels erlaubt uns nun neues Bündnisdenken. Wir sollten unsere militärische Zusammenarbeit verstärken. Ein gemeinsames Manöver unserer Streitkräfte wäre durchaus denkbar. Wir müssen uns gegen die minderwertigen Lebensformen wappnen, die unsere Kultur und unsere Errungenschaften zerstören wollen.«
Peter hob sein Weinglas. »Darauf trinke ich.«
In einem Atemzug leerten er und Jenmuhs ihre Gläser.
»Wie ich sehe, kommt man sich näher«, sagte Toran Ebur zu Stephanie und deutete auf die beiden neuen Freunde.
Stephanie setzte ihr charmantestes Lächeln auf. »Ja, das ist sehr erfreulich. Ich finde, da sollten wir nicht zurückstehen. Jenmuhs hat uns Zimmer zur Verfügung gestellt. Ich finde, wir sollten in privaterer Umgebung die weiteren Dinge besprechen. Es gibt noch wirtschaftliche Fragen zu erörtern.«
Toran lächelte zurück. »Ich bin auch sehr dafür, unsere Beziehung zu vertiefen«, sagte er doppeldeutig.
»Dann sollten wir das tun.«
Nach dem Empfang begaben sich Stephanie und Toran Ebur auf ihr Zimmer, wo sie die ganze Nacht miteinander verbrachten.
*
Am nächsten Tag fanden noch einige bilaterale Besprechungen statt. Anschließend stand die Abreise bevor. Stephanie hatte viele glitschige und schlappe Hände von alten Politikern und Würdenträgern schütteln müssen. Umso glücklicher war sie, Toran Ebur wiederzusehen. Als sie allein waren, küssten sie sich leidenschaftlich.
»Die letzte Nacht war phantastisch. Wir müssen das unbedingt wiederholen«, meinte Toran.
»Ja, das sollten wir. Ich lade dich hiermit offiziell zu einem Gegenbesuch ein«, entgegnete Stephanie.
»Und ich nehme hiermit dankend an.«
Bevor sie sich nochmals küssen konnten, platzte Peter herein. »Steph, wo bleibst du denn? Der Erhabene Jenmuhs wartet auf uns, um uns zu verabschieden«, ermahnte er seine Schwester.
»Ich komme ja schon«, erwiderte sie in zickigem Tonfall.
Kurz darauf verabschiedete man sich von Uwahn Jenmuhs.
»Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Sie beide haben mir gezeigt, dass man mit Terranern durchaus vernünftig kooperieren kann. Heute wurde ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen. Die Unabhängigkeit Cartwheels erlaubt uns, völlig neue Wege zu gehen und neue Bündnisse zu schließen. Bestellen Sie Ihrem Vater meine besten Grüße und übermitteln Sie ihm meinen Wunsch zu guter Zusammenarbeit. Wir sind von vielen Feinden umgeben, die wir nur gemeinsam bezwingen können.«
»Mein Vater wird sehr erfreut sein, dies zu hören. Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft und spreche hiermit eine Einladung an Sie aus, uns auf Mankind zu besuchen«, sagte Stephanie höflich.
»Ich nehme Ihre Einladung mit Freuden an, meine Teure«, erwiderte Jenmuhs und küsste Stephanies Hand.
Die junge Frau musste sich stark beherrschen, das Gesicht nicht zu verziehen, denn ihre Hand war nun voller Speichel. Sie ekelte sich vor Jenmuhs und war froh, endlich von ihm wegzukommen. Ansonsten war sie mit dem Besuch sehr zufrieden. Ihre diplomatischen Erfolge würden ihrer politischen Karriere einen bedeutenden Schub geben.
Auch Peter hatte seine Sache gut gemacht. Man konnte positiv gestimmt nach Hause zurückkehren.
5. Rache des Arkoniden
Als die terranischen Gäste abgeflogen waren, begab sich Uwahn Jenmuhs in sein Arbeitszimmer. Die attraktive Stephanie de la Siniestro erinnerte ihn daran, dass er eine Frau zutiefst begehrte – die junge Zechonin Anica.
Er war nun nicht mehr gewillt, länger zu warten, und entschlossen, Schritte einzuleiten, um die Zechonin so bald wie möglich in sein Schlafgemach zu bekommen. Außerdem plante er noch eine weitere Untat. Der Tod seines Bruders musste endlich gerächt werden.
Das Wesen, das seine Pläne ausführen sollte, betrat das Arbeitszimmer. Es war ein groß gewachsener, unheimlich wirkender Topsider, der nur noch ein Auge besaß.
»Willkommen, Krek Soron. Ich habe einen kleinen Auftrag für dich. Sollte er gelingen, folgt ein weitaus größerer, was dein Schaden nicht sein soll«, begrüßte Jenmuhs den Neuankömmling.
Der Arkonide hatte extra einen außerarkonidischen Söldner ausgewählt, damit niemand auf die Idee kam, dass ein Arkonide hinter all dem steckte. Krek Soron galt als einer der besten Söldner und Kopfgeldjäger und hatte schon des Öfteren Aufträge für Jenmuhs ausgeführt.
»Gut«, sagte der Topsider nur.
Jenmuhs übergab ihm eine Holographie von Anica. »Du sollst mir dieses Mädchen herbringen, unauffällig versteht sich. Alle Daten über sie und ihren Aufenthaltsort auf Mankind findest du auf diesem Datenspeicher.«
Krek Soron, der kein Freund vieler Worte war, nahm die Daten an sich, die ihm Jenmuhs übergab.
»Du bekommst von mir die Hälfte der Summe im Voraus, wie immer«, sagte der Arkonide.
»Gut«, gab sich der Söldner zufrieden.
»Wie lange wird es dauern, bis du sie hast?«, wollte Jenmuhs wissen.
»Ein paar Tage. Ich muss sie observieren«, antwortete Krek Soron.
Jenmuhs war zufrieden. Bald schon würde Anica seine Gespielin sein.
*
Eine Woche später meldete Krek Soron den Erfolg und bekam die Anweisung, direkt auf dem Landefeld des Palastes zu landen.
Schließlich hatten sie Bostich erreicht. Soron und Anica stiegen aus und wurden von zwei Soldaten in Empfang genommen, die sie in Jenmuhs Thronsaal eskortierten. Dort saß der dicke Arkonide wie ein mittelalterlicher Herrscher auf seinem Thron und triumphierte.
»Ich bin Uwahn Jenmuhs. Dein neuer Herr und Meister. Von nun an bist du mein Besitz. Du wirst mir jede Freude und jede Wonne bereiten, die ich wünsche, teure Anica.«
Der dicke Arkonide erhob sich ächzend aus seinem Thron und nahm Anica bei der Hand. »Komm mit. Ich zeige dir, wo du jetzt wohnen wirst.«
Jenmuhs zog die Zechonin mit sich und führte sie in eine prachtvolle Suite. Das Zimmer war prunkvoll eingerichtet und übertraf alles, was sie bisher gesehen hatte. Dort ließ er die eingeschüchterte Zechonin zurück, die sich nicht gegen die Macht des Arkoniden wehren konnte. Zweifellos würde man sie auf Mankind suchen, doch niemals im Palast von Ranton. Anica gehört nun dem Gos’Shekur.
Dieser kehrte gut gelaunt in seinen Audienzsaal zurück.
»Gut gemacht, Topsider. Du hast dir dein Geld verdient«, sagte der Arkonide und gab Soron den Rest der vereinbarten Summe. »Nun zu deinem nächsten Auftrag. Wenn du den erfüllst, kannst du dich zur Ruhe setzen...«
»Ich höre«, sagte dieser nur.
Jenmuhs zeigte ihm die Holographien zweier Humanoiden. Eines Terraners und einer Halbarkonidin. »Dies sind Wyll und Rosan Nordment. Sie leben auf Terra. Sie sind schuld am Tod meines Bruders. Ich will, dass sie sterben. Töte sie und du kannst dich für immer zur Ruhe setzen!«
Krek Soron prägte sich die Bilder aufmerksam ein.
»Sie sind tot«, sagte er kalt.
»Je grausamer sie sterben, desto besser. Morgen geht von hier ein Konvoi mit Bodenschätzen für das Kristallimperium zur Milchstraße. Schließe dich ihm an. Wenn du die Milchstraße erreichst hast, begibst du dich nach Terra und führst deinen Auftrag aus. Wenn du erfolgreich warst, kehrst du sofort hierher zurück. In Cartwheel wird man wohl kaum nach dem Mörder suchen.«
»Ich bringe dir ihre Köpfe«, versprach Krek Soron.
Das war genau das, was Jenmuhs hören wollte. Zufrieden verabschiedete er Soron und lehnte sich genüsslich in seinem Sessel zurück. Inzwischen mussten Uthe und Remus Scorbit Anica vermissen. Sie würden sicherlich sehr besorgt sein und verzweifelt nach ihr suchen. Jenmuhs freute sich darüber.
*
»Was heißt, es gibt keine Spur von ihr? Irgendwo muss sie doch sein!«, regte sich Uthe auf.
Sofort nach Anicas Verschwinden hatte sie die Behörden alarmiert. Doch bevor Anica nicht 24 Stunden lang als vermisst galt, konnte die Polizei nichts unternehmen. So verging ein Tag, an dem nichts geschah. Als Uthe vorschriftsmäßig eine Vermisstenanzeige aufgab, begann die Polizei endlich zu ermitteln, jedoch ohne Erfolg. Nichts wies auf eine Entführung hin. Nach einer Woche erstattete ein Polizist Uthe Bericht.
»Wir haben alle Krankenhäuser und sämtliche Leichenschauhäuser nach ihr abgesucht. Nirgendwo ist eine Zechonin zu finden. Wir stehen vor einem Rätsel«, erklärte der leitende Polizeibeamte.
»Dann suchen Sie eben weiter! Sie müssen sie finden!«, schrie Uthe den Mann an.
»Jawohl, wir tun, was wir können«, sagte der Beamte pikiert und verließ Uthes Wohnung.
Uthe fing an zu weinen.
Ihr Mann Remus legte seine Hände auf ihre Schultern und versuchte sie zu beruhigen. »Vielleicht hat sie sich nur verlaufen. Bestimmt hören wir bald von ihr. Sie ist garantiert noch am Leben.«
»Das ist alles meine Schuld. Ich hätte besser auf sie aufpassen sollen. Wie soll sie sich denn alleine zurechtfinden?«
»Du hast schließlich noch einen Job, der dich voll in Anspruch nimmt. Wenn es dich beruhigt, frage ich Jan, ob er Nachforschungen anstellen lassen kann«, schlug Remus vor.
Uthe beruhigte sich wieder und nickte zustimmend. »Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht kann er etwas herauskriegen.«
6. Killer auf Terra
Krek Soron hatte sich weisungsgemäß mit dem arkonidischen Konvoi in die Milchstraße begeben. Der Flug vom Sternenportal hin zur Milchstraße dauerte nur drei Wochen, so dass der Topsider Ende September 1298 NGZ die Milchstraße erreichte.
Jenmuhs hatte sehr schnelle Transporter losgeschickt. Als man die Heimatgalaxis erreicht hatte, trennte sich der Topsider von den Arkoniden und nahm Kurs auf Terra.
Rosan und Wyll Nordment, die Helden der Abenteuer auf der LONDON I und LONDON II, ahnten nichts von der Gefahr, die unaufhaltsam auf sie zukam. Sie verlebten ruhige Tage in ihrem Appartement in Terrania-City. Nach einigen Jahren erfolgreichen Zusammenlebens wünschten sie sich ein Kind und wollten ein normales, ruhiges Familienleben führen. Darum hatten sie auch einige, nicht uninteressante Angebote der Neuen USO ausgeschlagen, für diese Organisation zu arbeiten. Doch die beiden wollten nicht mehr kämpfen und ihr Leben riskieren. Die dramatischen Abenteuer auf der LONDON I und dem Nachfolgeschiff LONDON II hatten ihnen gereicht.
Das hieß aber nicht, dass sie untätig waren. So engagierte sich Rose auf Welten, in denen es Wesen, besonders Kindern, schlecht ging. Sie hatte etliche Hilfsfonds gegründet und sammelte für die Notleidenden in der Galaxis, für die beispielsweise die Arkoniden nichts übrig hatten.
Rosan hatte zum Beispiel den Mashratan-Fonds gegründet, um finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Jenen Mashraten, die sich vom Vhrato-Kult lossagen wollten oder schlichtweg ein normales, modernes und freies Leben führen wollten, wurde damit der Ausstieg ermöglicht. Auf Mashratan selbst war selbst Jahre nach dem Tod von Kerkum noch kein normales Leben möglich. Es herrschte ein blutiger Bürgerkrieg zwischen religiösen und atheistischen Fanatikern. Vhratoisten gegen Traditionalisten, Kerkumisten gegen Neo-Mashraten. Die Verlierer waren die Armen, Schwachen und Unterdrückten. Für sie hatte sich die Lage eigentlich sogar verschlimmert. Da Rosan oftmals unfreiwillige Besuche auf Mashratan führte, fühlte sie sich irgendwie verbunden mit der Wüstenwelt und so hatte sie den Fonds gegründet. Die Mashraten sollten eine echte Alternative zu dem tristen und blutigen Leben auf ihrer Heimatwelt haben.
An diesem Abend gingen die beiden ins Theater, wo eine altertümliche Shakespeare-Aufführung stattfand. Rosan war begeistert, während Wyll doch sehr mit dem Einschlafen kämpfen musste, was seine Frau gar nicht lustig fand. Nach drei Stunden hatte Wyll das Stück überstanden und die beiden gingen in eine Pizzeria, um noch einen Happen zu essen.
Während Rosan über einer Pizza mit viel Käse, Tomaten, Paprika, plophosischen Pilzen und Salami saß, war sie noch ganz begeistert vom Theater.
»Ich muss sagen, dass die Aufführung wirklich mitreißend war. Noch nie habe ich Hamlet so ausdrucksstark gesehen«, schwärmte Rosan von dem Theaterbesuch.
Wyll konnte nicht anders, er musste gähnen.
»Wyll Nordment, du bist und bleibst ein Kulturbanause«, beschwerte sich Rosan. Ihre feuerroten Augen funkelten neckisch.
»Ich bin immerhin wach geblieben, das musst du doch anerkennen«, verteidigte sich Wyll.
Als die beiden zu Ende gegessen hatten, begaben sie sich mit ihrem Gleiter nach Hause. Sie wohnten in einem noblen Hochhausappartement am Rande von Sirius-River-City.
Rosan und Wyll hatten viele Galax verdient, da sie die Rechte an ihren Personen besaßen und die Liebesromanze auf der LONDON I und II sowie ihre Abenteuer während der Mordred-Krise oftmals verfilmt und als Roman veröffentlicht wurden. Rosan selbst hatte auch ein Buch geschrieben, während Wyll als Dozent an der Raumfahrtakademie sein täglich Brot verdiente.
Anfangs waren beide noch am Aufbau der neuen United Stars Organisation beteiligt gewesen. Nach der Auflösung Camelots war zumindest Wyll in ein kleines Loch gefallen. Doch je länger er auf Terra mit seiner Frau gelebt hatte, desto weniger hatte er die Abenteuer vermisst. Er wollte für die USO nicht alles aufgeben. Rosan sah es genauso. Deshalb hatten sie auch das Angebot der USO abgelehnt, nach Cartwheel zu ziehen. Das Leben unter dem Terranischen Residenten Perry Rhodan war gar nicht mal schlecht. Sie genossen es.
Als sie ihren Gleiter abgestellt hatten, kam ihnen ihre Nachbarin, Frau Moldrecht, entgegen. Die Frau war klein und dicklich, galt als pingelig und arrogant. Rosan und Wyll konnten sie nicht ausstehen. Trotzdem gaben sie sich höflich.
»Guten Abend, Frau Moldrecht«, grüßte Rosan.
»Guten Abend, die Nordbergs«, sagte die Frau in hochtrabendem Tonfall.
»Nordment«, gab Wyll säuerlich zurück.
Moldrecht lachte affektiert. »Ach ja, richtig. Nun, eine Frau wie ich kann sich nicht jeden Namen merken.«
»Immerhin sind wir Nachbarn«, meinte Rosan.
»Ja ja, gewiss doch«, erwiderte die Frau. »Wenngleich ich bemerken muss, dass Sie oft zu laut sind. Außerdem liegt oft Schmutz vor ihrer Tür. Und dann ihr Umgang. Die Leute, mit denen Sie verkehren, passen nicht in unser vornehmes Haus.«
Wyll musste an sich halten, um nicht aufzubrausen.
»Zum Beispiel Perry Rhodan? Überhaupt, was gehen Sie denn unsere Freunde an?«, fragte er scharf.
Moldrecht machte eine abfällige Handbewegung. »Schöne Freunde sind das. Dieser Topsider sieht aus wie ein Landstreicher. Und so etwas lassen Sie in ihre Wohnung!«
Rosan und Wyll verstanden kein Wort.
»Welcher Topsider? Und wieso ist der in unserer Wohnung?«, fragte Rosan ungläubig.
Moldrecht sah sie verächtlich an. »Ich habe genau gesehen, wie er vor einer Stunde die Tür zu ihrer Wohnung geöffnet hat. Das kann er ja wohl nur mit Ihrem ID-Chip gemacht haben.«
»Da stimmt doch was nicht«, meinte Wyll Nordment.
Er ging zurück in seinen Gleiter. Dort hatte er einen Paralysator liegen. Wyll hatte sich einen Strahler besorgt, da er seit den Ereignissen auf den beiden LONDON-Schiffen lieber auf alles vorbereitet sein wollte.
»Was hast du vor?«, fragte Rosan besorgt.
»Es könnte jemand von der USO sein, vielleicht aber auch ein Einbrecher. Ich sehe mal nach. Du bleibst hier!«
Doch da kannte er seine Frau schlecht.
»Oh nein, Wyll Nordment, ich komme mit.«
Wyll wusste, dass Rosan ihren Kopf durchsetzen würde. Also gab er nach. »Also gut. Bleib aber dicht hinter mir. Sie bleiben hier, Frau Moldrecht!«
Mit dem Lift fuhren sie in den 31. Stock, wo ihre Wohnung lag. Auf dem Korridor schien alles ruhig zu sein. Vorsichtig näherte sich Wyll der Wohnungstür und öffnete sie langsam mit seiner ID-Karte. Plötzlich öffnete sich hinter Rosan ein zweiter Lift. Es war die neugierige Moldrecht, die ihnen gefolgt war.
»Sie sollten doch unten bleiben!«, beschwerte sich Rosan leise.
Ihre Nachbarin rümpfte nur die Nase. »Als ob ich mir etwas von Ihnen befehlen ließe.«
Wyll bedeutete den beiden Frauen zu schweigen und betrat das Appartement. Als er eintrat, war alles dunkel. Wyll wollte Licht machen, doch es funktionierte nicht. Plötzlich wurde er von jemanden gepackt und zu Boden geschleudert. Dabei verlor Nordment seinen Paralysator. Wyll erkannte einen Topsider vor sich, der ein großes Messer zückte und sich auf ihn stürzte, doch mit einer blitzschnellen Bewegung konnte er ausweichen.
Rosan hörte den Kampflärm aus ihrer Wohnung. Nun hielt es sie nicht mehr. Sie stürmte in das Appartement. Die neugierige Moldrecht kam natürlich hinterher. Rosan sah, wie Wyll mit einem Topsider rang. Moldrecht schrie entsetzt auf. Das lenkte den Topsider von Wyll ab.
»Rosan, schalte die Sicherung wieder ein! Moldrecht, alarmieren Sie den Sicherheitsdienst!«, rief Nordment den Frauen zu. Dann verpasste ihm Krek Soron einen Schlag.
Während Rosan die Sicherung aktivierte und das Licht anschaltete, schrie Moldrecht entsetzt auf. Die Frau schien überhaupt nicht zu begreifen, was vor sich ging.
»Gehen Sie schon!«, rief Rosan ihr zu.
Doch bevor sie die Tür erreichte, stürzte sich Krek Soron auf sie und schnitt ihr die Kehle durch, dann stach er ihr das Messer in den Rücken. Blutend und röchelnd fiel die Nachbarin zu Boden und starb.
Jetzt ging der Topsider bedrohlich auf Rosan zu. Er packte sie und begann die Frau zu würgen. Doch Wyll Nordment hatte sich inzwischen wieder aufgerappelt und attackierte den Topsider, der augenblicklich von Rosan abließ. Wyll und der Topsider lieferten sich einen heftigen Kampf quer durch die Wohnung, wobei allerlei Mobiliar zu Bruch ging. Wyll griff sich alle Stühle, die ihm in die Finger kamen und schlug damit auf Krek Soron ein.
»Gut, dass ich gegen Möbel aus Formenergie war«, rief Rosan hustend.
Der Topsider packte Wyll und schleuderte ihn gegen die Balkontür. Dabei zerbarst das Glas und Wyll fiel hindurch. Benommen blieb er auf dem Balkon liegen.
Entsetzt sah sie, wie der Topsider eine Axt aus seinem Gürtel zog und damit durch die zerbrochene Balkontür auf Wyll zu ging, der an Armen und Gesicht blutete. Da sah Rosan das Messer in der Leiche von Moldrecht stecken. Sie zog es aus der blutüberströmten Toten und schlich sich an Krek Soron an, der die Axt schon zum Schlag gegen Wyll erhoben hatte. Mit aller Kraft stieß sie das Messer in den Rücken. Der Topsider schrie auf und ließ die Axt fallen. Drohend, das Messer in seinem blutenden Rücken steckend, ging er auf Rosan zu, die zurückwich.
Wyll war wieder zu sich gekommen und verpasste Krek Soron einen Tritt, der den Topsider wanken ließ. Dann gaben ihm Wyll und Rosan mit vereinten Kräften einen Stoß, der den Topsider das Gleichgewicht verlieren ließ. Krek Soron fiel über die Balkonbrüstung und stürzte in die Tiefe. Es war vorbei. Wyll und Rosan umarmten sich.
»Schrecklich, und ich dachte, wir hätten so etwas hinter uns«, meinte Rosan entsetzt.
Wyll alarmierte den Sicherheitsdienst, der kurz darauf eintraf und ihre Aussagen zu Protokoll nahm. Auch ein Beamter des TLD erschien.
»Was hat denn der TLD mit einem Einbruch zu tun?«, fragte der leitende Polizeibeamte den TLD-Vertreter.
»Kein Kommentar. Die Ermittlungen laufen noch«, antworte dieser.
Rosan und Wyll mussten viele Fragen beantworten. Wyll wurde ärztlich versorgt. Glücklicherweise hatte er nur leichte Verletzungen davongetragen. Die Beamten meinten, dass es sich offenbar um einen Einbruch gehandelt haben musste und wollten sich nicht ausführlicher äußern. Rosan bedauerte den Tod von Frau Moldrecht. Sie hatte sie zwar nicht leiden können, doch solch ein Ende hatte sie ihr nicht gewünscht.
*
Am nächsten Morgen läutete es an der Tür. Zwei Männer, die sich als Agenten der USO auswiesen, baten Wyll und Rosan, sie zu begleiten. Da die beiden sich neue Erkenntnisse über den Fall erhofften, stimmten sie zu. So wurden sie in das geheime Büro der USO in Terrania-City gebracht. Dort begrüßte sie Monkey persönlich. Der Oxtorner machte keine Umschweife und kam schnell zur Sache.
»Wir haben herausgefunden, dass es sich bei dem Toten um den Topsider Krek Soron handelt. Soron war einer der meist gesuchtesten Killer der Milchstraße. Wir haben außerdem herausgefunden, dass er sich nach Cartwheel abgesetzt hatte. Wenn er es riskiert hat, wieder hierher zurückzukommen, um euch zu töten, muss er einen guten Grund gehabt haben.«
»Es war also kein einfacher Einbruch«, schloss Wyll.
Monkey nickte.
»Ihr müsst einen mächtigen Feind haben. Dieser Feind muss in Cartwheel sein. Er kann sich leisten, einen der teuersten Killer der Milchstraße anzuwerben. Habt ihr eine Idee, wer nach eurem Leben trachtet?«
Rosan schüttelte den Kopf. »Ich habe mich zwar durch mein soziales Engagement bei einigen Politikern unbeliebt gemacht, aber dass die deshalb einen Killer auf mich ansetzen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Unsere Feinde sind ja eigentlich schon alle tot.«
»Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Wir gehen nach Cartwheel. Vorher werden wir kein normales Leben führen können«, meinte Wyll entschlossen.
Monkey stimmte ihm zu. »Das ist die logischste Alternative. Die USO ist bereit, euch dabei zu unterstützen. Ihr kennt unsere Organisation bestens. Jan Scorbit wird sich freuen, euch in Cartwheel zu sehen. In drei Tagen, also am 28. September wird ein kleiner Konvoi Richtung Sternenportal aufbrechen.«
Rosan und Will erhoben sich.
»Einverstanden. Wir fliegen am 28.«, stimmte Rosan zu. »Das bedeutet, ich verbringe meinen 34. Geburtstag irgendwo im Weltall.«
7. Mankind, New Terrania
26. September 1298 NGZ
Es war wieder ein schöner Spätsommertag, als der Marquês in seinem Garten spazieren ging. Diabolo begleitete ihn und informierte ihn über die politischen Neuigkeiten.
»Der Besuch ihrer Kinder auf Bostich hatte eine positive Veränderung gebracht. Wer hätte das gedacht?«
»Ja ja«, murmelte der Marquês geistesabwesend.
»Ich halte es sogar für sensationell. Es sei denn, Uwahn Jenmuhs plant ein Ränkespiel. Wir sollten ihm nicht zu sehr vertrauen«, warnte Diabolo.
»Ja ja.«
Der Posbi wurde stutzig. Der Marquês sagte schon die ganze Zeit immer nur dasselbe.
»Geht es Ihnen nicht gut, Marquês?«
»Doch doch.«
Kaum hatte Don Philippe ausgesprochen, wurde er bleich und griff sich ans Herz. Stöhnend sank er zusammen und fiel auf den Rasen.
Diabolo alarmierte sofort Doktor Nölke, der umgehend erschien und den Marquês untersuchte. Als er fertig war, begab er sich ins Wohnzimmer, wo sich die Klon-Kinder und Diabolo versammelt hatten.
»Wie geht es ihm, Doktor?«, fragte Orly besorgt.
Doktor Nölke sah ihn finster an. »Er stirbt. Es ist das Alter. Seine Zeit läuft ab. Die wichtigen Organe versagen ihren Dienst. Ich kann nichts mehr für ihn tun.«
»Was reden Sie da?«, rief Stephanie fassungslos. »Warum bringen Sie ihn nicht in eine Klinik! Wir bezahlen die beste Behandlung!«
»Es ist der Wunsch Ihres Vaters, zuhause im Kreis seiner Familie zu sterben, wie es im 18. Jahrhundert Sitte war«, erklärte der Arzt betreten. »Wir könnten zwar in einer Klinik sein Leben mit modernen Geräten ein paar Tage oder Wochen verlängern, aber helfen können wir ihm nicht mehr.«
»Wie lange noch, Doktor?«, fragte Orly mit belegter Stimme.
»Das liegt bei Gott...«
Kurz darauf bat der Marquês seine zutiefst unglücklichen Kinder zu sich an sein Krankenbett.
»Meine lieben Kinder. Leider müssen wir uns voneinander verabschieden«, sagte er mit schwacher Stimme. »Bald wird mich Gott zu sich rufen. Ich bin traurig, dass ich nicht mehr bei euch sein kann.«
»Vater, du darfst uns nicht verlassen. Ich verbiete es!«, rief Peter mit weinerlicher Stimme.
»Nichts kann mich davor bewahren. Ich habe noch... einen letzten Wunsch an euch. Setzt meine Arbeit, die ich hier in Cartwheel begonnen habe, mit vereinten Kräften fort«, flehte der alte Mann. »Haltet zusammen, dann werdet ihr es schaffen. Versprecht mir, dass ihr euch... vertragt. Bitte!«
»Wir versprechen es«, gelobte Brettany.
»Ja, Vater, du kannst dich darauf verlassen«, stimmte ihr Orly zu.
Peter konnte nichts sagen. Er bekam einen Weinanfall und ließ sich zu Boden sinken. Brettany nahm sich seiner liebevoll an. Auch für Stephanie brach eine Welt zusammen. Sie war unfähig etwas zu sagen.
»Dann kann ich beruhigt einschlafen«, sagte Don Philippe müde.
Der Marquês hatte viel für Cartwheel getan. Doch nun war sein Ende gekommen.
Dem Tod so nahe.

*
27. September
Schwach und verzweifelt lag Don Philippe de la Siniestro, Paxus-Rat von Mankind, auf seinem Krankenbett. Ein heftiger Schwächeanfall hatte ihn niedergeworfen. Und dann kam die niederschmetternde Diagnose der Ärzte. Das Leben des Marquês neigte sich dem Ende zu. Da er aus einer anderen Zeit stammte, dem 18. Jahrhundert, war seine Lebenserwartung deutlich kürzer als die der Menschen des 13. Jahrhunderts NGZ. Mehrere Ärzte hatten den alten Spanier untersucht und alle kamen zu derselben schrecklichen Diagnose. Die Organe des Marquês versagten nach und nach ihren Dienst. Besonders das Herz war gefährdet. Eine Operation hielt man angesichts des schwachen Allgemeinzustandes, der sich von Tag zu Tag verschlechterte, für tödlich. Die Ärzte plädierten dafür, dass der Marquês in die modernste Ara-Klinik von Cartwheel eingeliefert wurde, doch der Spanier lehnte ab. Die Mediziner hatten ihm klar gemacht, dass man dort sein Leben nur um ein paar Tage oder höchstens ein paar Wochen verlängern könnte. Aber der Marquês wollte nicht in einer kalten, sterilen Klinik seine letzten Tage verbringen, sondern, wie es im 18. Jahrhundert noch Sitte war, zuhause im Kreise seiner Familie einschlafen. So konnte er wenigstens noch einige Tage die vertraute Umgebung um sich haben. Dieses Anwesen war für ihn zu einer neuem Heimat geworden. Die vier Klone, die nun seine Kinder waren, hatten dieses Haus mit Leben erfüllt und somit auch sein Leben. Dann kam noch die Verantwortung für Cartwheel hinzu. Don Philippe hatte so hart für den Erfolg gearbeitet. Es war unglaublich, wie er den Aufstieg eines Versuchsobjektes der Aras aus ferner Vergangenheit zu einem der höchsten Würdenträger dieser Galaxis geschafft hatte. Fast kam es ihm wie ein Traum vor. Zielstrebig hatte er für all dies gearbeitet und Hindernisse überwunden. Und nun, ausgerechnet wo Cartwheel unabhängig wurde und er die Früchte seiner harten Arbeit ernten wollte, schlug das Schicksal grausam und unbarmherzig zu. Seine Zeit war um und nichts konnte dies verhindern. Das war so ungerecht!
Doch der Marquês wusste auch, dass alles Jammern und Klagen nichts helfen würde. Er musste vor seinem Tod noch wichtige Dinge regeln, solange ihm noch Zeit dazu blieb.
Der Marquês bestellte Joak Cascal und Cauthon Despair zu sich an sein Sterbebett. Die Frage seiner Nachfolge musste geklärt werden, bis es Neuwahlen geben würde.
Der Terra-Marschall traf zusammen mit Cauthon Despair auf dem Anwesen des Marquês ein. Diabolo führte sie zum Krankenlager des Spaniers. Mit betretener Miene betrat der ehemalige Oberst der SolAb das Zimmer. Der Mann mit der silbernen Rüstung folgte ihm.
»Marquês, Besuch ist da«, meldete Diabolo seinem Herren.
Don Philippe schlug langsam die Augen auf.
»Marquês, ich hoffe, es geht Ihnen besser«, sagte Cascal betrübt.
»Mir geht es nie mehr... besser«, murmelte der alte Spanier. »Jedenfalls nicht auf dieser Welt. Ich werde bald in einer anderen... Welt sein.«
»Sagen Sie doch nicht so etwas«, erwiderte Cascal erschrocken. Der Zustand des Marquês war schlimmer, als er sich es vorgestellt hatte. Es ging tatsächlich zu Ende mit ihm.
»Ich habe Sie hergebeten, um mit Ihnen über meine Nachfolge zu sprechen. Sie, Cascal, sollen meinen Posten beim Paxus-Rat einnehmen, bis das Volk neu entscheidet. Doch ich habe noch eine... letzte Bitte an Sie.«
»Natürlich, Marquês.«
»Ich wünsche, dass meine Kinder Orlando, Stephanie, Brettany und auch Peter politische Ämter innerhalb der Regierung bekleiden«, bat der Marquês. »Somit würde der Name de la Siniestro mit Cartwheel verbunden bleiben und meine Arbeit wäre nicht ganz umsonst gewesen...«
»Ich verspreche es Ihnen, Marquês«, gelobte Cascal. »Wir werden für jeden die richtige Aufgabe finden. Ihr Name wird den Cartwheelern immer in Erinnerung bleiben.«
»Ich danke Ihnen, Cascal«, sagte Don Philippe zufrieden. Dann wandte er sich an den Mann mit der silbernen Rüstung. »Nun zu Ihnen, Cauthon Despair. Sie haben sich in der letzten Zeit als würdig erwiesen. Wenn Cascal meine Stelle antritt, sollten Sie das Amt des Terra-Marschalls übernehmen.«
»Ich nehme dieses Amt an und werde es verantwortungsvoll ausüben«, versicherte Despair.
Joak Cascal war davon allerdings wenig begeistert. Er misstraute Despair nach wie vor. Er konnte ihm zwar nichts beweisen, doch er hatte einfach ein ungutes Gefühl bei diesem Mann.
»Ich finde, wir sollten nichts überstürzen. Eine solche Entscheidung muss gut überdacht werden«, wandte Cascal daher ein.
»So viel Zeit habe ich leider nicht mehr. Ich bitte Sie beide inständig, sich zu vertragen und zum Wohle Cartwheels zusammen zu arbeiten«, flehte Don Phillipe. »Es ist mein letzter Wunsch, bitte schlagen Sie ihn mir nicht ab!«
Cascal brachte es nicht übers Herz, dem Sterbenden seinen wohl letzten Wunsch abzuschlagen.
»Nun gut, ich werde ihm eine Chance geben«, lenkte Cascal ein. Dabei sah er den Mann in der Rüstung scharf an und fügte hinzu: »Aber nur eine.«
Don Philippe lächelte zufrieden.
*
Als Cascal den Marquês verlassen hatte, rief er Orly, Brettany, Stephanie und Peter zu sich, um die letzten Wünsche ihres Vaters mit ihnen zu besprechen.
»Euer Vater wünscht, dass wir seine Arbeit fortsetzen«, teilte er ihnen mit. »Ich fürchte, es bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Er will, dass ich seine Nachfolge antrete. Jeder von euch soll ein politisches Amt übernehmen. Ich werde alles tun, um dies zu ermöglichen.«
Peter trat vor Cascal. »Dann werde ich Oberbefehlshaber der Streitkräfte!«
Cascal schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Peter. Dein Vater hat Cauthon Despair dazu bestimmt.«
Peter wurde noch bleicher als sonst. Ungläubig starrte er Cascal an. »Nein! Das kann nicht sein! Ich bin ein großer General, so wie Friedrich der Große oder Conrad Deringhouse!«
»Peter, benimm dich! Du hast wohl den Ernst der Lage nicht begriffen!«, maßregelte ihn Orly.
Jetzt lief Peter rot an. Mit dem Finger zeigte er auf seinen Bruder. »Du! Du steckst dahinter!«, schrie er. »Du hasst mich, weil ich klüger und schöner bin als du! Und weil ich ein großartiger Soldat bin, du aber nur ein Mutantenfreak. Darum machst du mich bei allen Leuten schlecht, auch bei Vater!«
»Das ist doch Unsinn, Peter!«, widersprach Orlando.
»Orlando hat recht. Sie müssen noch viel lernen, Peter«, versuchte Cascal den aufgebrachten Peter zu beruhigen. »Ihr Vater weiß das. Aber wir finden für Sie schon eine Stellung. Sie könnten als Militärattaché arbeiten.«
»Sie stecken mit Orlando unter einer Decke! Ich hasse Sie! Ich hasse euch alle!«, brüllte Peter.
Stephanie trat auf ihn zu und verpasste ihm eine schallende Ohrfeige. »Wie kannst du es wagen, so herum zu brüllen, während Vater oben im Sterben liegt?«, zischte sie.
Peter fing an zu weinen und lief weg.
»Vaters Krankheit ist zu viel für ihn. Er hängt so sehr an ihm und nun ist für Peter eine Welt zusammengebrochen. Ich kümmere mich um ihn«, verteidigte Brettany ihren Bruder und ging ihm nach.
Cascal nickte. »Ich kann verstehen, dass ihr mit den Nerven am Ende seid. Es ist auch ein harter Schlag für uns alle. Ich werde es in den kommenden Stunden der Öffentlichkeit bekannt geben müssen.«
Orly stimmte ihm zu. »Ja, das müssen Sie.«
Cascal verabschiedete sich und flog nach IMPERIUM ALPHA zurück.
*
Gegen Abend kam Diabolo in den Wohnraum, in dem sich die vier Klone aufhielten.
»Euer Vater möchte euch sehen«, teilte er mit.
Kurz darauf hatten sich alle im Schlafgemach ihres Vaters versammelt.
Mühsam richtete sich der Marquês auf. »Meine lieben Kinder. Es ist nun an der Zeit, dass ich mich von euch verabschiede. Ich wollte zuerst, dass ihr die letzten Tage bei mir verbringt. Doch nun bin ich zum dem Entschluss gekommen, meine letzte Frist allein zu verbringen. Nur Diabolo wird bei mir bleiben. Ihr sollt mich so in Erinnerung behalten, wie ihr mich gekannt und geliebt habt.«
Brettany und Stephanie fingen an zu weinen.
»Aber Vater, wir können dich doch nicht allein lassen«, schluchzte Brett.
»Es ist mein letzter Wunsch an euch. Bitte respektiert ihn. Orly...?«
»Ja, Vater?«
»Du bist von nun an das Oberhaupt der Familie. Kümmere dich um deine Geschwister, sorge dafür, dass die Familie zusammenhält.«
Orly schluckte. Er konnte nichts sagen. Er hoffte, dass er der Verantwortung gewachsen war.
»Bitte geh nicht, Vater! Ich brauche dich doch!«, rief Peter entsetzt.
»Du wirst lernen müssen stark zu sein, mein Sohn. Eines Tages wirst du ein guter Offizier werden. Ich liebe euch alle und bin stolz auf euch.«
Nacheinander verabschiedeten sich alle vier von ihrem Vater. Es war der schwerste Moment im Leben Don Philippes. Er hoffte, dass die vier Klone, die er als seine Kinder akzeptiert und lieben gelernt hatte, ohne ihn zurechtkamen.
*
Als der Marquês wieder allein war, fing er bitterlich zu weinen an. Warum nur musste das Schicksal ihn so grausam treffen? Der Marquês verstand es nicht. Vom einst großen Spanier, den das Volk liebte, war auf Grund der Tatsache, dass er der älteste Mensch war und sich für die Menschen einsetzte, nur noch ein Häufchen Elend übrig geblieben. Dessen war sich der alte Mann auch bewusst. Darum sollte niemand sehen, wie er zugrunde ging. Nur Diabolo sollte in den letzten Tagen und Stunden bei ihm sein.
*
Am nächsten Morgen gab Joak Cascal eine Regierungserklärung ab und informierte Politik und Öffentlichkeit darüber, dass der Marquês den schwersten Kampf seines Lebens austrug und ihn nach menschlichem Ermessen auch verlieren würde. Cascal teilte der Bevölkerung die Veränderungen mit, die sich daraus ergaben, und versprach, die Politik des Marquês mit allen Kräften fortzusetzen.
»Als Stellvertreter des Marquês werde ich seinen Sitz im Paxus-Rat solange einnehmen, bis ein neuer Rat gewählt wird. Desweiteren übernehme ich die Regierungsverantwortung auf Mankind bis zur nächsten Wahl. Als Terra-Marschall wird Cauthon Despair berufen. Auch die vier Kinder des Marquês – Orlando, Peter, Stephanie und Brettany de la Siniestro – werden in politische Verantwortung eingebunden. Es ist der letzte Wunsch Don Philippes, damit die nächste Generation sein Werk, das er in Cartwheel so großartig begonnen hat, fortführt. Unsere Gedanken sind nun bei Don Philippe de la Siniestro.«
Damit endete die Rede Cascals. Unter der Bevölkerung löste die Nachricht vom bevorstehenden Tod des Marquês große Bestürzung aus. Es gab spontane Zusammenkünfte, in denen Don Philippes gedacht wurde. Schon lange hatte sich kein Politiker mehr so großer Beliebtheit erfreut wie dieser Mann, der vom einfachen Volk als Vater der Menschheit angesehen wurde.
Auch bei den meisten anderen Völkern wurde die Nachricht mit Trauer und Entsetzen aufgenommen. Der Marquês hatte bei vielen Völkern durch diplomatisches Geschick große Beliebtheit erreicht.
*
Auch Uwahn Jenmuhs war über die Entwicklung nicht glücklich, als er die Nachricht von Toran Ebur erhielt, dass Don Philippe nicht mehr lange zu leben hatte.
»Das ist eine schlechte Nachricht«, sagte Jenmuhs deprimiert.
»Ich wusste nicht, dass Euch der Marquês so sehr am Herzen liegt, Gos‘Shekur«, sagte Ebur verwundert.
Jenmuhs winkte ab. »Persönlich ist er mir egal, aber wenn Joak Cascal an seine Stelle tritt, haben wir einen erbitterten Gegner. Dabei hatten wir gerade so gute Beziehungen zu den de la Siniestros geknüpft. Mit Peter als Terra-Marschall hätte ich jemanden im Kabinett gehabt, der auf meiner Wellenlänge liegt und der leicht beeinflussbar gewesen wäre. Cascal und Despair werden sich von mir nichts sagen lassen.«
»Die Siniestros sollen ja politische Ämter erhalten. Wenn wir sie fördern, könnten sie vielleicht in Zukunft von großem Nutzen für uns sein«, meinte der Zaliter.
Jenmuhs' Miene hellte sich auf. »Toran, Sie sind der richtige Mascant für mich. Übermitteln Sie den Siniestros unsere Anteilnahme und unsere aufrichtige Freundschaft.«
Toran Ebur nickte ergeben. »Ich werde Stephanie de la Siniestro persönlich meine Anteilnahme bekunden.«
Jenmuhs lächelte. Es würde sich schon alles zu seinen Gunsten wenden.
8. Die Trauer der Kinder
Voller Trauer traf sich Peter III. mit dem frisch designierten Terra-Marschall Cauthon Despair. Peter verabscheute den Mann mit der Maske. Er hielt ihn für einen minderwertigen Freak. Und so einer wurde Verteidigungsminister, obwohl er selbst einer der genialsten Strategen war, den das Universum je gesehen hatte! Doch das sollte nur eine Frage der Zeit sein. Peter war überzeugt, dass Despair schon bald scheitern würde, da er sich nicht gut mit Joak Cascal verstand. Notfalls würde Peter selbst nachhelfen.
Sein neuer Freund Uwahn Jenmuhs würde ihn sicherlich unterstützen. Und wenn Despair erst einmal aus dem Weg war, würde kein Weg an Peter vorbeiführen, dachte er. Dann würde er endlich sein Ziel, Oberbefehlshaber über die Streitkräfte zu sein, erreicht haben. Von der dann fertiggestellten EL CID, die er in PETER DER GROSSE umbenennen würde, konnte er die Soldaten befehligen und solange drillen, bis sie die beste Armee der Insel war. Selbstverständlich musste kräftig aufgerüstet werden, um es mit den Arkoniden aufnehmen zu können. Das Selbstbewusstsein einer Nation definierte sich immer über seine militärische Stärke. Die Arkoniden hatten das erkannt, aber auf Terra regierten humanistische Schwächlinge wie Perry Rhodan und Maurenzi Curtiz, darum würde die LFT früher oder später der geballten Militärmacht des Kristallimperiums unterliegen.
Doch nun war Mankind unabhängig und konnte seine eigene Rüstungspolitik führen. Peter war sich sicher, genügend Unterstützung bei Militär, Wirtschaft und Politik für seine Ziele zu finden. Das Militär war immer zufrieden, wenn es hochgerüstet wurde, die Wirtschaft erhielt lohnende Aufträge und die Politiker bekamen Macht und Prestige. So war es schon immer gewesen und so würde es auch immer bleiben.
Doch das war noch Zukunftsmusik Zuerst wollte er seinem geliebten Vater die letzte Ehre erweisen, und dafür brauchte er Cauthon Despair.
Hocherhobenen Hauptes in seiner Galauniform und mit einem alten spanischen Degen bewaffnet, betrat Peter das Büro des Terra-Marschalls Cauthon Despair.
Despair erwartete ihn stehend.
»Sie wollten mich sprechen?«, kam Despair ohne Höflichkeitsfloskeln zur Sache.
»Ja, allerdings«, bestätigte Peter.
Als Despair nichts dazu sagte, fuhr Peter fort.
»Sie wissen, dass mein Vater nicht mehr lange zu leben hat. Daher bin ich gezwungen, Vorbereitungen für die Beisetzung zu treffen.«
»Sie verlieren keine Zeit«, stellte Despair fest.
Für diese Bemerkung hätte Peter Despair am liebsten auf der Stelle getötet. Aber diesmal beherrschte er sich, denn er wusste, dass er nur so etwas erreichen konnte. »Mein Vater ist der wichtigste Mann in Cartwheel, deshalb verdient er die beste und größte Bestattung, die je ein Mensch gesehen hat. So etwas muss natürlich gut vorbereitet werden, was natürlich seine Zeit braucht.«
»Das klingt logisch. Wie kann ich dabei helfen?«, lenkte Despair ein.
»Ich will, dass alle abkömmlichen Streitkräfte bei der Beerdigung aufmarschieren und ihm die letzte Ehre erweisen. Auf diese Weise kann ich meinem Vater noch einmal meine ganze Ehrerbietung zeigen.«
Despair schwieg.
»Nun, was sagen Sie dazu?«, fragte Peter ungeduldig.
»Also gut, wenn das Militär auf diese Weise seine Trauer zeigen kann, habe ich nichts dagegen einzuwenden. Ich nehme an, dass Sie die Parade leiten wollen?«, fragte der ehemalige Cameloter, obwohl er die Antwort schon kannte.
»Selbstverständlich«, sagte Peter stolz.
»Also gut, aber wenn der ganze Zirkus vorbei ist, kommen Sie mir lieber nicht in die Quere. Ich kann allmählich keine Verrückten mehr sehen«
Damit war für Despair das Gespräch beendet und er wandte sich ab.
Peter ging zufrieden. Er hatte erreicht, was er wollte. Doch Despair hasste er. Dieser war genauso gegen ihn wie sein nichtsnutziger Bruder Orlando. Mit beiden würde er zu gegebener Zeit abrechnen.
Auch Stephanie war zutiefst erschüttert. Auch plagte sie die Angst, nach dem Tod ihres Vaters Macht und Einfluss zu verlieren. Umso glücklicher war sie, als Toran Ebur sie in ihrem Büro besuchte. Der zalitische Thek'Athor, dessen Beförderung zum Mascant wohl kurz bevorstand, faszinierte sie, und sie fühlte sich wohl in seiner Nähe.
»Ich habe vom Schicksal deines Vaters gehört. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid es mir für dich tut, Steph.«
Stephanie umarmte Ebur. »Ich danke dir. Ich fühle mich so hilflos. Was soll ich bloß tun?«
»Wenn du nichts mehr für deinen Vater tun kannst, tue etwas für sein Andenken«, schlug Toran vor. »Auf Arkon erhalten alle großen Führer ein Monument. Errichte ein Denkmal für dein Vater und ehre ihn auf diese Weise, damit sich jeder an ihn auch in Zukunft erinnert.«
Stephanie war begeistert von der Idee. »Das werde ich. Mein Vater erhält das größte Monument, das man sich nur vorstellen kann. Ich spreche mit Sruel Allok Mok darüber.«
Toran Ebur zeigte sein charmantes Lächeln. »Mir liegt viel daran, dass du glücklich und zufrieden bist. Mein Kristallkönig wünscht sich, dass du und Peter leitende Positionen auf Mankind erhalten.«
Stephanie zuckte mit den Schultern. »Ohne meinen Vater wird das nicht einfach. Da gibt es viele Hindernisse.«
»Ich werde dir helfen, sie zu überwinden«, bot Ebur an.
Stephanie lächelte und umarmte ihn abermals.
»Bitte bleib heute Nacht hier«, bat sie den Zaliter.
Und er blieb.
Brettany war am meisten vom bevorstehenden Tod ihres Vaters betroffen, denn sie war die gutmütigste der vier Klone und litt daher am schlimmsten. Oft musste sie weinen.
Uthe Scorbit, die in diesen Tagen selbst unter dem Verschwinden von Anica zu leiden hatte, versuchte sie zu trösten und kam Brett so oft besuchen, wie sie konnte. Die beiden saßen an diesem Nachmittag im Salon der Villa und tranken Tee.
»Ich kann einfach nicht begreifen, dass wir nicht bei ihm sein dürfen, um ihm beizustehen«, beklagte sich Brettany.
»Das tut er euretwillen. Er möchte, dass ihr ihn so in Erinnerung behaltet, wie er ihn gekannt habt, und nicht unter seinem Zustand leidet. Ihr solltet seinen letzten Wunsch akzeptieren«, riet ihr Uthe.
Brett nickte verständnisvoll. »Natürlich werden wir das, auch wenn es sehr schwer fällt.«
»Wie nehmen es die anderen auf?«, erkundigte sich Uthe.
»Jeder auf seine Weise«, berichtete Brettany. »Orly kommt am besten damit zurecht, äußerlich jedenfalls. Er ist sich der Verantwortung, die auf ihn zukommt, bewusst. Steph und Peter leiden sehr. Während Peter eine große Parade organisieren will, plant Stephanie ein monumentales Denkmal.«
Uthe verdrehte die Augen. »Bescheidenheit gehört nicht gerade zu ihren Tugenden.«
Der Türsummer zeigte an, dass Besuch gekommen war.
»Wer kann das sein?«, wunderte sich Brett. »Ich hatte bekannt gegeben, dass wir keine Besucher empfangen.«
»Vielleicht Pressefritzen, die ein paar Aufnahmen machen wollen«, meinte Uthe. »Die sind doch wie die Aasgeier.«
»Die hatten wir gestern schon. Nachdem sie Peter gesehen hatten, wie er seinen Säbel zog, sind sie sofort wieder abgehauen«, erzählte Brett und öffnete die Tür.
Vor ihr standen Dorys, Charly und Ian Gheddy.
Brett war nicht gerade erfreut. »So sieht man sich wieder«, sagte Dorys mit ihrer kehligen Stimme. In ihrer rechten Hand hielt sie eine Zigarette, die einen besonders widerlichen Geruch verbreitete.
»Was wollen Sie?«, fragte Brettany verdutzt.
»Guten Tag, Miss Brettany. Wir wollten uns erkundigen, wie es Ihrem Vater geht«, erklärte Charly freundlich, während Ian Brett und Uthe finster und missmutig musterte.
»Das ist sehr freundlich, aber mein Vater möchte keinen Besuch mehr empfangen«, erklärte Brett. »Es geht ihm sehr schlecht.«
Am liebsten hätte sie die Gheddys sofort wieder weggeschickt. Ihr war nicht danach, fremde Leute zu empfangen. Doch bevor sie etwas sagen konnte, drängte sich Dorys an ihr vorbei ins Haus.
»Ich muss mich jetzt erst mal setzen. Mir tun die Füße so weh«, verkündete Mrs. Gheddy echauffiert und machte es sich auf einen der antiken Sessel bequem. Ihre Söhne taten es ihr gleich.
Brett war wie vor den Kopf geschlagen. Mit so viel Dreistigkeit hatte sie nicht gerechnet.
Auch Uthe war ziemlich überrascht.
»Mal mir mal 'ne Tasse Kaffee, Kindchen!«, forderte Dorys, während sie sich eine neue Zigarette anzündete.
»Erlauben Sie mal! Ich habe Sie nicht eingeladen! Was fällt Ihnen ein?«
»Immer mit der Ruhe, Kleines. Wir wollen ja nur wissen, wie es dem alten Sack geht und ihm mal guten Tag sagen. Dann gehen wir wieder«, erklärte Ian und blickte Brett böse an.
Brettany war von Ian eingeschüchtert und traute sich nicht zu widersprechen.
»Krieg' ich jetzt endlich meinen Kaffee? Und hinterher will ich einen Schnaps!«, rief Dorys ungehalten. Dabei klopfte sie mit einer Hand auf den Tisch, um ihre Worte zu untermauern.
Uthe wurde es nun zu bunt. »Miss de la Siniestro hat Ihnen doch deutlich zu verstehen gegeben, dass der Marquês keinen Besuch empfangen kann. Ich darf Sie also bitten, unverzüglich zu gehen!«
Ian sah sie grimmig an und ging mit langsamen Schritten drohend auf sie zu.
»Wie bitte?«, fragte er dreist.
Uthe hielt seinem Blick stand. »Sie haben genau verstanden«, zischte sie.
Ian wandte sich wieder Brettany zu. »Ist das auch deine Meinung, Kleines?«
Brettany fühlte sich sehr unbehaglich. Am liebsten wäre sie gegangen. Doch sie stimmte Uthe zu. »Ja, ich möchte, dass Sie gehen.«
Ian sah sie Hass erfüllt an. »Und wenn wir nicht gehen, Kleines? Was dann?«
Brettany wusste nicht, was sie sagen sollte.
»Dann alarmieren wir den Sicherheitsdienst«, antwortete Uthe stattdessen.
Ian grinste. »Das wirst du nicht tun.«
Langsam ging er auf Uthe zu.
»Was ist denn hier los?«, rief plötzlich jemand.
Am Eingang stand Orlando, der gerade nach Hause gekommen war.
Erleichtert lief Brett zu ihm. »Orly, ich bin so froh, dass du da bist.«
Charly, der bisher geschwiegen hatte, erhob sich abrupt. »Wir wollten sowieso gerade gehen. Es tut uns sehr leid, dass es Ihrem Vater so schlecht geht und wir wünschen ihm und Ihnen weiterhin alles Gute.«
Dann packte er seine Mutter am Arm und zog sie aus dem Sessel.
»He! Ich wollte doch einen Kaffee und einen Schnaps!«, beschwerte sich die Alte.
»Kriegst du ja, Mutti. Wir fahren jetzt zu einem schönen Café. Kommst du, Ian?«
Ian musterte alle Beteiligten finster und folgte dann wortlos seinem Bruder und seiner Mutter nach draußen.
»Was war denn los?«, wollte Orly wissen, als die Gheddys gegangen waren.
»Nichts, ich weiß auch nicht, was die wollten. Das sind seltsame Leute«, entgegnete Brettany.
»Das liegt bei denen in der Familie«, fügte Uthe vielsagend hinzu.
9. Die Stunde des Todes
In der Nacht fand der Marquês keinen Schlaf. Selbstmitleid plagte ihn. Warum er? Warum hatte man ihn auf diesen besonderen Lebensweg geschickt? Nur, um jetzt so zu enden? Das konnte nicht gerecht sein!
Vor den Augen des alten Mannes zog sein Leben vorüber. Er erinnerte sich an die Kindheitstage in der düsteren spanischen Burg der Siniestros, an seine geliebte Mutter, die früh verstarb, und an seinen strengen Vater. An die Hochzeit mit seiner Frau Isabelle, die er oft schlecht behandelt hatte, und die aus Kummer gestorben war. An all die Freunde und Bekannten, die ihn verlassen hatten, und an die einsamen Tage auf seinem Schloss bis zu der Entführung durch die Casaro.
Schließlich an seine Wiedererweckung und sein neues Leben. Zuerst auf der TERSAL dann in Cartwheel.
Es hatte sich alles zum Guten für ihn gewendet. Er hatte einen beispiellosen Lebensweg beschritten und all dies sollte nun umsonst gewesen sein? Don Philippe konnte es nicht begreifen. Diese ganze Odyssee, nur um dann letztendlich im Bett zu sterben?
»Oh Gott, warum hast du mich verlassen? Bitte hilf mir doch!«
»Dein Gott hilft dir nicht. Aber es gibt noch andere, die dir helfen können.«
Wer sagte das? Der Marquês erschrak und richtete sich auf.
»Diabolo!«, rief er.
Der Posbi, der vor der Tür wachte, kam sofort herbei geeilt.
»Was ist los, Marquês? Geht es zu Ende?«
»Ja, mein treuer Freund. Ich höre schon Stimmen. Der Teufel will mich holen!«
»Nicht ganz, Marquês. Aber ziemlich dicht getroffen«, sagte die heisere Stimme.
Dann trat eine Gestalt aus dem Dunkel hervor. Sie trug ein tiefschwarzes Gewand mit einer dunklen Kapuze, aus der ein rotes Gesicht hervor schien. Die Augen schienen in einem feurigen Rotgelb zu lodern. Sie durchdrangen den Marquês und versetzten ihn in Furcht. War der Tod persönlich gekommen, um ihn zu holen? War das das Antlitz des Satans, der nun gekommen war, um ihn zu holen?
»Marquês, ich sehe ihn auch. Ein Fremder ist im Zimmer«, sagte Diabolo ruhig zum verdutzten Marquês. »Soll ich den Sicherheitsdienst rufen?«
Bevor Don Philippe darauf antworten konnte, sagte der Fremde: »Ich bin Cau Thon, und ich bin hier, um deinem Meister das Leben zu retten.«
»Sie sind Cau Thon? Warum sollten ausgerechnet Sie den Marquês retten wollen?«, fragte der Posbi misstrauisch.
Cau Thon lachte nur spöttisch. »Marquês, schick' deinen Roboter hinaus, damit wir uns vernünftig unterhalten können! Ich habe dir Wichtiges mitzuteilen. Dein Leben hängt davon ab.«
Der Marquês starrte Cau Thon überrascht an, dann sagte er: »Diabolo ist mein Freund. Ich habe keine Geheimnisse vor ihm. Er soll bleiben.«
»Wie du wünschst. Ich habe dir etwas anzubieten – dein Leben. Es liegt wortwörtlich in meiner Hand.«
Cau Thon zog eine kleine, schwarze Schatulle hervor und öffnete deren Deckel. Der Marquês sah darin einen kleinen schimmernden, chipförmigen Gegenstand.
»Was ist das?«
»Deine Rettung, dein Leben.« Cau Thon nahm den Chip heraus und hielt ihn dem Marquês vor die Nase. »Dieser kleine Chip macht dich nicht nur wieder gesund, er verleiht dir ewiges Leben.«
»Das ist ein Zellaktivator-Chip!«
Cau Thon nickte. »Die Bedeutung eines Zellaktivators dürftest du ja wohl kennen, Marquês.«
Die Gedanken des Marquês überschlugen sich. Ein Zellaktivator! Ewiges Leben für ihn!
Doch warum er?
»Ich weiß, was ein Zellaktivator vermag. Doch warum wollen Sie mir ein solch wertvolles Geschenk machen? Sind Sie nicht ein Feind der Menschheit?«
»Durchaus nicht. Nur ein Feind bestimmter Leute. Den Zellaktivator bekommst du auch nicht von mir, sondern von meinem Meister, dem allmächtigen MODROR. Mein Meister erwartet dafür selbstverständlich Gegenleistungen von dir.«
»Und welche?«, fragte Don Philippe mit schwacher Stimme. Das Ganze wurde ihm immer unheimlicher.
»Du bist ein Teil des gewaltigen Planes, den mein Meister ersonnen hat, um erst Cartwheel und dann diesen Teil des Universums zu unterwerfen. Zunächst kehrst du in dein Amt zurück. Nach einer Weile ernennst du Cauthon Despair zum Terra-Marschall. Da er diesen Posten im Moment schon sehr gut ausfüllt, ist er dafür natürlich bestens prädestiniert.«
»Aber Cascal ist doch der Ranghöchste nach mir«, gab der Spanier zu bedenken.
Cauthon zuckte mit den Schultern. »Cascal stört. Er muss gehen. Danach beginnt deine eigentliche Aufgabe. Zusammen mit Uwahn Jenmuhs, Torsor und Nor'Citel wirst du ein neues, mächtiges Imperium gründen. Eure Macht wird gewaltig sein und sogar die Milchstraße erschüttern. Eines Tages wirst du dort, im Namen MODRORs, über die ganze Galaxis herrschen. War dies nicht schon immer dein Traum, unumschränkter Herrscher zu sein? Nun kannst du ihn Wirklichkeit werden lassen!«
»Marquês, seien Sie auf der Hut! Denken Sie gut darüber nach«, gab Diabolo zu bedenken.
»Was gibt es da zu überlegen?«, fragte Cau Thon höhnisch. »Sieh dich doch an! Du siechst dahin! Morgen früh bist du vielleicht schon tot! Ich werde nicht lange auf deine Entscheidung warten. Du musst sie jetzt treffen. Leben oder Tod. Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.«
Jetzt zitiert er auch noch Shakespeare, dachte der Marquês. Doch Cau Thon hatte Recht. Was für eine Wahl hatte er denn? Auf der einen Seite wartete der Tod, begierig ihn zu verschlingen, und auf der anderen Seite hatte er die Möglichkeit ewig zu leben, auf einer Stufe mit Leuten wie Perry Rhodan und Atlan zu stehen, ja sogar Herrscher über eine Galaxis zu werden. Doch der Preis, den er dafür zahlen sollte, war hoch. Er musste einen Pakt mit dem Teufel schließen und ihm seine Seele verkaufen. War dieser Preis nicht zu hoch?
Faust, dachte der Marquês sarkastisch. Ihm erging es wie die Figur in dem berühmten Stück von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahre 1808.
Ein heftiger Hustenanfall schüttelte den Marquês; er glaubte, ersticken zu müssen.
Cau Thon beugte sich über ihn und musterte ihn neugierig. »Oh, du Armer! Geht es dir nicht gut? Du hast nicht mehr viel Zeit. Wenn du erst einmal tot bist, hilft dir auch kein Zellaktivator mehr...«
Das wirkte. Der Marquês bekam Todesangst. Jeden Moment konnte es mit ihm vorbei sein.
»Also gut. Ich tue, was du willst. Bitte hilf mir!«, flehte er Cau Thon an.
»Schwöre es bei deinem Gott!«, forderte dieser.
»Ich schwöre.«
»So sei es. Empfange nun von meinem Meister die Gnade der Unsterblichkeit.«
Dem Marquês war es, als würde ihn plötzlich eine graue Wolke einhüllen. Sein Zimmer verschwand. Alles um ihn herum war grau.
Marquês Don Philippe Alfonso Jaime de la Siniestro, hörte der alte Mann eine mächtige Stimme in seinem Kopf.
»Wer bist du?«
Ich bin MODROR, dein Herr und Meister! Von nun an dienst du nur noch mir. Dafür verleihe ich dir das ewige Leben und ernenne dich zum fünften Sohn des Chaos.
»Gibt es noch mehr Söhne?«
Ja, sie werden sich dir bald zu erkennen geben. Sie sind mein, genauso wie du jetzt mein bist. Wenn du mich verrätst, entziehe ich dir das ewige Leben und du wirst zu Staub zerfallen. Willst du mir dienen auf immer und ewig?
»Ja, ich will. Bitte schenke mir das Leben!«, bat der Marquês demütig.
So sei es. Von nun an bist du mein Sohn des Chaos!
10. Der Pakt mit dem Teufel
Ein leichtes Klopfen in seiner Brust ließ Don Philippe wieder zu sich kommen. Die graue Wolke war verschwunden. Auch von Cau Thon war nichts mehr zu sehen. Hatte er all dies nur geträumt?
Doch da war das leichte Pulsieren zwischen linker Schulter und Brust. Unwillkürlich griff sich der Marquês dorthin.
»Das ist der Zellaktivatorchip. Er arbeitet und ist dabei Sie zu heilen, Marquês«, hörte der Spanier die vertraute Stimme Diabolos.
»Dann habe ich all das nicht geträumt? Ich habe wirklich einen Zellaktivator bekommen?«
»Ja. Was haben Sie da nur gemacht, Marquês? Das wird noch große Probleme geben. Wie fühlen Sie sich?«
»Besser. Ich fühle mich wie neugeboren.«
»Wir müssen uns eine Story für Sie überlegen.«
»Wieso?«
»Na ja, wir können ja schlecht der Presse und der Bevölkerung mitteilen, dass MODROR Ihnen durch Cau Thon einen Zellaktivator verliehen hat, damit Sie ihm dienen.«
Diabolo hatte Recht, daran hatte der Marquês noch gar nicht gedacht. Zu viel war auf ihn eingestürmt. Man musste sich zunächst alles sorgfältig überlegen, bevor man seine wundersame Genesung bekannt gab.
»Was schlägst du vor?«
»Lassen Sie verkünden, ES hätte Ihnen die Unsterblichkeit verliehen.«
Die Miene des Marquês erhellte sich wieder. »Das ist eine brillante Idee. Wenn ich es mir recht überlege, hätte ES das wirklich tun können, dann wäre ich jetzt nicht so in der Zwickmühle. Tja, so war MODROR eben zuerst da...«
Der alte Spanier war auf einmal wieder voller Tatendrang. Er spürte, wie das Leben in ihm pulsierte.
»Hole nun meine Kinder, Diabolo! Aber kein Wort von Cau Thon und MODROR! Wir sagen, ein Bote von ES wäre erschienen.«
»Wie Sie wünschen.«
»Nein warte, Diabolo. Ich möchte, dass wir sie alle überraschen. Lass mich noch etwas zu Kräften kommen. Ein, zwei Tage. Dann werde ich meinen großen Auftritt haben.«
Don Philippe konnte es immer noch nicht fassen. Das Schicksal hatte ihm eine zweite Chance gegeben. Was immer er dafür tun musste, er würde es tun.
*
Die vier Geschwister saßen zum Abendessen gemeinsam am großen Tisch im Speisesaal. Er wirkte leer und düster ohne den Marquês. Keiner der vier sagte ein Wort. Orlando, Stephanie, Peter und Brettany stierten auf ihr Essen und stocherten darin herum.
»Wenn Vater tot ist, wird das Universum die größte Ehrenbezeugung aller Zeiten sehen!«, brach Peter schließlich die Stille. »Das verspreche ich euch.«
»Darauf kann ich gut verzichten«, murmelte Brettany traurig.
»Auch eine Parade kann den Schmerz über Vaters Tod nicht mindern«, meinte Orly. »Sie ist nur eine Verschwendung von Geld und völlig überzogen.«
»Immer musst du alles kritisieren, was ich sage!«, brüllte Peter aufgeregt.
Stephanie legte ihre Hand auf seine und beruhigte ihn damit.
»Ihr werdet diese alberne Parade nicht brauchen«, hörten sie die Stimme ihres Vaters.
Als hätten sie einen Geist gesehen, starrten sie auf den alten Spanier, der munter und gesund wirkte. Neben ihm stand Diabolo.
Der Marquês war zwar noch etwas wackelig auf den Beinen, doch man merkte ihm deutlich an, dass es ihm besser ging.
Orly stand auf und reichte ihm einen Stuhl, doch sein Vater winkte ab. Brettany war die erste, die ihren Vater umarmte. Bitterlich weinte sie an seiner Brust.
»Wie in Gottes Namen...?«, stammelte Orly.
»Kinder, ein Bote von ES ist mir erschienen. Er hat gesagt, es ist mein Schicksal, Cartwheel zu führen, und er hat mir einen Zellaktivator verliehen, der mich geheilt hat und mir nun relative Unsterblichkeit verleiht. Ich werde weiterleben!«
Für einen kurzen Moment wurde der Marquês allerdings traurig. Was war mit seinen Kindern? Sie besaßen nicht die Unsterblichkeit. Er würde sie überleben. Es gab nichts Schlimmeres für einen Vater, als den Tod seiner eigenen Kinder mit anzusehen. MODROR musste bei Zeiten auch ihnen einen geben, schwor er sich.
Nun sprang auch Stephanie auf und umarmte ihren Vater. Nur Peter stand fassungslos vor ihn.
»Willst du deinem alten Vater nicht eine Umarmung schenken?«, fragte er mit einem Lächeln.
Peter fing an, irrsinnig zu lachen. Tränen vor Freude schossen ihm aus den Augen. Taumelnd lief er zum Marquês und warf sich heulend an ihn.
Die Familie war wieder vereint. Der Marquês hatte eine zweite Chance bekommen.
Nur Diabolo dachte darüber nach. Der Spanier hatte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Er würde sich eines Tages gegen Rhodan stellen müssen und all das verraten, wofür er gekämpft hatte. Vielleicht wäre der Tod für ihn besser gewesen, denn nun war er ein Sohn des Chaos, ein Wesen, welches den Tod magisch anzog und für ein diabolisches Wesen stritt.
In diesem Moment wurde Diabolo auch klar, dass jemand gelogen hatte. Das Friedensangebot von MODROR war ein Bluff!
Cau Thon hatte eindeutig gegen die Aussagen von Despair gehandelt und Diabolo kam zu einem Entschluss: Cauthon Despair hatte gelogen! Wissentlich oder selbst durch MODROR getäuscht. Die Entität strebte immer noch die Vernichtung Rhodans an und hatte bereits einen neuen Herrscher in Form des Marquês für die Milchstraße auserkoren.
Der Posbi sah an dem heutigen Tage, dem 29. September 1298 NGZ, eine Wende in Cartwheel. Sehr, sehr düstere Zeiten würden nun auf die Insel zukommen.
*
Joak Cascal saß an seinem Schreibtisch in seinem Büro in IMPERIUM ALPHA. Cascal war in Gedanken versunken. Er dachte darüber nach, wie es in Zukunft mit den Menschen auf Mankind und den anderen Planeten weitergehen sollte.
Plötzlich ging die Tür auf und der Besucher kam herein stolziert. Cascal glaubte seinen Augen nicht trauen zu können. Vor ihm stand Don Philippe de la Siniestro und sah aus wie das blühende Leben. Er war in einen feinen, weißen Gehrock in barockem Stil gekleidet und trug einen Dreispitz sowie einen Spazierstock. Er wirkte gesund und munter, als ob er sich völlig erholt hatte. Aber wie war das möglich?
Cascal stand auf und ging auf den alten Spanier zu.
»Marquês, wie schön Sie zu sehen, aber wie...?«
»Darf ich mich setzen?«, fragte der Marquês gut gelaunt.
»Wie? Äh, aber natürlich. Bitte nehmen Sie Platz.«
Cascal bot Don Philippe einen Stuhl an und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch.
Der Marquês begann seine Geschichte zu erzählen, die er sich zusammen mit Diabolo ausgedacht hatte. »Noch vor zwei Tagen hätte nicht viel gefehlt, und ich wäre heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben«, sagte er bedeutungsschwer. »Doch dann – ich kann es nicht anders beschreiben – geschah ein Wunder: ES erschien mir und ließ mir durch einen Boten einen Zellaktivatorchip zukommen.«
Cascal konnte es nicht fassen. »ES? Das ist ja unglaublich«, staunte er.
»Aber wahr. ES ließ mich wissen, dass ich dazu auserkoren sei für die Menschheit – das bezieht sich auch auf die Arkoniden – zu leben und zu wirken«, log der Marquês in theatralischem Tonfall. »ES ist der Ansicht, dass ich die Menschen in Cartwheel führen soll, ähnlich wie Rhodan in der Milchstraße. Ausgerechnet ich! Ich kann es selbst kaum glauben, dass mir solch eine Gnade zuteil wird.
Natürlich habe ich mich sofort von mehreren Ärzten untersuchen lassen. Sie alle bestätigten, dass in meiner Brust ein Zellaktivatorchip eingepflanzt wurde. Unmittelbar nach dem Besuch dieses Superwesens ging es mir bedeutend besser. Das Leben kehrte zu mir zurück. Heute erhielt ich die Erlaubnis der Ärzte, das Haus zu verlassen. Sie halten mich für völlig wiederhergestellt. Darum kam ich sofort hierher zu Ihnen, um alles zu berichten.«
Cascal musste all das erst einmal einordnen. Dass ES in dieser Weise eingriff, hatte es bislang noch nicht in Cartwheel gegeben, doch es freute ihn für den Marquês. Ihm war nicht wohl bei dem Gedanken gewesen, den alten Spanier zu beerben. Ohnehin fühlte er sich nicht zum Politiker berufen. All diese Intrigen und Lügen waren nicht sein Metier. Umso mehr freute es ihn, das Amt des Regierungschefs wieder an seinen Vorgänger abgeben zu können.
»Das ist wirklich großartig, Marquês. Einfach wunderbar. Ich beglückwünsche Sie dazu. Sie gehören nun zu den wenigen legendären Unsterblichen wie Perry Rhodan, Atlan, Reginald Bull und Gucky.«
»Ja, aber das ist auch eine große Verantwortung für mich. Ich werde Hilfe brauchen, Cascal, besonders Ihre«, meinte der alte Mann treuherzig.
»Sie können sich auf mich verlassen«, versicherte Cascal. »Wir sollten, sobald wie möglich, die Medien über Ihre Genesung informieren.«
»Gewiss. Ich habe diesbezüglich schon alles in die Wege geleitet. Meine Tochter Stephanie hat für heute Nachmittag eine Pressekonferenz einberufen, in der ich alles erklären werde. Meine Kinder waren überglücklich, mich wiederzuhaben. Auch sie konnten es anfangs kaum glauben, aber nun sind sie sehr stolz auf ihren Vater.«
Der Marquês erhob sich. »Ich denke, dass ich schon in dieser Woche wieder die Amtsgeschäfte übernehmen kann. Es gibt viel zu tun, und ES erwartet von mir Einiges.«
Auch Cascal stand auf, um Don Philippe zu verabschieden. »Je eher Sie zurückkommen desto besser. Was geschieht nun mit Cauthon Despair, wenn ich wieder den Posten des Terra-Marschalls übernehme?«
Der alte Mann überlegte einen kurzen Moment, dann sagte er: »Ich bin sicher, wir finden schon eine passende Aufgabe für ihn. Zunächst bleibt er stellvertretender Terra-Marschall.«
»Ich finde, wir sollten ihm nicht zu viel Macht geben, Marquês. Ich traue Despair nach wie vor nicht.«
»Hat er sich während meiner Abwesenheit etwas zuschulden kommen lassen?«
»Nein, das kann ich nicht behaupten.«
»Nun, dann haben wir keinen Anlass, ihm zu misstrauen. Und solange Sie auf ihn aufpassen, kann doch gar nichts passieren«, meinte der Marquês fröhlich.
Insgeheim war ihm allerdings nicht ganz so wohl zumute. Denn Cascal eines Tages absetzen zu müssen, passte ihm gar nicht. Er hoffte noch einen Ausweg aus dieser Lage zu finden.
11. Der Vater der Menschheit
Einige Stunden später begann der Triumphzug des Marquês vor den Pressemedien.
Stephanie leitete die Pressekonferenz, zu der alle wichtigen Medienvertreter eingeladen waren. Die Konferenz wurde bis in den hintersten Winkel von Cartwheel live übertragen. Don Philippe berichtete von seiner Wunderheilung und verkündete stolz, dass ES ihn ausersehen hatte, Cartwheel zu einen und Frieden zu bringen.
»Das wird natürlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Darum erhielt ich einen Zellaktivatorchip, um diese Aufgabe wahrnehmen zu können. Und es ist nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Pflicht, sie wahrzunehmen. Aber ich erfülle diese Pflicht gern, denn ich tue es für die Menschheit!«
Danach hob Stephanie die Einzigartigkeit ihres Vaters hervor und wie wichtig er für Cartwheel geworden war. »Der Marquês ist nicht nur mein Vater, sondern er ist auch der Vater der Menschheit, der Vater der Nation!«, verkündete sie pathetisch. »Seien wir ES dankbar, dass er uns diesen liebevollen, gütigen Vater zurück gegeben hat!«
Die Bevölkerung von Mankind nahm die Nachricht von der Genesung des Marquês und seinem unverhofften Aufstieg mit großer Freude entgegen.
Die Bezeichnung »Vater der Menschheit«, die Stephanie ihrem Vater verliehen hatte, traf die Stimmung des Volkes genau. Die Menschen sahen in ihm in der Tat einen Übervater, dem sie vertrauten und der sie in eine neue, bessere Zukunft führen sollte. Viele waren nach Cartwheel gekommen, weil sie mit den Zuständen innerhalb der Milchstraße nicht mehr zufrieden waren und sich auf der Insel eine bessere Zukunft erträumten. Der Marquês brachte Hoffnung, dass dies nun Wirklichkeit werden könne. Die Aussöhnung mit den Arkoniden schien mit ihm möglich. Dass nun sogar die Superintelligenz ES eingriff und dem alten Spanier einen Zellaktivatorchip verlieh und ihm damit auf eine Stufe mit Unsterblichen wie den legendären Perry Rhodan und Atlan stellte, steigerte seine Popularität nochmals gewaltig.
Man bewunderte ihn, er hatte dem Tod getrotzt und war mit dem ewigen Leben beschenkt worden. Nun traute man dem Marquês auch durchaus zu, die schwierigen Probleme innerhalb Cartwheels zu lösen. Sogar die wortgewaltige Opposition der Liberalen Einheit, die sonst nicht um populistische Argumente verlegen war, blieb ruhig.
Jede unabhängige ärztliche Untersuchung bestätigte, dass der Marquês einen Zellaktivator trug. Die wundersame Erzählung von dem Segen von ES stand somit auf einem festen Fundament, dass viele in Staunen versetzte, aber niemand konnte widersprechen.
Jedermann vertraute dem Marquês und keiner kam auch nur im Traum auf die Idee, dass MODROR und sein Handlanger Cau Thon dies alles eingefädelt hatten. Niemand ahnte auch nur im Mindesten, was auf Cartwheel und seine Einwohner zukommen sollte.
12. Auf der Suche nach Antworten
Quinto, 28. Oktober 1298 NGZ
Rosan und Wyll Nordment hatten Cartwheel erreicht. Quinto war ein kalter, dunkler Planet, der nur über wenig Atmosphäre verfügte. Er besaß einen Durchmesser von 1859 Kilometern und eine Gravitation von 0,51 g. Es gab nur einen Kontinent, der lediglich aus einer gewaltigen Steinwüste bestand. Darunter befand sich jedoch New Nike, eine unterirdische Stadt, die von der Neuen USO als wichtigste Basis in Cartwheel genutzt wurde. Sofort nach Beginn der Besiedelung Cartwheels hatten Monkey und Homer G. Adams die Bedeutung dieser neuen, multikulturellen Galaxis erkannt und es für richtig befunden, auf diesem öden Planeten, der nach Nike Quinto, dem legendären Leiter der noch legendäreren Abteilung III, benannt worden war, einen Stützpunkt zu errichten.
Es war schon eine Meisterleistung, wie die Neue USO es geschafft hatte, innerhalb kürzester Zeit Personal und Ressourcen für die Insel frei zu machen. Schließlich fand man mit dem öden Felsplaneten eine ideale Basis und errichtete den Stützpunkt unterirdisch.
Als Wyll und Rosan von Bord gingen, nahm sie ein Offizier in Empfang und geleitete sie quer durch den Stützpunkt zu seinem Chef Jan Scorbit, der die USO in Cartwheel leitete.
Die Nordments waren beeindruckt, wie gut der Stützpunkt ausgerüstet war. Überall herrschte geschäftiges Treiben. Roboter und Wesen aus den verschiedensten Welten liefen durch die Korridore. An vielen Stellen wurde noch gebaut.
Im Hauptbüro des Stützpunktes angekommen, begrüßte sie Jan Scorbit. Die drei kannten sich flüchtig. Sie waren sich auf Mashratan begegnet und später in der ersten Zeit der USO, bis sich Rosan und Wyll freiwillig ins Privatleben zurückgezogen hatten.
»Wir sind beeindruckt von dem Stützpunkt«, sagte Wyll.
»Ja, wir sind allerdings immer noch am Arbeiten. Aber wir kommen gut voran.«
Scorbit ging zu einer kleinen Hausbar, die in einen Schrank eingebaut war, und holte eine Flasche mit grüner Flüssigkeit und ein paar Gläser hervor.
»Darf ich Ihnen einen Vurguzz anbieten?«, fragte er höflich.
»Danke, nein. Nach der anstrengenden Reise möchten wir erst einmal lieber eine Mahlzeit zu uns nehmen«, lehnte Rosan, sehr zu Wylls Bedauern, ab.
»Nun gut, aber ich genehmige mir einen«, sagte Scorbit und goss sich das Glas voll, dann leerte er es in einem Atemzug und goss sich ein zweites Glas ein.
Rosan und Wyll berichteten Scorbit abwechselnd, was sich in jener Nacht in ihrem Appartement zugetragen hatte und von ihrem Gespräch mit Monkey, der ihnen auch einen Datenträger mit Informationen und Instruktionen für Jan Scorbit mitgegeben hatte.
Als Scorbit die Daten studiert hatte, meinte er: »Ich stimme Monkey zu. Wir wissen, dass sich Krek Soron seit Monaten hier aufgehalten und verschiedene Aufträge ausgeführt hat. Wir wissen auch, dass Soron am liebsten für die Arkoniden gearbeitet hat. Wir sollten daher in diese Richtung ermitteln. Auch ich biete euch beiden an, für die Neue USO zu arbeiten. Trotz aller Fortschritte hier auf Quinto brauchen wir dennoch dringend neue Leute. Ich weiß, dass Adams und Monkey euch das schon unzählige Mal gesagt haben. Aber die Situation hat sich nun geändert.«
Wyll schüttelte den Kopf. »Ich bin mir noch nicht sicher. Ich möchte zuerst wissen, wer hinter Krek Soron steht und wer uns töten will und warum.«
»Wyll hat Recht. Davon hängt für uns alles weitere ab.«
Scorbit leerte ein weiteres Glas Vurguzz. »Es gibt gewisse Hinweise. Wie ich schon sagte, arbeitete Soron meistens für die Arkoniden. Wir wissen definitiv, dass er sich in den letzten Wochen auf Bostich aufgehalten hat. Er wurde im Palast von Jenmuhs gesehen.«
»Jenmuhs«, flüsterte Rosan. »Was ist, wenn er Rache für den Tod seines Bruders nehmen will?«
»Nach all den Jahren?«, wunderte sich Jan Scorbit.
Ihm war die Entführung der LONDON II natürlich ebenso im Gedächtnis geblieben, wie Rosan und Wyll. Sicherlich nicht so intensiv, da er nur an der Suche des Luxusraumschiffes beteiligt gewesen war. Doch er erinnerte sich gut an die Angst und Sorge um seinen Bruder Remus und seine Schwägerin Uthe. Der Zwillingsbruder von Uwahn Jenmuhs, Hajun, hatte damals besonders Rosan und Uthe gequält. Seine tödlichste Waffe war ein dressierter Okrill gewesen, der mittels Sender auf Jenmuhs gehört hatte. Als Uthe und Rosan ihm den Sender weggenommen hatten, hatten sie die Steuerung einem Sklaven Jenmuhs gegeben, der den Okrill dazu einsetzte, um Jenmuhs zu töten. Der arkonidische Widerling war damals seiner gerechten Strafe zugeführt worden.
»Wieso hat Jenmuhs euch nicht vorher erledigt? Es gab viele Chancen dazu, besonders als er noch bei der Mordred war«, grübelte Scorbit.
»Vielleicht hatte er nicht die Gelegenheit dazu. Ich weiß es nicht«, gestand Wyll.
Nordment sprang auf.
»Dann müssen wir eben Beweise finden«, drängte er. »Wir sollten so schnell wie möglich mit den Ermittlungen beginnen.«
»Das werden wir«, versicherte Scorbit. »Zuvor werden wir euch in New Terrania unterbringen. Ich habe euch dort eine Wohnung besorgen lassen. Wir haben einen kleinen Vorteil, da Jenmuhs noch nicht weiß, dass ihr beide hier seid. Von Krek Sorons Scheitern wird er allerdings sicher bald erfahren.«
Rosan und Wyll standen auf.
»Also gut, ab jetzt sind wir in deinem Team«, entschied Wyll und reichte Scorbit die Hand.
»Darauf trinke ich noch einen«, sagte Scorbit und leerte zum Erstaunen der Nordments das nächste Glas Vurguzz in einem Zug.
*
Am nächsten Tag brachte ein USO-Raumer die Nordments nach Mankind. In New Terrania hatte ihnen die Neue USO eine Wohnung an der Peripherie der Hauptstadt besorgt. Es war ein kleines Häuschen, wie es viele auf Mankind gab.
DORGON hatte seinerzeit für alles gesorgt und genügend Wohnraum zur Verfügung gestellt. Inzwischen waren die Terraner daran gegangen, selbst zu bauen oder die zur Verfügung stehenden Gebäude umzubauen.
Jan Scorbit brachte die Nordments persönlich in ihr neues Domizil. »Ich hoffe es gefällt euch. Ich habe aus Sicherheitsgründen ein unauffälliges Haus in einem ruhigen Stadtteil gewählt. Hier können euch meine Leute besser bewachen.«
»Wir fühlen uns hier gut aufgehoben«, versicherte Rosan.
Als Scorbit gegangen war, begannen die Nordments, ihr Gepäck auszupacken und sich in ihrer neuen Wohnung einzurichten. Danach rief Rosan bei Uthe Scorbit an, um sich bei zur melden.
Uthes Bild erschien auf dem Monitor des Visiphons.
»Wie schön, dass wir uns endlich einmal wiedersehen.«
»Ja, Uthe. Es ist schon viel zu lange her. Aber ihr wart ja auch immer in irgendeinem anderen Winkel des Universums«, scherzte die Halbarkonidin.
Uthe lächelte. »Da hast du Recht. Aber wir hoffen, hier nun endlich sesshaft zu werden. Wie wäre es, wenn du und Wyll heute Abend zu uns zum Essen kommt? Ihr seid herzlich eingeladen.«
»Mit dem größten Vergnügen«, nahm Rosan die Einladung an.
»Prima. Joak Cascal wird übrigens auch da sein. Dann sehen wir uns heute Abend. Bis dann!«
*
Am Abend trafen sich die vier in der Wohnung der Scorbits im Zentrum von New Terrania.
Rosan und Wyll berichteten den Scorbits, was sie in der letzten Zeit erlebt hatten und dass sie Uwahn Jenmuhs verdächtigten, hinter dem Mordanschlag zu stecken.
»Ich habe die Befürchtung, dass er sich auch an euch rächen will«, schloss Rosan.
»Das denke ich auch«, stimmte Remus ihr zu. »Wir müssen in Zukunft vorsichtig sein. Allerdings gibt es ja noch keine Beweise für Jenmuhs' Mittäterschaft.«
»Stimmt, aber wenn es welche gibt, werden wir sie finden«, sagte Wyll Nordment entschlossen.
Rosan bemerkte, dass Uthe niedergeschlagen wirkte.
»Was ist Uthe? Bist du sehr beunruhigt?«
Uthe winkte ab. »Es ist nicht wegen mir. Als Ministerin bin ich gut geschützt und ich habe auch keine Angst vor Jenmuhs. Aber ich mache mir Sorgen um ein Mädchen, für das ich verantwortlich bin. Sie heißt Anica.«
Uthe stand auf und holte eine Holographie von Anica und zeigte sie den Nordments.
»Ein hübsches Mädchen«, fand Rosan.
»Hübsch ja, aber leider auch ein bisschen dumm«, meinte Remus, was ihm einen Rippenstoß von seiner Frau einbrachte.
»Sie ist geistig etwas minderbemittelt«, stellte Uthe klar. »Aber sie stammt auch von einer primitiven Welt namens Zechon.«
Rosan erinnerte sich wieder an die Zechonin, die sich während des Aufenthalts der Scorbits auf Terra kurz gesehen hatte.
»Sie ist schon seit Wochen verschwunden. Ich mache mir große Sorgen. Wir haben in allen Kliniken auf Mankind nachgefragt, aber es war alles vergeblich.«
»Habt ihr auch in den Leichenschauhäusern nachgefragt?«, fragte Wyll unbehaglich.
Remus nickte. »Haben wir. Aber hier gab es glücklicherweise nichts. Ich habe Jan gefragt, ob er irgendwelche Hinweise hat. Aber auch die USO hat nichts gefunden. Es ist, als sei sie vom Erdboden verschwunden.«
»Oder von Mankind. Könnte sie mit einem Raumschiff geflogen sein?«, vermutete Rosan.
»Wie denn? Sie hatte doch gar nicht genug Geld bei sich«, meinte Uthe.
»Wir sollten trotzdem auf den Raumhäfen nachforschen. Vielleicht hat sie ja dort jemand gesehen«, hoffte Wyll.
Uthes Miene verfinsterte sich noch mehr. »Sollte Anica wirklich Mankind verlassen haben, finden wir sie nie wieder.«
»Wir helfen dir, wo wir nur können«, versicherte Rosan.
Uthe nickte dankbar. »Danke, es tut gut solche Freunde zu haben.«
13. Vorboten des Unheils
Zufrieden mit sich und der Welt saß der Marquês in seinem Büro. Erst jetzt, da er endlich einmal Zeit für sich selbst hatte, realisierte er nach und nach, was geschehen war.
Neben der großen Freude, dem Tod entronnen zu sein und gar Unsterblichkeit erlangt zu haben, befiel ihn auch ein wenig Unbehagen darüber, dass er Cau Thon und dessen Meister MODROR ausgeliefert war. Doch was hätte er tun sollen? Wenn er sich geweigert hätte, würde er nun nicht mehr darüber nachdenken können.
Allmählich wurde dem alten Spanier bewusst, in was für einem Dilemma er sich befand. Er hoffte, dass man seine Dienste nicht allzu bald in Anspruch nehmen würde.
Die Sekretärin, die im Vorzimmer saß, riss den Marquês aus seinen grüblerischen Gedanken und meldete ihm den Besuch von Cauthon Despair.
Aus den Äußerungen Cau Thons war hervorgegangen, dass Despair anscheinend immer noch zu MODROR gehörte. Es war das erste Mal seit seiner Genesung, dass sich der Mann mit der Silberrüstung bei ihm meldete. Handelte es sich um einen Höflichkeitsbesuch oder steckte mehr dahinter?
Don Philippe wies seine Sekretärin an, Despair hereinzulassen, und wenige Augenblicke später stand der Silberne vor ihm.
»Ich grüße Sie, Despair. Was kann ich für Sie tun?«
»Für mich nichts. Jedoch für MODROR.«
Der Marquês musste schlucken. So früh schon war es soweit. MODRORs Handlanger verloren keine Zeit.
»Sie wissen Bescheid?«, fragte er Despair mit belegter Stimme, obwohl er die Antwort schon kannte.
»Selbstverständlich. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Genesung, die Sie unserem gemeinsamen Meister zu verdanken haben. Das alles kommt sicher sehr überraschend für Sie, aber ich versichere Ihnen, dass Sie den richtigen Weg gewählt haben. MODROR bedeutet Zuverlässigkeit und Stärke.«
Beide schwiegen. Der Marquês starrte Despair fragend, fast schon vorwurfsvoll an. Er begriff, dass das ganze Friedensangebot nur ein Trick war. Cauthon Despair hatte die ganze Galaxis wissentlich belogen. Man wollte sie in Sicherheit wiegen. MODROR würde nicht so versteckt agieren, wenn er es ehrlich mit dem Frieden gemeint hätte. Doch was bezweckten sie damit?
Despair schien geradezu zu spüren, dass den Marquês diese Frage quälte. »Sie fragen sich sicher, warum? Nun, ich bin ein Sohn des Chaos. Ich bin es mit Stolz! Das Angebot MODRORs war nichts weiter als ein Schachzug. Cartwheel ist unabhängig. Das war unser Ziel. Ein autarkes Cartwheel kann viel besser manipuliert werden. Sie und Nor'Citel werden dabei eine gewichtige Rolle spielen, die Insel zur Bastion MODRORs und nicht mehr DORGONs zu machen.
Sie werden es nicht bereuen, denn MODROR ist der Gewinner dieses kosmischen Schachspiels.«
»Gewiss«, stimmte der Marquês verhalten zu.
»Sie sind noch skeptisch. Das wird sich legen. Der Grund meines Besuches ist, Ihnen mitzuteilen, dass morgen ein Treffen mit den anderen Söhnen des Chaos auf Paxus stattfindet. Es ist Zeit, dass Sie alle kennen lernen und wir unsere nächsten Schritte koordinieren. Unser Meister plant Großes. Wir werden seinen Plan zum Erfolg führen. Alles Weitere erfahren Sie morgen auf Paxus, wenn wir uns in der Residenz von Nor'Citel treffen. Wir fliegen in aller Frühe. Ich hole Sie ab.«
»Ist das nicht ein bisschen kurzfristig?«, wandte der Marquês ein. »Ich brauche noch etwas Zeit, um mich zu erholen und neu zu konsolidieren...«
»Nein, wir warten schon zu lange. Der Zeitpunkt ist gekommen, um die Pläne unseres Meisters in die Tat umzusetzen. Wenn Sie ihm treu dienen, wird er Sie fürstlich belohnen. Aber ich warne Sie: Kommen Sie nicht auf die Idee, ihn zu verraten. So wie er Ihnen das ewige Leben gab, so kann er es Ihnen wieder nehmen. Bedenken Sie dies«, sagte Despair mit drohendem Unterton und ging.
Zurück blieb der Marquês, dessen Laune deutlich gesunken war. Was sollte er nun tun?
Er fand keine Antwort. Aber er wusste, dass er weiterleben wollte.
14. Treffen der Söhne des Chaos
Paxus, 30. Oktober 1298 NGZ
Vierundzwanzig Stunden später landete der Marquês zusammen mit Cauthon Despair auf Paxus. Offiziell war die Zusammenkunft als lockeres Treffen zwischen einigen Staatschefs ausgewiesen worden.
Don Philippe musste sich eingestehen, dass er keine Ahnung hatte, was auf dieser Konferenz eigentlich besprochen werden sollte.
Vom Raumhafen aus flogen der Marquês und Despair zur Residenz Nor'Citels, der als Gastgeber fungierte.
Nor'Citels Residenz lag an der Peripherie der riesigen Hauptstadt Paxus. Das etwas düster wirkende Anwesen war stark bewacht. Don Philippe sah überall bewaffnete, grimmig dreinschauende Überschwere patrouillieren. Das Treffen fand unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit statt, denn Nor'Citel wünschte offenbar keine Presse und war entschlossen, jeden Medienvertreter abzuwehren.
Als er und Despair ausstiegen, wurden sie von einem großgewachsenen, behelmten Pariczaner empfangen.
»Marquês von Siniestro, ich begrüße Sie und Cauthon Despair im Namen meines Herren. Mein Name ist Poleycra, ich bin der Stellvertreter Nor'Citels.«
Der Marquês nickte ihm wohlwollend zu. Die Hand des Pariczaners wollte er lieber nicht schütteln, da sie ihn eher an die Pranke eines Bären erinnerte.
Poleycra machte eine einladende Geste und wies auf das Haus. »Wenn ich bitten darf. Es sind schon alle Konferenzteilnehmer versammelt. Wir warten nur noch auf Sie beide.«
Der Marquês und Despair, der wie immer wenig Worte machte, folgten ihm ins Innere.
Poleycra brachte die beiden in das großangelegte Gebäude. Nachdem sie einige lange Korridore, die mit pariczanischen Insignien verziert waren, durchquert hatten, gelangten sie in den Konferenzsaal. Dort befanden sich, an einem runden Tisch sitzend, Uwahn Jenmuhs, der Pelewon Torsor und der Gastgeber Nor'Citel.
Der Überschwere erhob sich. »Willkommen in unserer Mitte, Marquês von Siniestro«, sagte er emotionslos. »Ich bin froh, Sie gesund unter den Lebenden zu sehen.«
»Dem schließe ich mich an«, bekundete Uwahn Jenmuhs freundlich. »Ich bin sehr froh, dass Sie uns erhalten bleiben.«
Der riesige Torsor schwieg. Vor ihm hatte der Marquês besonders Respekt. Dieses Wesen war ihm einfach unheimlich.
»Setzen Sie sich«, bot Nor'Citel an.
Don Philippe und Cauthon Despair setzten sich auf die beiden freien Plätze. Jeder saß nun, passend zu seiner Größe, in einem schwarzen Drehsessel.
In diesem Moment erschienen wie aus dem Nichts zwei weitere Gestalten. Sie materialisierten einfach im Raum. Bei genauerer Betrachtung schienen es Hologramme zu sein. Den einen kannte der Marquês gut. Es war Cau Thon! Nur zweimal hatte er das Gesicht des Xamouris erblickt. Einst in der Galaxis Zerachon, als er mit den Besatzungsmitgliedern der TERSAL von ihm gejagt wurde, und vor wenigen Tagen, als ihm die Unsterblichkeit verliehen wurde. Das Elefanten-ähnliche Wesen neben ihm war Goshkan, ein weiterer Sohn des Chaos. Sie waren nun fünf an der Zahl, wie Cau Thon erklärt hatte. Der Xamouri selbst, Despair, Goshkan und der Marquês.
Wer ist der Fünfte?, fragte sich der Spanier.
»Da Sie nun zu unserer Mitte gehören, wird es Zeit, dass ich mich Ihnen vorstelle und meinen wahren Namen nenne«, sagte der Überschwere stolz. »Ich bin Leticron, einst Erster Hetran der Milchstraße, Corun von Paricza und nun Sohn des Chaos.«
Damit war die Frage beantwortet, doch dem Marquês sagte dieser Name nichts, was Leticron enttäuscht zur Kenntnis nahm.
»Haben Sie noch nichts von mir gehört?«
Der alte Spanier machte eine Geste des Bedauerns. »Es tut mir Leid, aber ich hatte noch nicht die Zeit, mich mit der kompletten terranischen Geschichte vertraut zu machen.«
Leticron sah ihn durchdringend an. »Einst war ich Hetran der Milchstraße. Ich hatte dieses Amt von Perry Rhodan übernommen, weil er sich weigerte, mit den Laren zu kooperieren. Ich hätte Rhodan vernichtet, doch er ist feige geflohen. Lange Zeit war ich in einem PEW-Block auf dem Saturn-Mond Titan gefangen, bis mich ein gütiges Schicksal von meinem Leid befreite. Doch während der langen Leidenszeit schwor ich denen, die Schuld an meinem Schicksal waren, grausame Rache. Da Hotrenor-Taak, der elende Lare, und Maylpancer, dieses verräterische Fäkalstück, inzwischen tot und verrottet sind, bleibt nur noch Perry Rhodan übrig. Er und all seine Freunde wie Atlan oder Julian Tifflor werden meine Rache zu spüren bekommen. Ich werde sie und ihre Liga Freier Terraner zerstören. Dann werde ich wieder meinen Platz als oberster Herrscher der Milchstraße einnehmen.«
Leticron alias Nor'Citel hatte sich so in Rage geredet, dass der Marquês fröstelte. In was für eine Gesellschaft war er da nur hinein geraten?
»Wer was einnimmt, bestimmt MODROR!«, stellte Cauthon Despair eisig klar.
Die Hologramme von Cau Thon und Goshkan schienen die Rolle der Beobachter eingenommen zu haben. Das wirkte umso düsterer. Sie überließen Despair das Reden und musterten jeden der Verbündeten eindringlich.
Leticron warf ihm einen bösen Blick zu, schwieg aber.
»Wir haben uns heute hier versammelt, um damit zu beginnen, MODRORs Pläne in die Tat umzusetzen«, fuhr Despair fort. »Don Philippe und Uwahn Jenmuhs repräsentieren die mächtigsten Völker aus der Milchstraße. Sie arbeiten nun für MODROR, ebenso wie Sie, Leticron.«
Der Pelewon Torsor brummte laut.
Nun ergriff Cau Thon das Wort. »Die mächtigen Bestien von M 87 werden auch zu uns stoßen. Dank unserem Bruder des Chaos Leticron haben wir wertvolle Verbündete in den Pelewon und Moogh gefunden. Schon bald wird auch eure Stunde schlagen, Torsor.«
Der gigantische Pelewon mit einer überdimensionalen Größe von 550 Zentimetern und 350 Zentimetern Schulterbreite schien zufrieden.
Goshkan, der Katrone aus der Galaxis Shagor, der für seine Brutalität bekannt war, begann nun zu sprechen: »Unser Bruder Cau Thon wird in Kürze Dorgon aufsuchen, um dort das Lieblingsvolk unseres Feindes DORGON zu unseren Verbündeten zu machen. Schon bald wird Cartwheel vereint mit Dorgon und den mächtigen Völkern MODRORs eine unbezwingbare Einheit bilden.«
Stille.
Der Marquês fühlte sich unwohl. Aber auch Uwahn Jenmuhs schien etwas verunsichert. Die Gestalten machten ihm Angst.
»Was sollen wir denn für MODROR tun?«, fragte der Marquês schließlich voller Unbehagen.
»Ihr sollt das Imperium Cartwheel gründen«, erklärte Cau Thon. »Dieses Reich wird groß und mächtig werden, bis es bereit ist, gegen die Milchstraße in den Krieg zu ziehen und sie zu unterwerfen.«
»Etwa auch gegen Arkon?«, wollte Jenmuhs wissen.
»Gegen alle, die MODROR im Weg stehen!«, zischte Despair. »Würdset du nicht gerne über das Kristallimperium herrschen, Uwahn Jenmuhs? Möchten Sie nicht anstelle von Bostich unsterblicher Imperator werden?«
Gier funkelte in Jenmuhs Augen auf, Gier nach dem ewigen Leben und absoluter Macht. »Heißt das, ich könnte auch einen Zellaktivator bekommen?«
»MODROR hat bereits dem Marquês einen Zellaktivator verliehen. Das kann er auch mit Ihnen«, erklärte der Silberne Ritter eindringlich und wandte sich dann dem Pelewon zu. »Oder Ihnen, Torsor. Würden Sie nicht auch gerne eines Tages über M 87 herrschen und Rache an den Okefenokees nehmen, die Ihr Volk so schmählich behandeln? MODROR kann Ihre Wünsche erfüllen. Alles was er dafür verlangt, ist Ihre Loyalität!«
Seine Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Jenmuhs war zutiefst beeindruckt.
Auch Torsor schien von Despairs Worten angetan zu sein. »Das klingt sehr verlockend. Doch wie sollen wir das bewerkstelligen? Wie sollen wir solch ein Imperium errichten?«
»Der erste Schritt ist bereits getan. MODRORs Friedensangebot, das ich überbrachte, war nur eine Finte, die dazu diente, seine Feinde in Sicherheit zu wiegen und die Unabhängigkeit Cartwheels zu ermöglichen. Wie ihr seht, hat es funktioniert. Nun können wir schalten und walten, wie wir wollen. Wir alle werden von nun an daran arbeiten, ein neues Imperium zu errichten, dessen Keimzelle Cartwheel sein wird.«
Der Marquês hatte gegen all dies Bedenken, doch er traute sich nicht zu widersprechen. Er spürte, dass er diesen finsteren, zu allem entschlossenen Fanatikern nicht gewachsen war. Diesen Leuten traute er durchaus zu, die Macht in Cartwheel zu übernehmen, noch dazu wo sie MODROR hinter sich hatten. Doch er konnte nichts tun. Er musste abwarten und gute Miene zum bösen Spiel machen.
»Hat jemand Einwände oder Bedenken vorzutragen?«, fragte Goshkan mit leicht drohenden Tonfall.
Niemand hatte etwas zu sagen.
»Gut. So sei es beschlossen«, sagte Despair.
Alle Anwesenden erhoben sich. Cauthon Despair verabschiedete sich im Namen aller von seinen Brüdern des Chaos Cau Thon und Goshkan. Die Hologramme erloschen. Don Philippe war verunsichert. Ein Imperium gründen? Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Ebenso wenig gefiel ihm der Gedanke, sich eines Tages mit Perry Rhodan anlegen zu müssen.
Leticron nahm ein Glas Wein und sprach mit einem diabolischen Grinsen einen Toast aus.
»Auf den Bund der Vier; Paricza, Terra, Arkon und Pelewon. Wir werden diese Galaxis völlig verändern und uns Untertan machen.«
»Ein Imperium der Vier«, murmelte der Spanier. »Ein Quarterium.«
15. Der Beginn der Veränderungen
Es war kalt und regnerisch. Ein kühler Wind wehte und der Regen peitschte. Das Dunkel der Nacht verlieh der sowieso schon schroffen Landschaft eine finstere Erscheinung. Ein Mensch stand am Fenster seines Schlafzimmers und beobachtete die Gegend.
Blitze zuckten durch den Himmel und erhellten ihn. Der Regen nahm zu, wie auch der Wind. Böen zogen über das Tal, knickten die Bäume und rissen Äste ab. Eichhörnchen, Kaninchen und siniestrische Baumtiere suchten ihr Heil in der Flucht oder versuchten, in ein sicheres Versteck zu kommen.
Das Chaos brach über die kleinen Wesen herein. Das Chaos...
Chaos war auch über den Menschen, der am Fenster stand, hereingebrochen. Er hatte keine Möglichkeit gehabt es abzuwehren, denn das Chaos bedeutete Leben. Seine Prinzipien bedeuteten den Tod!
Seit wenigen Tagen nun war er ein Sohn des Chaos. Nun waren Perry Rhodan und all die anderen nicht mehr seine Freunde, sondern Feinde. Rhodan hatte ihm vertraut und ihn aufgebaut. Nun sollte er ihn verraten? Was sollte der Marquês mit dem Terrablock machen? Er hatte diese Kolonie der Liga Freier Terraner aufgebaut und die letzten drei Jahre seines Leben darin investiert.
Unendliche Fragen spukten im Gehirn des Marquês von Siniestro herum, doch er kannte keine einzige Antwort.
Sollte er wirklich den Verrat an Perry Rhodan begehen? Den Verrat an dem Terrablock, der nur die Insel Cartwheel besiedelt hatte, um gegen MODROR zu kämpfen?
Der Marquês konnte und wollte sich nicht für eine Seite entscheiden. Doch er musste eine Entscheidung treffen. Sein Kopf schmerzte vom vielen Nachdenken.
Wäre er doch bloß niemals von Außerirdischen entführt worden! Dann wäre ihm das hier alles erspart geblieben.
Erschöpft öffnete der Marquês das Fenster seines Schlafzimmers. Der Regen tropfte von der Brüstung und dem Dach des Balkons. Langsam schritt der alte Spanier zum Geländer und stützte sich darauf ab.
Er blickte in die Nacht.
Wäre er niemals entführt worden, würde er jetzt nicht unsterblich sein. Er hatte eine Familie, vielleicht bald ein Imperium und den mächtigsten Verbündeten, den man sich wünschen konnte. Ein Schmunzeln überzog die Lippen des ältesten Menschen der Welt.
Warum zermarterte er sein Hirn? Warum akzeptierte er die Tatsache nicht? Der Marquês war ein Mann, der sich immer auf die Seite des Stärksten schlagen würde, da er den Willen zum Überleben hatte. Er stammte aus einer Zeit, in der Menschenleben wenig bedeutet hatten. Der einfache Bauer hatte regelmäßig sein Leben für den Aristokraten lassen müssen.
Diese Mentalität hatte Don Philippe de la Siniestro noch nicht abgelegt. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen gegenüber Perry Rhodan, der ihm ein Gönner gewesen war.
Doch das Angebot von MODROR war zu verlockend.
Ein Blitz zuckte durch den Himmel. Wenige Sekunden später folgte ein grollender Donner. Diabolo kam gerade aus dem Zimmer von Brettany, die Angst vor dem Gewitter hatte. Trotz der geistigen Evolution und der hohen Technik der Terraner konnten sie einige Angewohnheiten, die noch aus Zeiten ihrer primitiven Vorfahren stammten, nicht ablegen.
Diabolo machte ein Gewitter natürlich nichts aus. Es war ein natürlicher Vorgang und vor allem in diesem Zeitalter vollkommen ungefährlich, auch wenn der Marquês seine Burg auf Siniestro sehr spärlich mit Technik ausgestattet hatte.
Doch immerhin hatte Diabolo sich durchsetzen können und dafür gesorgt, dass ein Paratronschutzschirm zum Schutz der Burg eingebaut wurde.
So konnte er Brettany auch etwas beruhigen. Die jüngere Tochter des Marquês, die eigentlich aus seinen Genen hergestellt wurde, war zuweilen naiv und gutmütig. Ganz im Gegenteil zu ihrer verschlagenen Schwester Stephanie, die Diabolo manchmal Sorgen bereitete.
Doch viel mehr beunruhigte ihn die Tatsache, dass der Marquês sich seit Erhalt seines Zellaktivators sehr sonderbar verhielt.
Diabolo konnte sich nicht mit dem Gedanken abfinden, dass sein Meister tatsächlich seine Seele an MODROR verkauft hatte. Er trat in das Zimmer ein, der Marquês bemerkte ihn, sagte aber nichts.
»Wollen Sie wirklich Ihre Freunde verraten? Wollen Sie Perry Rhodan hintergehen? Sam, Joak Cascal und all die anderen? Was werden Ihre Kinder sagen?«
Der Unsterbliche wurde wütend und fletschte die Zähne. »Ich habe keine andere Wahl, Diabolo! Ich habe meine Seele an den Teufel verkauft, um weiterzuleben. Er bietet mir dafür alles, was ich in meinen Träumen begehrt habe. Warum hätte ich nicht zugreifen sollen? Ich bin ein Don! Wir sind es gewohnt, uns die Dinge zu nehmen!«
Der Spanier machte eine kurze Pause und atmete schwer.
»Ja, Diabolo, ich werde, wenn es sein muss, Perry Rhodan verraten, um an seine Stelle zu treten. Ich bin der Vater der Menschheit. Eines Tages werde ich über Terra regieren und ein noch nie da gewesenes galaktisches Reich gründen. Das ist mein Schicksal! Das ist Gottes Wille!«
Diabolo schwieg. Er zweifelte ernsthaft an dem Geisteszustand des Marquês. Normalerweise war das ein Fall für einen Psychologen, doch der Marquês war der mächtigste Terraner in Cartwheel und ein Günstling MODRORs, sowie der beliebteste Mann in ganz Cartwheel. Vielleicht konnte er seine Pläne wirklich durchsetzen. Irgendwie faszinierte das den Posbi wiederum. Er konnte noch so viele Dinge lernen von diesem beeindruckenden Mann aus längst vergangenen Jahrhunderten.
»Doch ich gebe zu bedenken, dass wir unter dem Banner MODRORs dieses – wie nannten Sie es doch sogleich – Quarterium regieren werden«, meinte Diabolo.
Der Marquês lachte abfällig. Ein krächzendes und unangenehmes Lachen. »Wir werden uns arrangieren müssen. Doch vorerst arbeiten wir zusammen. Unser primäres Ziel ist ein vereintes Cartwheel, welches wir als Waffe gegen DORGON einsetzen können. Ist es nicht Ironie?«
Diabolo überhörte den Zynismus des Marquês und fragte stattdessen: »Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Glauben Sie, die Menschen werden Ihnen gegen die eigene Heimatgalaxis folgen? Wie wollen Sie Arkon überzeugen?«
»All das wirst du bald erfahren, treuer Diabolo. Doch nun ist es Zeit für mich zu schlafen. Erzähle niemandem davon. Auch nicht den Kindern. Es soll ein Geheimnis zwischen MODROR und uns bleiben. Nun geh!«
Diabolo verneigte sich und verließ das Schlafzimmer des Marquês. Er hatte sich verändert. Durch den Zellaktivator und dem Bündnis mit MODROR hatte er mehr Macht. Und diese Macht machte ihn blind und tötete seine Moral ab.
Doch Diabolo glaubte, dass er seine Ziele verwirklichen konnte. Der Marquês war hoch intelligent und verfügte über das nötige Charisma.
Vielleicht war er der Mann, der Perry Rhodan bezwingen würde.
*
Am nächsten Morgen saß die fünfköpfige Familie de la Siniestro am Frühstückstisch. Stephanie fuhr sich durch die Haare, während Peter einigen Soldatenrobotern den Befehl gab, sein Brötchen zu belegen.
Orly hatte ein paar Tage frei bekommen und präsentierte seinem Vater die guten Noten. Peter reagierte mit Eifersucht darauf. Er hasste Orly, da er all das verkörperte, was Peter fehlte. Mut, gutes Aussehen und eine Karriere als Offizier.
Brettany beobachtete ihren Bruder. Ihr fiel auf, dass er hasserfüllt Orly anstarrte.
»Peter, was ist los mit dir? Du siehst aus, als wolltest du jemandem an den Hals gehen.«
Peter sah nun sie an. »Das geht dich nichts an! Du bist ein dummes Mädchen. Geh in dein Zimmer und spiel mit deinen Puppen!«
Brettany wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie war immer noch recht schüchtern und oft verlegen.
Orly mischte sich ein und stellte sich auf die Seite seiner »kleinen« Schwester. »Peter! Was fällt dir ein, so mit Brettany zu reden? Du bist doch derjenige, der mit Puppen spielt.«
Peter stieß einen lauten Schrei aus und schlug auf den Tisch. »Was musst du dich immer einmischen? Du bist doch nichts weiter als ein Freak! Ein Monster! Geh doch zu deinen Ratten und Wölfen, wo du hingehörst!« Die letzten Worte überschlugen sich.
Nun sprach der Vater ein Machtwort. »Es ist genug! Beruhigt euch beide! Ihr beschämt mich. Was wäre gewesen, wenn ich gestorben wäre. Wie hättet ihr denn weitermachen können? Gar nicht, vermute ich! Es wird Zeit, dass ihr Verantwortung übernehmt.«
Keiner der beiden sagte mehr etwas. Peter und Orly starrten sich gegenseitig an. Während sich in Orlys Augen Ungläubigkeit ausdrückte, strahlte der Blick seines Bruders Hass und Verachtung aus.
»Dann, Vater, gib mir endlich ein würdiges Amt, in dem ich Verantwortung übernehmen kann«, forderte Peter.
»So wird es auch kommen. Ihr alle vier werdet sehr verantwortungsvolle Posten bekommen. Die Segnung durch ES hat mir gezeigt, dass ich Ämter nur an Personen vergeben kann, denen ich vertrauen kann.«
Das rief Stephanie auf die Reihe. Sie schlang ihre Arme um den Hals ihres Vaters und küsste ihn auf die Wange.
»Danke Vater! Es ist eine Ehre, dass du uns vertraust. Darf ich Außenministerin und Pressesprecherin werden? Bitte!«
Der Marquês lachte. »Aber ja, Kindchen. Doch erst einmal musst du etwas abwarten. Die alten Minister müssen noch abtreten.«
»Wie willst du das vor dem Parlament rechtfertigen?«, wollte Orly wissen.
»Oh, das wirst du schon bald sehen. Ich fürchte, dass viele Politiker korrupt sind. Wir werden ihnen Fallen stellen. Jeder, der korrupt und nicht vertrauenswürdig ist, wird aus dem Kabinett entlassen werden. Und ihr seid die ersten, an die ich denke, um ihre Nachfolge anzutreten.«
Orly war nicht ganz wohl bei der Sache. Auch Brettany schien nicht ganz zu verstehen, was da eigentlich vor sich ging. Nur Stephanie und Peter waren hellauf begeistert. Sie wollten Macht! Die schienen sie jetzt zu bekommen.
16. Neue Gefolgsleute
»Was sollen wir hier? Das ist alles kostbare Arbeitszeit, die verloren geht. Da muss ich mindestens zehn Stellen streichen«, schnaubte der dicke Mann wütend.
»Wenn du dich streichst, musst du nur noch acht streichen, Diethar«, bemerkte ein junger Mann, der am gegenüberliegenden Ende des Konferenztisches saß. Er wippte in seinem schwebenden Sessel aus Formenergie und trank ein Glas Rotwein von Olymp.
Der Dicke ballte die Hand zur Faust und machte eine Drohgebärde. Dann nahm er ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Diethar Mykke war aufgeregt. Der Marquês von Siniestro höchstpersönlich hatte ihn zu einer streng geheimen Konferenz gebeten. Diethar glaubte, dass der Terra-Administrator auf seine herausragenden Fähigkeiten aufmerksam wurde, doch das Entsetzen war groß, als auch Charly und Ian Gheddy bei der Konferenz anwesend waren.
Richtig begonnen hatte sie noch gar nicht. Nur die drei Verwandten saßen in dem Zimmer. Mykke mochte seine angeheirateten Cousins nicht sonderlich. Charly war ein eingebildeter Taugenichts und Ian hätte in einem Horrorfilm mitspielen können.
Doch ihr größtes Verbrechen bestand darin, ihm die Firma BOHMAR INC. streitig zu machen. Bis jetzt teilten sie die Firma. Ein unglücklicher Umstand, wie Diethar Mykke fand. Endlich öffnete sich die Tür, doch an Stelle des erwarteten Marquês von Siniestro betraten drei weitere Gestalten den Raum. Es waren Werner Niesewitz, Reinhard Katschmarek und Peter Roehk. Sie grüßten die Anwesenden freundlich und setzten sich hin.
Diethar glaubte, man würde seine Zeit verschwenden.
»Was soll das? Ich habe einen Termin mit dem Staatschef und nicht mit euch Hampelmännern!«
»Sachte, sachte, Diethar!«, beschwichtigte Werner Niesewitz, der anscheinend mehr wusste als die anderen. »Don Philippe hat uns nicht umsonst alle hierher bestellt. Er hat große Pläne mit uns und dem Terrablock. Wartet nur ab!«
Mit einem Lächeln las Niesewitz auf seiner Tablettronik die Nachrichten des heutigen Tages durch. »Minister wegen Korruption entlassen«, las er vor. »Marquês verspricht harte Bestrafung und Neuordnung des Kabinetts.«
Diethar und Charly blickten sich fragend an. Sie hatten auch bereits von den Enthüllungen der Ministeraffären gehört. Insgesamt sechs Minister waren betroffen, denen Korruption und illegale Geschäfte nachgewiesen wurden. Der Marquês hatte das auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben und sofort die Entlassung der Minister angekündigt. Des Weiteren wollte er sein Kabinett neu ordnen und mit vertrauenswürdigen Männern und Frauen besetzen, egal ob diese nun politische Erfahrung und einen Doktortitel hatten oder nicht.
Der Marquês hatte wortwörtlich gesagt: »Es ist jetzt die Zeit, dass Menschen am Ruder sind, denen die Bevölkerung vertrauen kann. Uns nützt kein Diplomdoktor der Politik, wenn er das Volk hintergeht. Deshalb achte ich nicht auf Namen und Titel, sondern nur auf Befähigung bei der Neustrukturierung meines Kabinetts.«
Doch wie passten Niesewitz, Katschmarek, Mykke, Roehk und die Gheddys ins Bild? Diethar zündete sich seine Pfeife an und zog nervös an ihr. Dieses lange Warten machte ihn unruhig. Endlich öffnete sich erneut die Tür mit einem leisen Zischen und zwei Gestalten betraten den Raum. Es waren der Marquês von Siniestro und Cauthon Despair.
Der Silberne Ritter machte den dicken Leiter von BOHMAR INC. noch nervöser. Hastig machte er die Pfeife aus und starrte auf Despair.
Der Marquês wirkte gut gelaunt und agil. Er klatschte in die Hände und begrüßte die Anwesenden mit den Worten: »Es freut mich, dass ihr alle gekommen seid, meine Freunde. Große Dinge müssen heute besprochen werden.«
Er bat die sechs Besucher sich hinzusetzen. Ein Roboter brachte Kaffee und Kaltgetränke.
Despair beschloss zu stehen. Er stand direkt hinter dem Marquês, der am Kopf des gläsernen Konferenztisches saß.
»Meine Herren, Sie fragen sich sicherlich, warum ich Sie zu mir gebeten habe. Das hat einen einfachen Grund. Wie Sie wissen, sind sechs Ministerposten frei geworden auf Grund von Korruption und illegalen Geschäften. Ich habe freie Hand in der Neubesetzung des Kabinetts, da man mir uneingeschränkt vertraut.«
Der Marquês machte eine Kunstpause und ließ seine Worte wirken. Er blickte in die ratlosen Gesichter der sechs Besucher. Einige schienen angestrengt zu überlegen, was sie damit zu tun hatten. Andere schienen bereits auf die Lösung gekommen zu sein und dachten wohl darüber nach, welcher Ministerposten für sie vorgesehen wäre.
»Nun, ich habe Sie gerufen, um die Ministerposten teilweise an Sie zu verteilen. Ich habe mit einigen von Ihnen bereits zusammen gearbeitet und ich brauche Leute, die mir loyal ergeben sind, die keine Fragen stellen und nur mir allein dienen, wenn es sein muss!«
Die Worte des alten Spaniers wurden von jedem der sechs Männer verstanden. Vielleicht lag es daran, dass in jedem eine Menge krimineller Energie steckte. Außerdem hatte jeder von ihnen dasselbe Ziel – Macht!
Alle sechs schwiegen und sahen den Marquês wissbegierig an. Jeder wollte wissen, wie es weiterging.
Mit einem Lächeln auf den Lippen sprach der Don weiter: »Das Außenministerium wird von meiner Tochter Stephanie geleitet werden. Sie ist bereits darüber informiert. Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit wird an Sie, Diethar Mykke, gehen.«
Diethar konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Er glaubte, er würde träumen. Als Minister für Wirtschaft und Arbeit war er einer der mächtigsten Männer im Terrablock. Aber warum ausgerechnet er? Doch diese Frage wollte er noch nicht stellen. Nicht als erster.
Der Marquês fuhr fort: »Mein guter Freund Werner Niesewitz wird Innenminister und Leiter des Terranischen Liga Dienstes. Reinhard Katschmarek wird Minister für Kultur, und Peter Roehk Minister für Wissenschaft und Forschung.«
Die drei illustren Gesellen grinsten breit. Sie waren am Ziel ihrer Träume. Sie hatten sehr verantwortungsvolle Positionen bekommen.
»Das Finanzministerium wird von Finanzminister Ewald Festor übernommen werden. Der Knauser kennt sich gut mit Zahlen aus.«
Damit waren die Ministerposten verteilt. Ian und Charly Gheddy blickten sich wütend an. Was war mit ihnen?
»Opa, was sollen wir denn machen?«, fragte Charly abfällig.
Der Marquês schmunzelte überlegen und gab Despair einen Wink. Der Silberne Ritter packte Charly und warf ihn gegen die Wand. Dann hob er ihn hoch und drückte ihn gegen sie. Despairs rechte Hand presste sich wie eine Schraubzwinge um den Hals von Charly Gheddy.
»Es tut mir Leid«, röchelte er.
Ian saß still auf seinem Sessel und beobachtete das Geschehen mit seinen kalten Augen.
Despair ließ Gheddy los, der erschöpft auf den Boden sank. Dann trat der Silberne Ritter wieder hinter den Marquês.
»Ganz einfach, mein grüner Junge«, begann der Marquês. »Ihr bekommt BOHMAR INC! Als Minister darf man sich nicht erlauben, noch andere Firmen zu besitzen, mit denen man in einen Interessenskonflikt kommt. Ebenfalls werden Niesewitz, Katschmarek und Roehk SHORNE INDUSTRY abgeben. Der Arkonide Ryc da Flayr wird das Geschäft leiten. Ich denke, wir werden gut mit ihm zusammen arbeiten können. Außerdem verbindet das Arkon und den Terrablock.«
»Und unsere Verluste?«, wollte Diethar wissen.
»Sie werden fürstlich entlohnt werden. Jeder von Ihnen wird einen eigenen Planeten bekommen, wenn die Zeit dazu reif ist. All Ihre Wünsche werden erfüllt«, erklärte Despair, der sich erstmals zu Wort meldete.
Die Gier stand in den Augen der sechs Männer. Doch Despair war mit seiner Rede noch nicht fertig.
»Sie müssen allerdings verstehen, dass dies eine endgültige Entscheidung ist. Wir haben Sie ausgewählt, weil sie rücksichtslos, machthungrig und skrupellos sind. Deshalb werden Sie so agieren, wie wir es befehlen. Ich bin überzeugt, dass Sie Ihre Aufgaben bewältigen können. Sie werden teilhaben an einem neuen Cartwheel. Verraten Sie uns jedoch, wird es Ihr Tod sein!«
Die sechs blickten sich ängstlich an. Der Marquês musterte jeden genau. Er selbst war von ihnen überzeugt. Er brauchte jetzt Handlanger, die ihren Job mit Freude und Eifer erledigten. Diesen Eifer würden sie in Anbetracht auf die Vergütung aufbringen.
Alle sechs waren in der Tat skrupellos und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Sie würden für Geld alles tun. Und genau diese Sorte von Menschen brauchte der Marquês. Doch sie hatten noch ein anderes Talent. Sie konnten sich gut als sympathische Bürger verkaufen. Jeder von ihnen trug eine Maske der Unschuld. Jeder von ihnen war ein Wolf im Schafspelz.
»Nun, meine Herren. Sind wir uns einig?«, wollte der Marquês wissen.
»Nein!«, sprach Ian.
Die anderen sahen ihn verwundert an.
»Warum bekommen wir BOHMAR INC.? Welchen Vorteil hat das für Sie, Marquês?«
Der Spanier lachte laut. »Sie sind nicht dumm, Ian. Ihr Bruder sollte sich eine Scheibe von Ihnen abschneiden. Wir brauchen BOHMAR INC. als wichtige Produktionsstätte unserer Waffen. Es gibt viele Projekte, die wir realisieren wollen. BOHMAR INC. soll uns dabei helfen, ohne Fragen zu stellen.«
Ian verstand sehr gut. Er nickte schwach und signalisierte damit seine Zustimmung. Auch die anderen waren voll und ganz zufrieden. Jeder war ein noch mächtigerer Mann als zuvor und stand unter dem Schutz des Terrablocks.
Niemand fragte sich, warum diese Änderungen vorgenommen wurden. Warum der so liberale Marquês auf sie zurückgriff und anscheinend illegale Dinge plante? Es war ihnen egal. Hauptsache, es war zu ihrem Vorteil!
»Gut, Señores! Diabolo erwartet Sie im Nebenraum. Er wird Sie in Ihre neuen Arbeiten einweisen. Auf gute Zusammenarbeit!«
Die neuen Minister verließen den Raum. Nur die beiden Gheddys blieben sitzen. Charly legte seine Beine auf den Tisch und grinste frivol.
»Was gibt es noch?«, fragte der Marquês genervt.
»Es geht da noch um unser Geheimnis«, deutete Charly an. Ian war nicht wohl zumute. Sein Bruder pokerte sehr hoch.
»So. Reicht mein Entgegenkommen denn nicht aus?«, fragte der Marquês ungerührt.
Charly schüttelte den Kopf. »Das ist mir zu unsicher. Wie wir schon sagten, wir wollen mehr. Ich möchte immer noch, dass Sie meine Mutter heiraten. Dann sind wir eine große und glückliche Familie, und das Geheimnis wird niemals zur Öffentlichkeit vordringen.«
»Sind Sie schwachsinnig? Diese alte Schachtel würde ja nicht einmal mehr ein Toter ehelichen!«
Despair wurde ungeduldig. Er zog das Carit-Schwert und legte es Charly an den Kehlkopf. Diesmal reagierte Ian blitzschnell, zog ein Vibratormesser aus seinem Ärmel und presste es dem Marquês an die Brust.
»Ein Unentschieden würde ich sagen«, meinte Ian ruhig.
Despair steckte das Schwert wieder in seinen Halfter und auch Ian bedrohte den Marquês nicht mehr.
Alle sahen sich stumm an. Dann sagte Charly wieder gefasst: »Wenn Sie unsere Mutter heiraten, sind wir in der regierenden Familie. Mehr wollen wir nicht. Wir können sehr gut harmonieren, Daddy!«
Charly grinste.
Der Marquês starrte ihn dunkel an. »Was hindert mich daran, euch beide sofort zu töten?«
»Ganz einfach. Wenn ich tot bin, wird ein dritter die Informationen, die ich in den Ruinen der Shorne-Fabrik gefunden habe, sofort an INSELNET und alle anderen Sender geben. Dann kommt das Geheimnis heraus, dass Ihre Kinder Klone sind, Freaks!«
Despair wandte sich an den Marquês. »Das ist Ihr privates Problem, Don Philippe. Regeln Sie das selber. Aber tun Sie nichts, was Ihre Position gefährden würde.«
Dann verließ der Silberne den Raum. Zurück blieben der Marquês und die Gheddys.
Der Spanier starrte eine Weile vor sich hin, dann fasste er einen Entschluss, der ihm sehr weh tat.
»Also gut. Im Moment habe ich keine andere Wahl. Ich heirate die Schachtel und ihr werdet meine Stiefsöhne. Aber wenn das vollzogen ist, möchte ich alle Beweise haben!«
»Einverstanden.«
Wütend stand der Marquês auf und verließ den Raum.
Charly grinste zufrieden. Ian war weniger gut gelaunt.
»Du setzt alles aufs Spiel, Brüderchen.«
»Ach was! Wenn er erst einmal Mutter geheiratet hat, wird er sterben. Und dann werden wir herrschen! Wir sind Könige!«
*
Noch am selben Tag wurden die neuen Minister vorgestellt. Der Marquês konnte seine Regierungsfraktion zu einer Mehrheit überzeugen. Es gab zwar einige Abweichler, doch da seine Fraktion mehr als 60 Prozent des Parlaments bildete, waren ein paar Ausfälle leicht zu verkraften.
Ebenfalls bekamen Orly und Peter wichtige Posten im Militär. Peter III. wurde Kommandant der neuen Leibwache des Marquês. Nach den Anschlägen von Rijon, dem Supermutanten, hatte sich der Spanier dazu entschlossen, dass IMPERIUM ALPHA von einer Eliteeinheit bewacht werden sollte. Peter de la Siniestro sollte das Oberkommando darüber haben. Schon sehr schnell wurden Oxtorner, Ertruser, Epsaler und sehr hartgesottene Terraner ausgesucht.
Orlando wurde in den Stab versetzt. Nach erfolgreicher Beendigung seiner Ausbildung sollte es sein Ziel sein, Oberbefehlshaber des Stabes zu werden. Cauthon Despair wurde offiziell zum stellvertretenden Terramarschall ernannt und war somit Oberbefehlshaber der Flotte.
Joak Cascal rannte wütend in das Büro des Marquês von Siniestro. Anstelle seiner Sekretärin begrüßten ihn zwei grimmige Ertruser. An ihren Gürtel hingen schwere Desintegratoren und Thermostrahler. Der eine von ihnen blickte Cascal finster an.
Der Terramarschall würdigte ihn keines Blickes und ging in das Büro des Marquês, der, genüsslich in seinem antiken Sessel lümmelnd, auf die Skyline von New Terrania blickte.
»Was soll dieser Mist?«, brüllte Cascal ungehalten. Er stellte sich breitbeinig vor den pompösen Schreibtisch des Staatsoberhauptes und verschränkte die Arme vor den Bauch.
Als hätte er alle Zeit der Welt, wandte sich der alte Spanier, der unsterbliche Spanier, dem Terramarschall zu. »Lieber Cascal, es waren notwendige Änderungen des Kabinetts. Sie wissen, dass wir den anderen Ministern auf Grund ihrer Fauxpas nicht mehr vertrauen konnten.«
Cascal lachte bitter. »Sicher. Doch wer sagt uns, dass wir diesen... diesen Subjekten vertrauen können?«
Der Marquês kratzte sich am Hinterkopf. Dann lächelte er milde, fast schon gönnerhaft, wie Cascal fand, und wiegelte ab. »Ich kenne Niesewitz, Roehk und Katschmarek seit langer Zeit. Man kann ihnen vertrauen. Alle neuen Minister sind vertrauenswürdig. Das Parlament hat meine Entscheidung akzeptiert. Tun Sie es auch!«
Die letzten Worte des Marquês klangen mehr wie ein Befehl als wie ein Ratschlag. Joak Cascal, der Veteran des Solaren Imperiums, warf dem Spanier einen unfreundlichen Blick zu, drehte sich um und verließ wortlos das Büro.
Der Marquês wippte in seinem Sessel und bedauerte die Uneinsichtigkeit von Joak Cascal, doch der Terramarschall war ersetzbar. Sehr leicht ersetzbar...
Die Ungestörtheit des Marquês von Siniestro hielt nicht lange an. Schon wenige Minuten, nachdem Joak Cascal den Raum verlassen hatte, betraten Charly und Ian Gheddy das großräumige Büro des Terra-Administrators.
Das Gesicht des Marquês verzog sich zu einer leidvollen Grimasse. Am liebsten hätte er diese beiden Störenfriede umgelegt, doch er musste sich an die Gesetze halten. Außerdem war die Gefahr viel zu groß, dass mit Hilfe eines Vertrauten der beiden Gheddy-Brüder die Informationen über die wahre Herkunft seiner Kinder an die Öffentlichkeit geraten würden. Dann stand er als Lügner da und seine Kinder als genetische Freaks. Beides wollte er nicht, denn es konnte sein politisches und gesellschaftliches Ende bedeuten.
Deshalb hatte er schon längst die Entscheidung getroffen. Er musste Dorys Gheddy heiraten. Diabolo hatte ihm ebenfalls dazu geraten. So hatte der Marquês eine Frau, die er der Gesellschaft präsentieren konnte. Zweifelsohne waren Männer mit einer intakten Familie noch weitaus mehr angesehen bei dem Volk. Wobei eine Steigerung des Ansehens beim Marquês von Siniestro kaum mehr möglich war, nachdem ihm von »ES« der Zellaktivator verliehen worden war.
Stephanie de la Siniestro, die ebenso hübsche wie intelligente Tochter des Spaniers, sprach vom »Vater der Menschheit«. Der Marquês war inzwischen der beliebteste Mann in Cartwheel.
All das sollte nicht durch einen unüberlegten Zug enden. Vorerst musste er das Spiel mitspielen und sie heiraten.
»Also, Jungs. Ich werde eure Mutter heiraten. Doch als Hochzeitsgeschenk von euch wünsche ich mir alle Beweise. Auch die Kopien. Ihr habt dann, was ihr wolltet. BOHMAR INC., einen großen Namen und den gesellschaftlichen Rang meiner Stiefsöhne. Tür und Tor stehen euch dann offen«, erklärte de la Siniestro mit belegter Stimme. Noch immer ärgerte ihn die Tatsache, dass er erpresst wurde und nichts dagegen tun konnte.
Charly grinste über beide Wangen. »Alles klar, Papi. Wann steigt die Verlobungsfeier?«
»Bald werde ich meine Verlobung mit der entzückenden Dorys verkünden. Ich nehme an, eure Mutter weiß Bescheid?«
»Natürlich. Sie freut sich schon auf die Hochzeitsnacht«, erwiderte Charly amüsiert.
Don Philippe erschauderte, als er an die abstoßende Hässlichkeit von Dorys Gheddy denken musste.
Es ist nicht auf Dauer, du bist unsterblich!, ermahnte er sich selbst.
17. Eine rauschende Feier
Das Schloss des Marquês de la Siniestro auf dem gleichnamigen Nachbarplaneten von Mankind erstrahlte an diesem 04. November in neuem Glanz. Über vierhundert geladene Gäste nahmen an dem vielleicht größten gesellschaftlichen Ereignis neben der ersten Insel-Olympiade auf Paxus teil.
Es war außerdem die Einweihung des neuen Sitzes des Spaniers. Das neue Schloss war eine perfekte Kopie des Palacio Real in Madrid. Dort hatten einst die Könige und Königinnen Spaniens residiert. De la Siniestro hatte dieses Schloss mit Bedacht gewählt. Es war 1764 fertig gestellt worden – vier Jahre nach seiner Geburt und als junger Adliger und später als gesetzter und alter Don war er oft in den Räumen des Palastes gewesen.
Das Palacio Real de la Siniestro war ein Stück Heimat und Geschichte für den Spanier.
Das riesige Schloss, pompös, luxuriös und im zeitgenössischen Stil des 18. Jahrhunderts eingerichtet, bot ausreichend Platz für die Politiker, Unternehmer, Offiziere, Entertainer und Künstler der Insel Cartwheel.
Diabolo hatte das gesamte Programm von der Auswahl der Getränke, der Gänge beim Essen, den Hostessen bis hin zu den Animateuren organisiert. Stephanie de la Siniestro hatte den Posbi kreativ unterstützt, denn dem syntronisch-positronisch-organischen Rechner fehlte es zweifelsohne an Erfahrungen und dem menschlichen Gefühl für eine Festivität.
Draußen regnete es. Das übliche Wetter zu dieser Jahreszeit auf Siniestro. Dutzende von Robotern schwebten mit kleinen, aufgespannten Prallfeldern über den Köpfen der ankommenden Gäste, um den Regen abzuhalten.
Ein weiterer Gleiter erreichte das gigantische Anwesen. Im Gegensatz zu den meisten, wurde der Wagen nicht von einem Chauffeur geflogen, sondern von einem der beiden Gäste selbst. Er schaute beeindruckt das Schloss an und stieß einen Pfiff durch die Zähne.
»Ein gewaltiger Kasten. Der scheint genauso prunksüchtig wie einst Michael Shorne oder Arno Gaton zu sein.«
Seine Begleitung stimmte ihm zu. Der junge Terraner an der Steuerungskonsole des Gleiters wirkte wie Anfang 20, doch sein biologisches Alter betrug bereits 36 Jahre. Seine jugendlichen und unverbrauchten Gesichtszüge täuschten über das Alter hinweg. Er trug eine schwarzweiße Kombination, die schon mehr an einen Kostümball erinnerte. Die antike Fliege war nur noch zu Ereignissen in der High-Society ein ungeschriebenes Gesetz. Doch viele antike Bekleidungsartikel feierten ihr Comeback. Die Krawatte war in den Unternehmerkreisen wieder ein wichtiges Stück zur »Arbeitsuniform«. Die galanten Bekleidungsstücke aus dem 19. bis 22. Jahrhundert alter terranischer Zeitrechnung waren wieder »in«.
Wyll Nordment parkte den Gleiter in der Nähe des riesigen Eingangs.
Ein Bediensteter öffnete die Türen des Gleiters. Eigentlich unnötig, da die Syntronik das selbst machen würde, doch man wollte mit dieser Geste Höflichkeit symbolisieren. Der Mann trug eine europäische Kombination aus dem 18. Jahrhundert. Mit den langen, weißen Kniestrümpfen und der Perücke wirkte er eher lächerlich, doch Rosan verkniff sich ein Grinsen. Sie stieg wortlos aus dem Gleiter aus. Ihr prächtiges, grünes Kleid war sehr körperbetont und reichte bis auf den Boden. Es war mit Edelsteinen und Schwingquarzen verziert, die hell leuchteten.
»Willkommen auf dem Anwesen des Marquês Don Philippe Jaime Alfonso de la Siniestro, dem Administrator des Terrablocks«, sprach der Mann hochtrabend.
Was für ein arroganter Typ, dachte Rosan. Sie hatte nicht viel übrig für solche Snobs. Ob es nun arkonidische Adlige wie die Orbanashols, verrückte Despoten wie Kerkum oder herablassende Industrielle wie Michael Shorne waren.
Die Eingangshalle war an Luxus und Pomp nicht mehr zu überbieten. Links und rechts gingen steinerne Treppen zu den Festsälen. Die Geländer waren mit Löwenstatuen verziert. Die Decke erinnerte an eine Kathedrale, so gewaltig war sie.
An der Treppe standen einige Gäste, die Smalltalk betrieben. Rosan kannte die wenigsten von ihnen. Wyll ging es nicht besser.
»Rosan, Wyll!«, begrüßte sie eine alte Freundin. Es war Uthe Scorbit. Die Terranerin trug ein langes, schwarzes Kleid. Ihre Haare hatte sie hochgesteckt.
Rosan umarmte freudig ihre alte Freundin und auch Wyll begrüßte sie freundlich.
»Endlich eine bekannte Person in dieser Stadt«, bemerkte er und schaute sich voller Unbehagen um.
»Ja, ein ganz schöner Palast. Vorher lebte der Spanier eher bescheiden, doch mit dem Zuwachs in der Familie musste er umziehen und hat ein Stück Heimat nachbauen lassen«, erklärte Uthe. »Ich werde euch beide erst einmal etwas herumführen.«
Rosan und Wyll folgten der Ministerin für Soziales, mit der sie viel Kontakt seit ihrem Besuch in Cartwheel gehabt hatten. Sie führte sie durch ein helles Zimmer, welches durch juwelenbesetzte Kronleuchter beleuchtet wurde. In der Mitte stand eine Art Bank. Sie war rund und im Kern stand ein goldener übergroßer Kerzenständer mit vielen kleinen Figuren. Die Wände wurden von Bildern und Spiegeln verziert.
»Das muss ja Milliarden kosten«, murmelte Rosan.
»Den genauen Preis kennt wohl nur der Marquês selbst«, gestand Uthe und führte die zwei in den Thronsaal, den größten Raum. Er war mit rotem Teppich ausgestattet und diente heute als Hauptfestsaal. Hunderte von Menschen standen dort und unterhielten sich angeregt. Auf einem Podest spielte eine Kapelle klassische Musik aus dem prä-rhodanistischen Zeitalter. Musikstücke von Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, John Williams, James Horner, Johann-Sebastian Bach, Peter Tschaikowsky und vielen anderen symphonischen Berühmtheiten wurden gespielt.
Auf dem Thron selbst saß der Marquês. Der Thron wurde von goldenen Löwen »bewacht«. Rosan wunderte sich über diesen Auftritt des Marquês. Es ähnelte eher einer Party von Bostich I. als von einem terranischen Administrator. Sie versuchte allerdings, das mit der Tatsache zu entschuldigen, dass er aus einer Zeit stammte, wo dieses Gebaren gang und gäbe war.
Nahe dem Thronpodest standen Joak Cascal, sein Militärattaché Henry »Flak« Portland und dessen Frau Rhonda. Jeder von ihnen hielt ein Glas Sekt in der Hand. Der Sekt stammte aus heimatlichem Anbau. Wein, Champagner und Sekt waren in Siniestro von besonderer Güte.
Uthe führte die beiden zu Cascal und den Portlands. Sie wurden herzlich von den Soldaten des Terrablocks begrüßt. Rhonda machte auf Rosan einen seltsamen Eindruck. Sie schien etwas zu wanken, was sie aber nicht davon abhielt, ein Glas nach dem anderen zu trinken.
»Rhonda, trink doch nicht so viel«, ermahnte sie der steife Portland.
»Ach, das bisschen, Schatz. Lass mir doch auch etwas Spaß. Ich werde mich mal mit der Braut unterhalten. Sie schätzt den guten Wein genauso wie ich, Darling«, lallte Rhonda Portland und zog von dannen.
Rosan lächelte verlegen, als sie seine Blicke spürte.
»Nun, was sagen Sie als Besucher zu den politischen Veränderungen im Terrablock?«, wollte nun der Kommodore wissen.
Rosan nahm ein Glas Vurguzz-Likör. Es gab auch diverse leichtere Versionen des grünen Alkoholgetränkes, da das Original mehr für harte Raumfahrer oder permanente Alkoholiker geeignet war als für Gäste eines Balls.
»Ich kenne die neuen Minister leider nicht, wenn Sie das meinen. Allerdings sollen sie wohl Verwandte der Braunhauers sein und die fand ich etwas seltsam. Aber das sagt nichts über die politische Befähigung aus. Die Zukunft wird es zeigen. Geben Sie ihnen eine Bewährungsprobe.«
Der Soldat musste lachen. Die intelligente Halbarkonidin faszinierte den kantigen Kommodore. Er kannte Rosan schon, als sie noch ein kleines Kind war. Damals war sie zusammen mit dem damals noch unschuldigen Jungen Cauthon Despair auf Mashratan entführt worden. Das musste 1275 NGZ gewesen. Es war schon 23 Jahre her.
»Mykke, Niesewitz, Katschmarek, Roehk. So etwas hätte es zu Zeiten Perry Rhodans nicht gegeben«, knurrte Cascal und bestellte sich die harte Version des Vurguzz.
Rosan legte ihre Hand auf seinen Arm. »Alter Freund, du bist immer noch so misstrauisch wie früher. Doch ich denke, dass man ihnen eine Chance geben sollte. Wenn sie etwas falsch machen, kann man sie immer noch ihres Postens entheben.«
»Wenn es dafür nicht zu spät ist«, meinte Cascal.
Rosan und Wyll sahen sich weiter um. Uthe führte sie zu einem Tisch, an dem eine ganze Menge Leute saßen. Zum einen ihr Mann Remus, ihr Schwager Jan und deren Freunde Mathew Wallace, Jonathan Andrews, Lorif und Irwan Dove.
Unweit davon hatte sich eine illustre Runde gebildet. Die neuen Minister Diethar Mykke, Reinhard Katschmarek, Peter Roehk und Werner Niesewitz versuchten anscheinend die Verhältnisse zu Arkon zu verbessern, denn sie saßen mit Uwahn Jenmuhs, Mascant Terz von Eskor und Thek'Athor Toran Ebur an einem Tisch.
Peter de la Siniestro gesellte sich mit einigen Getränken zu ihnen. Er vollführte einen militärischen Gruß und setzte sich neben Jenmuhs.
Rosan wollte gar nicht hören, was sie zu bereden hatten. Es war ihr egal. Doch allein der Anblick des Zwillingsbruders von Hajun Jenmuhs ließ ihr einen kalten Schauer über den Rücken laufen.
Auf jeden Fall wollte sie ein Aufeinandertreffen vermeiden. Sie setzte sich neben Jonathan Andrews, der sie freundlich anlächelte. Wyll bemerkte ein Funkeln in seinen Augen und räusperte sich.
»Du kannst auch gerne Platz nehmen, Wyll«, bot ihm Andrews an. Der Terraner folgte dem Angebot und nahm neben seiner Frau Platz.
»Was für eine langweilige Party«, seufzte Mathew Wallace genervt. Irwan Dove musste herzlich lachen.
»Ich werde mir erst einmal noch ein Bier holen«, verkündete Jan Scorbit und erhob sich von seinem Platz. Zielstrebig ging er auf die nächste Bar zu.
»Schon wieder?«, bemerkte Andrews.
»Er kann es nicht lassen«, erklärte Mathew.
Andrews lehnte sich weit mit dem Stuhl zurück und wippte hin und her. Sicherlich war das nicht nach der Etikette des Gastgebers, doch das war Andrews relativ egal. Ihm fiel eine bezaubernde Gestalt unweit von ihm entfernt auf. Sie war sehr zierlich gebaut, hatte lange, leicht gewellte Haare und eine atemberaubende Figur.
»Wer ist das?«, wollte er wissen und deutete auf die Schönheit. Dabei bemerkte er nicht, wie sich jemand von hinten näherte.
»Das ist«, sagte die Person hinter ihm und ließ Jonathan hochschrecken, »meine Nichte Nataly.«
Andrews stand auf und lächelte verstohlen. Er räusperte sich und fühlte sich irgendwie ertappt, etwas Unrechtes getan zu haben. Zumindest hatte er dieses Gefühl.
»Oh, Mister Jargon. Danke für den Hinweis. Ich habe Sie gar nicht kommen hören«, stammelte der Offizier der Terranischen Ligaarmee.
Jaarons gütiges Lächeln verlieh Andrews etwas mehr Sicherheit. Der Chronist der Insel war ein ausgesprochen gutherziger Linguide. Er hatte deutlich bemerkt, dass Andrews ein Auge auf seine Nichte Nataly geworfen hatte. Und er schätzte den ehemaligen Ritter der Tiefe Orbiter als einen Menschen ein, der Nataly nicht verletzen würde.
»Nun, meine Nichte macht einen gelangweilten Eindruck. Vielleicht sollten Sie sie etwas unterhalten?«, schlug Jaaron schmunzelnd vor.
Andrews stellte seinen Drink auf den Tisch und nickte dem Chronisten zu. Dann zog er seine Uniform zurecht und ging auf die Halblinguidin zu.
»Miss Jargon?«
Nataly drehte sich um und blickte Andrews fragend an. Ein Blick, der Andrews jeglichen Mut nahm und sein Herz in die Hose rutschen ließ. Was für eine Frau!
»Ja, Mister Andrews?«
»Sie kennen mich?«
Nataly lächelte. Ihre blauen Augen funkelten geheimnisvoll.
»Wer tut das nicht? Sie sind ein Held hier in Cartwheel. Außerdem befasst sich mein Onkel mit der Chronik der Galaxis. Auch Sie sind darin verewigt.«
Andrews fasste wieder etwas Mut. »Nun, das ehrt mich. Mir ist aufgefallen, dass Sie einen gelangweilten Eindruck machen. Vielleicht dürfte ich Ihnen etwas Gesellschaft leisten?«
Nataly schwieg und blickte sich im großen Thronsaal um. Andrews stand neben ihr und fragte sich, warum sie nicht antworten würde. Trieb sie ein Spiel mit ihm? Langsam kam er sich schon etwas blöde vor.
Schließlich musste Nataly loslachen. Sie nahm Andrews' Arm und lehnte sich kichernd an seine Schulter.
Andrews war sprachlos. Erst so abweisend, nun so herzlich. Was bezweckte sie damit? Was war ihre wirkliche Seite?
»Sie leisten mir doch schon lange Gesellschaft? Vielleicht können wir uns auch duzen, das ist doch eigentlich so üblich?«
»Gerne, Nataly.«
»Dann gehen wir mal etwas durch die Hallen und schauen uns an, welche Honoratioren von Cartwheel hier versammelt sind und wie daneben sie sich benehmen, Jonathan.«
Jonathan folgte der Schönheit. Sie gefiel ihm von Minute zu Minute besser. Nataly war ein sehr erfrischender Mensch, die es gut verstand, ein Lächeln auf die Lippen von Jonathan Andrews zu zaubern. Lange hatte er nicht mehr dieses Gefühl gehabt. Es waren Schmetterlinge im Bauch. Seit dem Tod von Jezzica Tazum hatte er keine Frau mehr geliebt. Der Verlust von Aurec, Gal'Arn und Jezzica hatte ihn zu sehr mitgenommen. Die Ausbildung bei Redhorse Point diente als Ablenkung. Immerhin hatte er es dadurch geschafft, die Ereignisse auf Xamour einigermaßen zu verkraften. Vielleicht nahm jetzt alles eine positive Wende.
*
»Meine Herren, das Problem ist doch ganz einfach!« ereiferte sich Reinhard Katschmarek und gestikulierte dabei wild mit den Armen. Dabei verschüttete er einiges an Bier.
Toran Ebur sah den Terraner abfällig an. Für ihn war er nur Abschaum. Bras'cooi.
Uwahn Jenmuhs saß kichernd in seinem breiten Stuhl und lauschte den Ausführungen der neuen terranischen Freunde.
»Reden Sie weiter, guter Freund.«
»Das Problem liegt nicht bei Arkoniden und Terranern. Mensch, wir sind doch alle Brüder. Egal ob Arkonide, Terraner, Akone, Ara oder Springer. Nein, die Wurzel allen Übels liegt in den Außerirdischen. Blues, die schnackseln wie die Karnickel! Wo soll denn das noch enden? Die überfluten alles hier. Die... die Topsider, Somer und Thoregonvölker... die gehören alle nicht hier her. Weg damit! Cartwheel den Menschen. Dann geht es uns gut!«
Uwahn Jenmuhs applaudierte. Katschmarek grinste und nahm einen kräftigen Schluck vom Bier.
»Verzeihung Sirs, aber wie könnten wir diesem Problem beikommen?«, fragte ein anderer. Er war neu in der Runde. Seine dekorierte Uniform wies ihn als einen Oberleutnant der Terranischen Armee aus.
»Ah, Oberleutnant Benington! Schön Sie zu sehen«, begrüßte ihn Peter. Der Sohn des Marquês stellte allen Beteiligten den Oberleutnant vor. Er war es, der Benington auch prompt befördert hatte und ihm in Aussicht stellte, bald den Rang eines Oberst inne zu haben. Benington und Peter verstanden sich blendend.
Katschmarek rülpste laut.
»Wir müssen die Sicherheit im Terrablock erhöhen. Wir sollten arkonidische Verhältnisse schaffen«, meinte Niesewitz, der neue Innenminister und somit auch Beauftragter für die innere Sicherheit.
»Eine gute Idee«, lobte Jenmuhs.
»Um Kosten zu sparen, könnten wir Renten- und Sozialversicherungen für Extraterrestrier streichen«, schlug Diethar Mykke vor. Ein lautes Lachen erklang. Mit Beifall begrüßten sie diesen Vorschlag.
»Ich wäre eher für einen großen Militärschlag! Arkonidische und Terranische Streitkräfte vereint. Gemeinsam könnten wir ganz Cartwheel unterwerfen!« Benington redete wie ein Agitator. Er ereiferte sich an seinen Worten und wurde sehr lautstark. Zu laut, denn andere bekamen die letzten Worte mit.
Einige Delegierte der Blues und Somer wandten sich beschämt ab. Benington fühlte sich ertappt. Keiner der anderen sagte mehr etwas. Plötzlich stand Uwahn Jenmuhs auf und blickte verächtlich zum gegenüberliegenden Tisch.
»Mörderin!«, schrie er durch den ganzen Raum. Er lief hastig zum anderen Tisch. Seine Fettmassen schwappten bei jedem Schritt von oben nach unten. Jenmuhs machte den Eindruck eines laufenden Wackelpuddings.
Rosan blickte ihn entgeistert an. Schnell merkte sie jedoch, was der dickwanstige Arkonide vorhatte.
»Mörderin«, wiederholte Jenmuhs, damit auch jeder im Saal es mitbekam. Dann stand er mit bebendem Körper vor der Halbarkonidin mit dem Generationennamen Orbanashol.
»Ich glaube, diese Bezeichnung trifft eher auf Ihren Bruder zu«, entgegnete Rosan kühl.
Jenmuhs grunzte wütend. Er fletschte seine Zähne und Speichel rann aus seinen Mundwinkeln. Mit seinem fauligen Atem hauchte er Rosan an. »Mein Bruder war ein Ehrenmann. Nicht so eine Zayna, wie Sie es sind!«
Rosan musste sich zusammenreißen. Jenmuhs wollte sie provozieren. Zayna war im Arkonidischen ein sehr abwertender Begriff für Krüppel, Behinderte, Minderwertige.
»Essoya Jenmuhs«, erwiderte Rosan beherrscht und verletzte damit Jenmuhs aufs äußerste. Essoya war eine der schlimmsten Beleidigungen, die man einem arkonidischen Aristokraten an den Kopf werfen konnte. Sie bedeutete nämlich nichtadlig. Essoya stammte von der Stinkwurzel Essoya-yonki, die in archaischen Zeiten als Grundnahrungsmittel gedient hatte.
»Ihr Bruder starb auf der LONDON II und wurde Opfer seiner eigenen Perversionen. Sie sollten Buße für seine Verbrechen tun.«
Jenmuhs lachte schrill auf. »Ich und Buße? Du elende Schlampe! Terranische Schlampe. Selbst die Bezeichnung Essoya ist noch zu gut für dich«, ereiferte sich Jenmuhs.
Toran Ebur und Mascant Terz von Eskor merkten deutlich, wie sich die Stimmung verschlechterte.
Nun trat Wyll Nordment auf den Plan. Er stellte sich vor Jenmuhs. »Lassen Sie meine Frau in Ruhe. Ich erwarte eine Entschuldigung!«
Jenmuhs lachte erneut. Wie konnte es dieser Mensch dritter Klasse wagen ihn überhaupt anzusprechen? Er beachtete ihn einfach nicht. »Die Luft ist voll Gestank. Kann jemand den Kero vor meinen Augen entfernen?«
Nordment wusste von Rosan, was Kero bedeutete. Es war so viel wie Unrat, Müll. Wütend packte er Jenmuhs, doch in dem Moment, spürte er eine Hand an seiner Schulter. Schmerzhaft zog sie ihn weg.
Cauthon Despair hatte die Auseinandersetzung gestoppt. Der Silberne Ritter wirkte Furcht einflößend auf alle Beteiligten. »Es wird Zeit, dass sich alle Gäste benehmen. Das gilt für arkonidische als auch terranische. Warten wir lieber auf die offizielle Verkündung des Marquês«, sprach der Ritter dunkel.
Niemand wagte es, ihm zu widersprechen. Schnaufend trabte Jenmuhs wieder zu seinem Platz und versuchte, so gut es ging, die Präsenz von Rosan und Wyll zu ignorieren. Wyll wurde von Rosan beruhigt.
»So erreichst du nichts«, erklärte sie.
»Dieser Jenmuhs steckt hinter dem Anschlag. Da bin ich mir sicher. Ich werde mich mal etwas im Schloss umsehen und seine Suite durchsuchen.«
Bevor sich Wyll auf den Weg machen konnte, hielt ihn Rosan fest. »Sei vorsichtig.«
Wyll lächelte und gab ihr einen Kuss. Rosan fühlte, dass er sich in eine gefährliche Lage brachte. Sie hatte Angst um Wyll.
»Ich liebe dich«, hauchte sie in sein Ohr. Noch einmal küssten sie sich innig, dann verließ er sie und den Festsaal.
Eine hochtrabende Fanfare erklang und der Marquês von Siniestro und seine zukünftige Frau Dorys Gheddy betraten den Raum unter dem Applaus der Gäste. Stephanie und Brettany standen mit einigen Gästen zusammen und musterten abfällig ihre zukünftige Stiefmutter. Auch wenn sich die Schwestern sonst nie einig waren, so wussten beide, dass Dorys Gheddy die absolute Fehlbesetzung war. Doch sie ahnten auch nicht, warum der Marquês sie heiraten musste.
Dorys trug ein edles Gewand. Edelsteine, Gold und Howalgonium glitzerten auf dem roten Stoff. Doch der Rest der Erscheinung glich eher einer Figur aus einer Geisterbahn. Die faltige Haut von Dorys hing herunter, das viele Make-up konnte die absolute Hässlichkeit der Frau auch nicht verbergen. Ihr von Falten übersätes Gesicht und ihr giftiger Blick passten ganz und gar nicht zu dem wundervollen Kleid.
Sie ließ sich feiern wie eine Diva, winkte den Leuten zu und badete in dem Jubel. Dem Marquês wurde das sichtlich peinlich. Er zog Dorys zu sich.
»Was soll das, du blöder Penner?«, herrschte sie ihn an.
»Benimm dich!«, flüsterte er barsch zurück.
Dorys schwieg. Eine Tugend, die sie nur sehr selten zu Tage legte. Sie war nun einmal keine Lady, sondern eine sehr, sehr einfache Frau. Obendrein versoffen und ordinär.
»Ist unsere Mutter nicht schön?«, fragte Charly seine beiden baldigen Stiefschwestern.
Brettany lächelte ihn an. »Na ja, die Schönheit kommt vermutlich von innen«, sagte sie diplomatisch.
»Da ist auch nichts«, schimpfte Stephanie. »Sie ist so hässlich wie eine ausgewickelte, fünftausend Jahre alte Mumie, Schwesterherz. Ich verstehe nicht, was Vater an ihr findet. Diese Frau ist eine einzige Katastrophe!«
Charly sah sie vorwurfsvoll an. Er spielte den Gekränkten, doch Stephanie de la Siniestro war das egal.
»Ich muss mich vergnügen, sonst wird mir noch schlecht«, meckerte sie und zog davon.
Brettany blickte ihr verständnislos hinterher.
»Ich muss mich für sie entschuldigen«
»Nicht nötig«, meinte Charly.
Er nahm zwei Gläser Champagner und stieß mit Brettany an. »Auf eine glückliche, große Familie.«
*
Stephanie konnte es einfach nicht fassen, wie ihr Vater so dumm sein konnte und tatsächlich die Absicht hatte, diese alte Wachtel zu heiraten.
Sie hat es doch nur auf sein Vermögen abgesehen, dachte die junge de la Siniestro.
Damit hatte sie auch Recht, doch das wusste zu dem Zeitpunkt natürlich kaum einer. Irgendetwas musste sie tun. Wenn nicht sie, wer dann? Sie suchte ihre anderen Geschwister. Peter stand mit dem in ihren Augen sehr attraktiven Alcanar Benington zusammen und diskutierte über die militärischen Glanzstücke von Napoleon. Benington fiel auf, dass sie von Stephanie beobachtet wurden. Er lächelte ihr zu und die hübsche de la Siniestro schenkte auch dem Oberleutnant ein Lächeln.
Den hebe ich mir für später auf.
Sie ging weiter durch die festlichen Hallen. Orly stand mit Cascal, Portland, Scorbit und Andrews zusammen. Natürlich sprachen sie über die politische Lage und das Militär. Sie diskutierten angeregt, welche Verbesserung man in diesen Punkten machen konnte.
Müssen die sich immer nur darum Gedanken machen, wie man das Leben von anderen verbessert? Was ist mit meinem?
Jetzt fiel ihr Augenmerk auf Ian Gheddy. Er stand mit ihr unbekannten Leuten an einem Tisch und starrte ständig auf die Terranerin mit dem großen Dekolleté. Der Mann neben der kleinen Blondine sah sehr attraktiv aus.
Vielleicht waren es Freunde von Ian. Sicher war es gut, mehr über die Gheddys herauszufinden.
»Guten Tag, ich hoffe, Sie amüsieren sich auf unserer Party«, begrüßte sie die beiden Unbekannten. Sie stellten sich vor. Es waren Anya Guuze und Krizan Bulrich.
»Sind Sie Freunde von Ian?«, fragte sie gespielt interessiert.
»Nun, wir haben ihn und seinen Bruder in einem Nachtclub kennen gelernt«, erklärte Krizan Bulrich.
Stephanie bemerkte seine gierenden Blicke. Der Mann war gut gebaut und würde als Zeitvertreib sicherlich nicht schlecht sein. Doch seine Freundin stand im Weg. Sie war sehr attraktiv, doch für Krizan Bulrich anscheinend nicht genug.
»Und was arbeiten Sie?«, wollte Stephanie wissen.
»Wir sind Kadetten in der Armee des Terrablocks«, erklärte Anya.
Was für eine furchtbare Piepsstimme, dachte Stephanie.
»Ach ja? Dann kennen Sie sicher meinen Bruder Orlando. Er ist auf der Militärakademie von Redhorse Point.«
Krizan räusperte sich. Stephanie sah ihn fragend, ja schon auffordernd an, eine Erklärung zu geben.
»Nun, ich war da auch einmal, doch wurde ich entlassen. Weil sie mit meinen Ansichten nicht einverstanden waren. Alles elende Spießer. Ich bin zu Höherem geboren, als nur ihre Stiefel zu lecken.«
»Ich verstehe. Vielleicht sollten wir uns einmal unter vier Augen über Ihre beruflichen Perspektiven unterhalten«, schlug Stephanie zweideutig vor.
In dem Moment kam eine weitere Frau zu ihnen. Es war Sylke Stabum. Sie war betrunken und stand unter Drogen. Stephanie bemerkte das.
»Lass uns tanzen«, lallte Sylke und zog Anya mit. In diesem Falle war sie zur rechten Zeit gekommen.
Stephanie nahm Krizan bei der Hand. »Entschuldige uns, Ian.«
Beide gingen in einen privaten Raum, wo sie sich hemmungslos ihrer Lust hingaben.
*
Die Diskussion über Rassenvorurteile dauerte noch an. Lautstark prahlten Niesewitz, Katschmarek, Roehk, Peter de la Siniestro und Uwahn Jenmuhs über die Stärke der Arkoniden und über die Minderbegabung aller Extraterrestrier.
Jonathan Andrews und Nataly Jargon beobachteten angewidert diese Diskussion.
»Diese Menschen machen mich krank«, gestand sie.
»Ja, mich auch. Eigentlich sind es Witzfiguren, doch sehr mächtige Witzfiguren.«
Jaaron Jargon kam vorbei und gesellte sich zu seiner Nichte und Andrews. Verdrossen beobachtete auch er die illustre Runde.
»Das kann ich mir nicht mehr anhören«, brummte er und ging zum Tisch.
Nataly sah entsetzt hinterher. Sie lief sofort ihrem Onkel nach.
»Meine Herren«, wandte er sich an die Leute am Tisch. »Was Sie von sich geben, ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Jedes Lebewesen ist gleich. Ob Terraner, Arkonide, Blues, Topsider oder Vennok. Sie haben nicht das Recht, Ihre Volksverhetzungen in aller Öffentlichkeit kund zu tun. Sie diskriminieren Ihre außerirdischen Freunde.«
Katschmarek und Niesewitz lachten los.
»Hört euch doch mal den Alten da an!«, prustete Katschmarek.
Peter lachte schallend mit. Er hatte, wie die anderen auch, schon sehr viel getrunken. Er richtete seine Uniform zurecht und stellte sich provokativ vor Jaaron Jargon. Der Chronist machte allerdings keinen ängstlichen Eindruck.
»Alter Mann, kein bescheuerter Blue oder kein behinderter Kartanin kann militärisch mit den prächtigen Flotten der Menschen mithalten. Wir haben die zackigsten Märsche, die besten Paraden, die härtesten Soldaten, die modernsten und größten Raumschiffe! Was haben diese Unterwesen? Nichts!« Die letzten Worte waren gebrüllt.
Nataly wandte sich zu Peter. »Lassen Sie meinen Onkel in Ruhe und werden Sie erst einmal grün hinter den Ohren.«
Während Peter noch nach Worten rang, grabschte Peter Roehk nach dem Gesäß von Nataly. Er packte sie und zog sie auf seinen Schoß.
»Loslassen«, forderte sie barsch.
»Mir gefallen solche störrischen Frauen«, bemerkte Roehk und grinste über beide Wangen.
Im nächsten Moment traf ihn die Faust von Jonathan Andrews. Nataly sprang auf und versteckte sich hinter Jonathan.
Peter rief die Wachen und Peter Roehk schrie laut um Hilfe. Cauthon Despair und Alcanar Benington kamen als erste zu dem Ort des Geschehens.
»Hätte ich gewusst, dass diese Veranstaltung in diesem Rahmen abläuft, hätte ich ein paar Dompteure angeheuert.« Der Tonfall des Silbernen Ritter war allerdings alles andere als sarkastisch. Kälte lag in ihm. »Ist mit Ihnen alles in Ordnung, Chronist?«
»Ja, danke. Auch meiner Nichte geht es gut. Dank dem Eingreifen von Mister Andrews. Der Minister für Forschung und Wissenschaft hat seinen Charme wohl etwas überschätzt.« Anklagend blickte er Peter Roehk an.
»Ich bin sicher, der Minister wird sich für sein Verhalten entschuldigen. Doch gleiches wird Andrews tun. Man greift keinen Minister an«, stellte Despair in einem scharfen Ton fest. Dann verließ er den Ort und wandte sich dem Marquês zu.
Die Beteiligten warfen sich noch ein paar böse Blicke zu, dann ging jeder wieder zu seinem Platz. Andrews erkundigte sich, ob Nataly in Ordnung sei. Die Terranerin mit linguidischen Wurzeln war sehr von der Art des ehemaligen Ritterschülers angetan. Die beiden verbrachten den Abend miteinander, um sich besser kennen zu lernen.
*
Anya Guuze war nicht mehr nach tanzen zumute. Sie suchte ihren Freund Krizan, doch der war nirgends zu sehen. Wahrscheinlich war er noch bei Stephanie de la Siniestro. Ein Gefühl von Eifersucht und Unsicherheit machte sich in der jungen Terranerin breit.
Sie ging wieder zu Ian. Der Gheddy wirkte auf sie düster und unheimlich. Sie bemerkte seine Blicke sehr wohl und war sich darüber im Klaren, dass er sie begehrte. Doch er war gänzlich unattraktiv für sie.
Neve Prometh, die in Begleitung von Marvyn Mykke war, gesellte sich zu ihrer ehemaligen Klassenkameradin. Sie begrüßte Anya freundlich und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Marvyn machte auf Anya einen trostlosen Eindruck. Er schien auch unter Drogen zu stehen, wie ihr sein glasiger Blick verriet.
»Sie mal einer an, meine ehemaligen Mitschüler«, hörten sie eine dröhnende und bedrohliche Stimme. Sie gehörte Nor'Citel, dem ehemaligen Siddus. Anya zuckte kurz zusammen. Sie hatte Angst vor dem Pariczaner.
»Siddus«, sagte Anya halblaut.
»Nein, Siddus ist tot«, stellte er nüchtern fest.
»Was wollen Sie, Nor'Citel?«, wollte Neve wissen. Sie misstraute dem Corun von New Paricza gewaltig und hatte Aurecs Besorgnis an jenen Tagen auf der BAMBUS nicht vergessen.
»Zerstreuung, mehr nicht. Diese Feier langweilt mich und ihr Terraner steht doch auf diese banalen Kurzgespräche.«
»Joa...«, machte Marvyn.
Leticron würdigte ihn keines Blickes. »Wie ich sehe, habt ihr es zu nichts gebracht. Ich bin Herrscher aller Pariczaner. Du, Neve, bist Sekretärin und Anya die Hure eines Vollidioten.«
»Was erlaubst du dir?«, meckerte die blonde Terranerin. »Krizan ist ein liebevoller Mensch. Er ist nicht der klügste, aber kann vieles durch seine Talente wett machen.«
Leticron lachte schallend. Es war ein arrogantes und überhebliches Lachen. Er machte den beiden Terranerinnen deutlich, wie weit er über ihnen stand. Sie spürten, dass er auf sie herab sah.
Besonders Anya gefiel diese Einstellung nicht. Sie war es nicht gewöhnt, so herablassend behandelt zu werden. Fast alle Männer himmelten sie an, was ihr eine gewisse Eitelkeit verlieh. Auf der anderen Seite war sie voller Minderwertigkeitskomplexe und Furcht allein zu sein. Die Frau war ein Widerspruch, was sie allerdings gut verstecken konnte.
Ian Gheddy stand teilnahmslos daneben und lauschte dem Gespräch. Von ihm war keine Gefühlsregung zu erwarten.
Cauthon Despair näherte sich der kleinen Gruppe. Leticron wurde auf den Silbernen Ritter aufmerksam.
Anya und Neve fühlten sich alles andere als wohl, als sie von den drei düsteren Riesen umringt waren. Marvyn schien dies alles nicht mehr mitzubekommen. Er wankte von einer Seite zur anderen und starrte ins Leere.
»Nor'Citel, ich bin erfreut, dass Sie der Einladung des Marquês gefolgt sind«, begrüßte Despair seinen Bruder des Chaos gespielt förmlich.
»Es war mir eine Ehre. Ich begegne hier vielen interessanten Wesen. Es ist das reinste Amüsement für mich«, gab der Überschwere zurück.
»Ich führe Sie zum Gastgeber.« Der Silberne Ritter deutete in eine Richtung und Leticron folgte ihm. Er würdigte Anya Guuze und Neve Prometh keines Blickes mehr. Ängstlich blickte Anya ihm hinterher.
»Irgendetwas stimmt mit ihm nicht«, murmelte Neve.
Anya sah sie besorgt an.
»Was?«, fragte Marvyn.
Dann kam Sylke Stabum und wollte wieder tanzen. Da weder Anya noch Neve wollten, nahm sie Marvyn bei der Hand, der nichts dagegen hatte. Neve blickte Anya ernst an. Ihr Gegenüber sah verlegen auf den Boden.
Sie dachte jetzt wieder an ihren Freund Krizan Bulrich. Wo er wohl nur war?
*
Sanft streichelte sie über seine haarlose Brust.
»Ich denke, ich werde dir einen besseren Posten besorgen. Du hast ja deine Kompetenzen bestens unter Beweis gestellt«, erklärte Stephanie de la Siniestro, die sich an Krizan Bulrich angekuschelt hatte.
Beide lagen auf dem Boden des Büroraumes. Halbnackt, denn vor lauter Begierde hatten sie nicht einmal alle ihre Kleider ausgezogen.
Stephanie stand auf und zog sich wieder an. Sie hatte heute noch viel vor. Der Abend war jung.
»Ich spreche mit deinen Vorgesetzten.«
Krizan Bulrich kratzte sich am Hinterkopf. »Das wird wenig nützen. Dieser Benington hatte mich damals aus Redhorse Point entlassen. Der mag mich nicht.«
»Überlasse das mir«, sagte sie lächelnd, richtete ihre Frisur und verließ den Raum.
Stephanie schlenderte durch den großen Thronsaal und suchte Benington. Schnell hatte sie ihn gefunden. Er stand bei Remus Scorbit und Jonathan Andrews.
»Meine Herren, da Sie ja inzwischen so erfolgreich sind, möchte ich, dass Sie mit mir und Oberst Goss auf der LU-TANG eine Übung machen. Ich brauche Vorbilder für die jungen Kadetten«, führte der Oberleutnant voller Zynismus aus.
Andrews und Scorbit sahen sich fragend an. Benington bemerkte mit einem diabolischen Lächeln, dass er die beiden verwirrt hatte. Er drückte ihnen je eine kleine Plastikkarte in die Hand.
»Das ist Ihr Marschbefehl, Sirs! Am 06. November geht es los. Ich erwarte Sie mit Ihrer Ausrüstung um 0:01 Uhr am Raumhafen von Mankind bei der LU-TANG.«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, drehte er sich um und entfernte sich von den beiden, die ihm wie begossene Pudel nachschauten.
»Oberleutnant Benington?«
Verwundert wandte sich der Major an die attraktive Stephanie de la Siniestro, die ihn angesprochen hatte.
»Ich müsste mit ihnen unter vier Augen über einen Kadetten sprechen. Und über die Intensivierung unserer Freundschaft.«
Stephanies Blicke sprachen Bände. Alcanar Benington ließ sich das nicht zweimal sagen. Er folgte Stephanie in das Büro. Auch er wurde ein Opfer ihrer Verführungskünste. Doch ein sehr williges Opfer. Leidenschaftlich gaben sie sich ihrer Lust hin.
*
Anya und Ian standen zusammen. Krizan Bulrich war immer noch nicht aufgetaucht. Ein Gespräch wollte sie allerdings nicht mit ihm führen. Ungeduldig seufzte sie vor sich hin und wartete auf ihren Geliebten.
»Er scheint dich sitzen gelassen zu haben«, meinte der finstere Gheddy zynisch.
Anya blickte ihn böse an. Ihr Blick hielt jedoch dem seinen nicht lange stand. Verlegen blickte sie durch den Saal.
»Ich weiß nicht, wo er ist und was er so lange macht.«
Ian grinste voller Genugtuung. Er bemerkte, dass Guuze keinen glücklichen Eindruck machte und sah darin seine Chance. Er packte sie mehr oder weniger sanft am Arm und streichelte sie. Ein Gefühl der Freude kam in Ian Gheddy hoch, ein Gefühl der Abscheu in Anya Guuze.
»Mein Püppchen, du bist so schön wie ein Püppchen«, flüsterte er leidenschaftlich.
Anya sah ihn entgeistert an und wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie bekam Angst vor ihm, wollte sich aber nicht losreißen, da sie Furcht vor einer Reaktion hatte.
Gheddy beugte seinen Kopf herunter und ging mit seinem Mund ganz nahe an ihr Ohr heran. »Ich habe Macht, mein geliebtes Püppchen. Ich und mein Bruder werden bald die Beherrscher des Terrablocks sein. Wir haben den Marquês in der Hand. Vergiss diesen Krizan. Nimm mich und du wirst in Geld baden.«
Anya wurde hellhörig.
»Das musst du mir näher erklären.«
Ian schwieg. Er nahm etwas Abstand von ihr. Der Terraner war sich bewusst, dass er schon viel zu viel gesagt hatte. Er durfte nichts mehr erzählen, denn das Geheimnis der Klonkinder war ihre Lebensversicherung.
Doch Anya ließ nicht locker. Sie blickte sich um und nahm Ian bei der Hand. Sie gingen aus dem Raum in ein Nebenzimmer, wo sie ungestört waren. Zärtlich streichelte sie mit einem Finger über seine Brust.
Ian schloss die Augen und genoss diesen Augenblick. Es gab nicht viele Frauen, die ihn ohne Androhung von Prügelstrafe streichelten.
»Liebster Ian, wenn ich Krizan verlassen soll, musst du mir schon ein paar gute Gründe nennen«, säuselte Anya berechnend. Sie wusste, dass sie im Moment Ian um den Finger gewickelt hatte.
Ian packte ihre zierlichen Hände und drückte ihren Körper an den seinen.
Während Ian in voller Ekstase war, wurde Anya übel. Sie musste sich beherrschen um das Spiel mit zu spielen.
»Wir sind im Besitz eines Geheimnisses, welches den Marquês politisch und gesellschaftlich erledigen kann. Ihn als Lügner und Gesetzesbrecher darstellt. Es geht um seine Kinder...«
Anya wurde hellhörig. »Und weiter?«
Ian schwieg. Er wusste nicht, ob sie vertrauenswürdig war. »Wenn ich dir das erzähle und du mich verrätst, schlitze ich dir die Kehle auf, mein Püppchen. Ist das klar?«
Anya schluckte. Sie war sich nicht mehr sicher, ob sie das Geheimnis überhaupt hören wollte. Aber vielleicht konnte es sie und Krizan Bulrich weiterbringen.
»Ich werde dich nicht verraten«, versicherte sie ihm.
Ian war überzeugt. Er legte seine Arme um ihre Schulter und drückte sie fest an sich. Dann flüsterte er: »Die Kinder des Marquês sind...«
Er wurde unterbrochen. Die rustikale Holztür knallte zu. Anya schreckte zusammen und Ian zog sofort ein Messer und rannte auf den Störenfried zu, doch dieser zog ein größeres Schwert und schlug Gheddy die Waffe aus der Hand.
Ian wich zurück und erkannte den Mann. Es war Cauthon Despair. Der Silberne Ritter steckte sein Schwert wieder in den Halfter. Am liebsten hätte er Ian Gheddy sofort getötet, doch er befürchtete, dass Charly dann die Informationen der Öffentlichkeit übergab. Doch Ians Versuch, Anya Guuze in einem Anfall von einem Hormonüberschuss das Geheimnis der de la Siniestros zu erzählen, war ebenso gefährlich.
»Ihre Zunge scheint zu gelöst vom Alkohol zu sein, Gheddy«, stellte Despair scharf fest. »Ich verbiete Ihnen, Unwahrheiten über die Familie der de la Siniestros zu verbreiten.«
Ian schwieg. Anya starrte die beiden Männer fassungslos an. Sie wusste überhaupt nicht, was hier geschah.
»Verlassen Sie das Zimmer, Gheddy!«, forderte Despair.
Ian sah ihn grimmig an, warf einen letzten Blick auf Anya und folgte dann dem Befehl von Cauthon Despair. Er hatte Respekt vor dem Silbernen Ritter und war sich bewusst, dass er sein Leben verlieren würde, wenn er sich mit Despair messen wollte. Ian verfluchte sich selbst, da er beinahe das Geheimnis verraten hätte, doch er hatte sich in Anya Guuze verliebt. Er wollte sie haben. Sie sollte sein Besitz werden, sein Püppchen.
Anya wollte auch gehen, doch Despair hielt sie auf. Er schloss wieder die Tür und lief im Raum umher. Der Silberne wirkte Furcht einflößend auf die junge Terranerin. Das war auch so beabsichtigt.
Verlegen schaute sie Despair an. »Was kann ich noch für Sie tun?«
Despair baute sich vor ihr auf. »Sie machen äußerlich den Eindruck einer dummen Blondine, die ihre Höhepunkte in der Horizontalen hat und nicht einmal bis drei zählen kann, doch ihr Datenblatt bei der Liga Freier Terraner besagt etwas anderes. Ich möchte Ihnen daher raten, dieses Gespräch mit Ian Gheddy zu vergessen und dieses Subjekt zu meiden, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist.«
Anyas Herz pochte schneller. Sie hatte wirklich Angst um ihr Leben. Fast schon gelähmt vor Furcht starrte sie den Ritter an.
»Sie... Sie würden mich töten?«
»Nur, wenn es erforderlich wäre.«
Die Stimme von Despair war emotionslos. Die Zeiten, in denen er sich in so eine Frau wie Anya Guuze verliebt hätte, waren vorbei. Mit dem Tode Sanna Breens wurde auch sein Herz zu Grabe getragen.
Zweifellos war Anya eine beeindruckende Frau und ihre Schönheit war kaum zu übertreffen, doch Despair hatte während der letzten Jahre im Reiche MODRORs viel gelernt. Er hatte gelernt, sich zu beherrschen und auf seine Aufgabe zu konzentrieren. Cau Thon war ein guter Lehrmeister gewesen, denn dank seiner Hilfe hielt er seine Gefühle im Zaum und war jederzeit bereit, Feinde MODRORs zu töten. Selbst den Tod seiner Eltern, an dem Cau Thon nicht schuldlos war, hatte er zumindest ignoriert. Vergeben hatte er das Cau Thon nicht, doch er diente einer höheren Aufgabe, redete sich Despair ein.
»Wann wäre es erforderlich?«, fragte Anya halblaut.
»Wenn Sie es für nötig halten, über diesen Abend zu sprechen. Schweigen Sie. Nur so können Sie Ihr Leben und das Ihrer Nächsten retten. Ich warne Sie, Guuze. Legen Sie sich nicht mit Mächten an, die Sie nicht verstehen können.«
Anya nickte langsam mit dem Kopf. Sie versicherte Despair, dass sie zu niemandem ein Wort sagen würde. Das entsprach auch der Wahrheit. Sie hatte viel, zu viel Angst. Die Terranerin fühlte, dass sie niemand schützen konnte. Vor allem ihr nichtsnutziger Freund nicht. Despair war ihr unheimlich. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließ er den Raum und ließ sie zurück.
*
Die Party dauerte schon einige Stunden. Dorys hatte schon einen über den Durst getrunken und war eine einzige Peinlichkeit. Charly versuchte seine Mutter etwas zu bremsen. Einige Reporter umzingelten regelrecht die Zukünftige des Marquês und stellten unentwegt ihre Fragen.
»Frau Gheddy, wie fühlen Sie sich als baldige First Lady des Terrablocks?«
Ein herzhaftes Rülpsen bekamen die Journalisten als Antwort. »Ich brauch' erst einmal einen vierfachen Vurguzz und einen Managara.«
Ein Diener brachte ihr sofort die beiden Getränke. In einem Zug leerte sie das Glas Vurguzz und bestellte gleich einen neuen. Um die alkoholfreie Zeit zu überbrücken, schlürfte sie den arkonidischen Cocktail.
»Wie es ist, die Dame des Planeten zu sein? Ich fühle mich großartig!«, lallte sie.
»Welchen Tätigkeiten werden Sie nachkommen?«, wollte Speaky Mohlburry wissen, der Jaaron Jargon tatkräftig bei den Chroniken von Cartwheel unterstützte.
»Na ja, ich muss viel einkaufen. Viele Kleider, viele Partys geben. Viel Schlafen, Trivideo sehen und solche Sachen. Na, was eine Frau schon macht«, stammelte sie und versuchte vergeblich aufzustehen.
Charly lächelte gezwungen in die Aufzeichnungsgeräte. »Finden Sie das nicht etwas zu wenig, Madam? Schließlich ist Ihr Mann das Staatsoberhaupt des Terrablocks und gilt als ein Mann, der sich in Beruf und Freizeit für das Gute einsetzt.«
Man konnte Mohlburrys Abneigung gegenüber der peinlichen Gheddy anmerken. Er machte kein Geheimnis daraus.
»Was soll das denn heißen, du blöder Fettsack!«, schrie die Gheddy.
»Mutter!«, ermahnte sie Charly.
Sie fuchtelte mit den Armen umher, stand auf und lief ein paar Schritte. Dabei warf sie eine Vase von einem Bistrotisch um, als sie Halt suchte.
»Ich engagiere mich für die guten Dinge. Da muss doch nicht so ein blöder Fettmolch kommen und mir solche dämlichen Fragen stellen!«
Sie zündete sich eine Zigarette an und blickte sich suchend um. »Wo ist dieser Mistkerl von Diener mit meinem Vurguzz?!«
Eilig rannte er zu ihr und gab ihr den Drink. Er hatte gleich vier Vurguzz fertig gemacht. Dorys leerte alle vier hintereinander. Beim letzten ließ sie das Glas fallen und fiel rückwärts auf den Boden. Einige Schreie hallten durch den Raum.
Der Marquês wurde auf seine Verlobte aufmerksam und rief Diabolo zu sich. »Ist sie tot? Sag mir, dass sie tot ist! Bitte!«
Der Posbi verneinte.
Charly erklärte der Presse, während einige Diener Dorys Gheddy in ihr Zimmer schleppten, dass die ganze Aufregung wohl etwas zu viel für sie gewesen war, und bat um Verständnis.
Der Marquês saß resignierend auf seinem Thron. So oder so! Die Gheddys waren ein gewaltiger Imageschaden für ihn.
Er wandte sich Diabolo zu, der an seiner rechten Seite stand. »Überlege dir eine gute Geschichte, wie wir meinen Kindern und der Öffentlichkeit erklären können, dass sie Klone sind. Ich halte das nicht lange mit den Gheddys aus!«
18. Tödliche Neugier
Wyll Nordment schlich durch die unteren Gewölbe des großen Schlosses. Hier befand sich das »Gepäck« von Uwahn Jenmuhs. Ein Versuch, in sein Zimmer einzudringen, war vergeblich, denn ein halbes Dutzend grimmiger Naats bewachte das Quartier des Kristallkönigs, wie er sich in Cartwheel nannte.
Einen ganzen Trakt hatte Jenmuhs im Keller für sich reserviert. Sonderlich nett sah es hier allerdings nicht aus. Die Gewölbe erinnerten Nordment an einen alten Horrorfilm aus dem 20. Jahrhundert.
»Edgar Allen Poe lässt schön grüßen«, murmelte er zu sich selbst.
Zwei Naats bewachten den Raum. Wyll musste zu einer List greifen, um die klobigen Hünen abzulenken.
Er ging wieder hoch und begab sich in die Küche. Dort »borgte« er sich einen Anzug eines Dieners und nahm etwas zu Essen mit. Da er auf so eine Aktion bereits vorbereitet war, nahm er ein starkes Betäubungsmittel aus seinem tragbaren USO-Kit und brachte den Naats das Essen. Gierig und dankbar schlangen die Wesen das Essen in sich hinein und schliefen ein. Er ging in den Raum. Viel Gepäck und allerlei Gerätschaften befanden sich darin.
Zu seiner Erleichterung hatte sich Jenmuhs auf seine Naats verlassen und keine elektronischen Alarmsysteme installiert. Vielleicht fehlte auch die Zeit dazu und mit Sicherheit verfügte der Marquês in seinem rustikalen Anwesen auch über Abtaster, die so eine energetische Aktivität angemessen hätten. Jenmuhs versteckte dort anscheinend etwas und niemand sollte Verdacht schöpfen.
Im hinteren Teil des Lagerraums hing ein großer Vorhang. Licht schimmerte. Langsam ging Nordment näher und zog den Vorhang beiseite. Was er sah, erstaunte ihn sehr. Auf einem großen Bett lag eine Frau. Sie war noch ziemlich jung, sehr klein und zierlich. Sie hatte lange, schwarze Haare und ein puppenhaftes Gesicht.
Sie erschrak, als sie Nordment bemerkte.
»Ich tue Ihnen nichts«, versicherte Nordment.
»Wer bist du?«
Wyll Nordment stellte sich vor und registrierte, dass die Frau sehr erleichtert war.
»Ich bin Anica. Der dicke, böse Mann hält mich gefangen. Ich will wieder zu Uthe«, erklärte sie und fing an zu weinen.
Sie erzählte ihm von der Entführung und dem bösen Krokodil. Sofort wusste Wyll, dass es sich dabei um jenen Topsider handelte, der auch ihn und Rosan angegriffen hatte. Somit steckte definitiv Jenmuhs hinter all dem. Mit Anica als Zeugin und Opfer hatte man genügend Beweise, um die politische Karriere von Jenmuhs zu ruinieren.
»Ich bringe dich hier heraus.«
Plötzlich hörte er ein Geräusch an der Tür. Jemand kam hinein. Wyll legte den Finger an seinen Mund und gab Anica so zu verstehen, dass sie schweigen sollte. Er versteckte sich hinter einigen Kisten. Die Person war nicht zu erkennen. Sie stoppte plötzlich und verließ eilig den Raum. Anscheinend hatte man ihn entdeckt. Nordment musste den Fremden unschädlich machen, bevor er Hilfe holen konnte. Schnell rannte er heraus, streifte sich die Perücke, die zum Standard der Diener gehörte, ab und lief hinterher. Die Person lief tiefer in die Gewölbe hinein.
Nordment folgte ihr. Er erreichte einen düsteren Raum. Die Gerätschaften waren primitiv und stammten sicherlich aus den voratomaren Zeiten Terras. Doch man konnte sofort erkennen, was sie darstellten.
Eine Folterkammer!, schoss es Nordment durch den Kopf.
Streckbänke, eiserne Jungfrauen, Stahlkäfige und Pendels »schmückten« den bizarren Raum. An der Wand befanden sich spitze Stangen. Anscheinend wurden Opfer dort aufgespießt. Was für eine grässliche Vorstellung. Der Fremde blieb im Raum stehen. Wyll konnte ihn jetzt erkennen. Erleichtert atmete er auf. Es war Cauthon Despair.
Wyll gab sich zu erkennen.
»Hey, Despair!«, rief er. Der Silberne Ritter drehte sich um und ging schweigend auf Nordment zu.
»Jenmuhs ist erledigt. Er steckt hinter dem Attentat auf Rosan und mich. Er hat auch diese Anica entführt. Sie ist hier. Mit ihr als Zeugin können wir Jenmuhs ans Messer liefern.«
*
Stephanie kam gerade aus der Nasszelle. Ihr Intermezzo mit Alcanar Benington hatte sie sehr angestrengt, aber auch befriedigt. Sie machte sich zurecht und ging wieder auf die Feier, die noch im vollen Gange war.
Toran Ebur suchte die de la Siniestro auf. Sein gestählter Körper schien jede Minute seine enge Uniform zu sprengen. Stephanie bewunderte diesen Mann. Er war stark, gut aussehend, mächtig und ehrgeizig. All das, was auch sie war.
Der Zaliter lächelte sie an. »Wo warst du den ganzen Abend über? Ich habe dich vermisst.«
»Och«, machte sie. »Ich habe mich etwas vergnügt. Doch keiner kann mich so gut unterhalten wie du.«
Sie streichelte über seinen muskulösen Oberkörper. Jeden Muskel spürte sie durch die Uniform.
»Lass uns etwas ungestört sein«, flüsterte sie ihm ins Ohr. Toran, der nicht wusste, dass er bereits der dritte Mann für Stephanie heute Abend war, grinste breit. Dann zogen sie sich in ihr Zimmer zurück. Toran packte Stephanie und warf sie aufs Bett.
»Stephanie de la Siniestro, ich will dich zum Weib!«
»Ist das ein Heiratsantrag?«, fragte sie gelangweilt.
»Ja!«
»Ich bin eine Prinzessin. Was kannst du mir bieten, Gos'Kurii von Zalit?«
Ebur beugte sich über sie, streifte ihre Schulterträger ab und zog das Kleid von ihrem Körper. Dann streichelte er über ihre prallen Brüste.
»Du bist eine Königin, Stephanie. Wir sind königlich. Ich kann dir Macht und Reichtum bieten. All deine Wünsche werden sich erfüllen. Schon bald wird Arkon noch viel mächtiger auf der Insel sein.«
Stephanie gefielen diese Visionen. Sie ließ es mit sich geschehen. Seine Zunge glitt über ihren nackten Oberkörper. Stephanie stöhnte voller Lust auf.
»Wir symbolisieren Terra und Arkon in dieser Galaxis. Verbunden sind wir unschlagbar«, sprach er sanft weiter.
Er streifte das Kleid nun von ihrem ganzen Körper. Nackt lag sie vor ihm. Stephanie glitt über das Bett und machte Toran mit einer Geste verständlich, dass er auch ins Bett kommen sollte.
»Wenn das so ist, edler Toran, nehme ich deinen Antrag an.«
Ebur grinste. Er zog seine Uniform aus und stieg ins Bett. Leidenschaftlich küssten sie sich, seine Hände glitten zwischen ihre Beine.
»Genug der Worte, Prinzessin...«
*
Despair schwieg. Wyll verunsicherte das etwas. Er lief unruhig um den Silbernen Ritter herum.
»Was ist los? Gehen wir und befreien die Kleine«, forderte Wyll.
Nun regte sich Despair endlich.
»Ich habe Rosan als eine Freundin angesehen. Es war bedauerlich, dass ihre Familie nach dem Tod ihres Vaters ihr den Kontakt zu mir verboten hatte«, sagte Despair leise.
»Was hat das jetzt damit zu tun? Sie können mit meine Frau immer noch befreundet sein.«
»Ich fürchte, nach diesem Abend wird das unmöglich sein«, erwiderte Despair mit belegter Stimme. Er stellte sich vor Nordment.
»Uwahn Jenmuhs darf nicht abgesetzt werden, Nordment. Diese banale Entführung, der Mordanschlag an euch – all das wird ihn diskreditieren. Seine Vergangenheit wird aufgewühlt werden. Seine Rolle bei der Zerstörung Sverigors. Selbst wenn er im Amt bleibt, der Terrablock muss sich distanzieren. Es wird zu Spannungen kommen. Vielleicht zu einem Krieg. Das muss verhindert werden.«
Nordment lachte bitter.
»Ihn schützen? Ach kommen Sie, Despair. Jenmuhs ist ein Verbrecher. Auch wenn er damals seinen fetten Hals aus der Schlinge ziehen konnte, es ist nur recht, wenn er sich jetzt verantworten muss. Er wird politisch untragbar werden. Mit Anica als Kronzeugin wird Jenmuhs fallen. Dafür werde ich sorgen!«
Despair seufzte.
»Nun, denn! Für Ihre impertinente Neugier müssen Sie den Preis bezahlen, so Leid es mir tut.«
Wyll verstand nicht.
Despair packte ihn und warf ihn zu Boden. Keuchend rappelte sich Nordment auf. Mit Dagor-Griffen versuchte er Despair beizukommen, doch der silberne Ritter war zu stark. Despair packte Nordment erneut und hob ihn hoch. Als würde er nichts wiegen, trug er ihn quer durch den Raum bis zur Wand mit den spitzen Stangen.
Erst jetzt begriff Nordment. Zu spät.
Ohne zu zögern, rammte Despair seinen Gegner in die Stange. Schmerzerfüllt schrie Nordment auf, doch niemand würde ihn hier unten hören. Die ersten Momente zappelte Wyll wild und versuchte sich zu befreien, doch die Schmerzen waren zu groß. Fassungslos starrte er auf die spitze Stange, die aus seinem Brustkorb ragte. Er wusste, dass er verloren hatte. Die Gewissheit bald zu sterben, trieb ihn in den Wahnsinn.
All die Abenteuer auf der LONDON I und LONDON II hatte er überstanden. Weiß Gott war es knapp gewesen. Doch er hatte es geschafft. Rosan hatte ihm die Kraft gegeben.
Der Gedanke an seine Frau schien Nordment übermäßige Kraft zu verleihen. Er drückte sich von der Stange herunter, doch Despair schob ihn mit einer Hand wieder hinein. Der Schmerz war unvorstellbar. Verzweifelt schrie Wyll auf. Ein letztes Aufbegehren, dann wusste er, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Er ließ die Arme herunter baumeln und ergab sich seinem Schicksal. Er dachte an Rosan. Seine letzten Gedanken galten nicht Despair und Jenmuhs und in welchem Zusammenhang die beiden standen, sondern der Frau, die er liebte. Mit diesem freudigen Gedanken wich das Leben aus dem Körper von Wyll Nordment.
*
Rosan machte sich Gedanken, wo Wyll blieb. Sie hatte ein ungutes Gefühl. Schließlich entschloss sie sich, ihn zu suchen. Sie bemerkte nicht, dass Despair an ihr vorbei und zu Uwahn Jenmuhs ging, der kurz danach mit Terz von Eskor und seinen Orbtons den Raum verließ.
Panisch durchsuchte sie jeden Raum und fragte jeden nach ihrem Ehemann. Sie gelangte in den Keller und erst jetzt wurde sie darauf aufmerksam, dass Jenmuhs sich auf seine Abreise vorbereitete.
Der fette Arkonide würdigte Rosan nur eines Blickes, doch dieser sprach Bände. Hohn und Spott funkelte aus seinen Augen. Er lachte über Rosan. Ein hämisches Lachen, welches Rosan noch mehr beunruhigte. Immer wieder rief sie Wylls Namen, doch er antwortete nicht. Sie rief ihn über sein Interkom-Handgerät, doch er nahm nicht ab. Entsetzt lief Rosan wieder in den Festsaal und informierte Joak Cascal.
Dieser befahl den Dienern den Interkom von Wyll anzupeilen. Schnell wurde ein erfolgreiches Ergebnis abgeliefert. Cascal und Orbanashol-Nordment rannten in das Verlies.
Rosans Herz schlug höher. Die Angst wurde immer größer. Angst vor der Gewissheit ihrer Befürchtungen. Da sah sie ihn. Leblos hing er an der Wand, aufgespießt von einer Stange. Tränen schossen aus Rosans Augen. Sie brachte kein Wort heraus.
Joak Cascal wurde bleich. Wie in Zeitlupe ging Rosan auf Wyll Nordment hinzu. Sie hoffte, er würde sich bewegen. Eine Regung zeigen. Doch nichts passierte. Meter für Meter, den sie näher kam, passierte immer noch nichts. Schließlich stand sie vor ihm und fing an laut zu schluchzen. Sie streichelte über sein Gesicht. Es war noch warm. Joak Cascal wusste, dass Wyll tot war. Er hatte einen Individualabtaster mitgenommen, um die Impulse von Nordment bei der Suche schneller zu finden. Dieser gab keinen Ausschlag.
Wyll Nordment war tot.
Langsam trat Joak Cascal näher und versuchte Rosan zu trösten. Sie sank auf die Knie und weinte bitterlich. Cascal übernahm die schlimme Aufgabe und zog den Leichnam herunter. Es gab ein erschauderndes Geräusch, als der Wyll von der Stange nahm. Behutsam legte er ihn auf den Boden. Rosan beugte sich über ihren toten Mann und beklagte in stiller Trauer seinen Tod.
»Wer...«, versuchte sie zu sagen, doch sie stockte. Sie schniefte und zitterte am ganzen Körper. Dann versuchte sie es erneut. »Wer... immer... das getan hat.«
Cascal war sichtlich um Fassung bemüht. Er stand hilflos daneben, konnte den Tod nicht mehr ungeschehen machen und Rosan auch nicht trösten.
»Er wird...«, fuhr sie fort, »er wird dafür bezahlen. Das... das verspreche ich!«
*
Nachdem die Polizei und der TLD informiert wurden, wurde die Feier abgebrochen. Der Marquês äußerte seine Bestürzung und versprach Rosan Orbanashol-Nordment jegliche Hilfe. Uwahn Jenmuhs verabschiedete sich sehr plötzlich von dem Marquês.
»Dringende Geschäfte erfordern meine sofortige Heimkehr«, erklärte er.
Toran Ebur trat an ihn heran. Neben ihm Stephanie.
»Es gibt tolle Neuigkeiten, Vater«, jubelte sie und zeigte ihren Ringfinger, auf dem ein goldener Ring steckte.
»Meinen Glückwunsch«, sagte der Spanier tonlos. »Wyll Nordment wurde in meinem Haus ermordet.«
»Und wenn schon. Ich werde heiraten. Da kann mir auch ein Toter nicht die gute Laune verderben«, gab Stephanie kalt zurück.
In diesem Moment fragte sich der Marquês, ob seine Tochter noch ganz normal war.
Rosan wurde von Uthe getröstet. Die Scorbit kümmerte sich mit aller Kraft um Rosan. Die Leiche von Wyll wurde fortgebracht und für Rosan blieb nichts mehr zurück als die Erinnerungen an Wyll Nordment. Schöne Erinnerungen, doch sie konnten ihn nicht ersetzen.
19. Gut und Böse
Der Marquês stand an dem Geländer seines Balkons und starrte in die Nacht. Er wusste nicht, wer den Mord begangen hatte und warum. Sein Verdacht war Jenmuhs. Doch er konnte seinen Verbündeten nicht anklagen. In seiner Seele fand ein Kampf statt. Der Konflikt zwischen Gut und Böse. Seit der Marquês in diesem Jahrhundert weilte, hatte er gelernt, das Leben zu respektieren. Doch nun war er ein Sohn des Chaos. Von ihm wurde verlangt zu morden.
Despair trat an ihn heran.
»Es war nötig«, sprach er ruhig.
Bitter lachte der Marquês. »Hätte er MODROR gefährlich werden können? Womit rechtfertigt Ihr diesen feigen Mord?«
»Er hätte Jenmuhs' Karriere ruiniert. Das darf nicht passieren, denn wir brauchen diesen widerlichen Arkoniden.«
Der Spanier nickte schwach. Wie vermutet, hatte es etwas mit Jenmuhs zu tun. Dafür musste Wyll Nordment sein Leben lassen. Despair bemerkte den Konflikt des Marquês. Er kannte diesen Kampf nur zu gut, denn er führte ihn jeden Tag.
»Wir sind Söhne des Chaos, Don Philippe. MODROR erwartet unsere Loyalität. Wir haben diesen Weg eingeschlagen und können nicht mehr zurück. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, es ist unser Schicksal.«
»Ich weiß. Doch wie leben Sie damit? Ich meine, Cau Thon hat ihre Eltern ermordet, wie er zugegeben hat.«
Despair schwieg. Seine Stimme wäre zu brüchig gewesen. Dank des Helms sah der Spanier die Tränen nicht. Ja, er verfluchte Cau Thon und MODROR dafür. Doch er war nun ein Sohn des Chaos. Die Liebe seiner Eltern auszulöschen, war ein Teil seines Pfades zum Chaos gewesen. Es ergab aus Sicht MODRORs Sinn. Alles was Despair war, hatte er Cau Thon und MODROR zu verdanken.
Doch an Tagen wie heute, nach dem Mord an einem heldenhaften, tugendhaften Terraner, bedauerte er sein Schicksal. Despair riss sich zusammen. So wie de la Siniestro hatte er mehr oder weniger freiwillig den Pakt mit dem Teufel geschlossen.
Er war nun ein apokalyptischer Reiter. Gewissensbisse waren fehl am Platze. Sie mussten durch das Blut waten, um ein neues, reines Paradies zu schaffen. In vielen Generationen würden seine Untaten vergessen sein und die Nachwelt würde Despair anders beurteilen. Zumindest hoffte er das.
*
Jenmuhs betrat sein Beiboot, welches ihn zu seinem Schlachtschiff, der BOSTICH, brachte. In seinem kleinen Besprechungsraum befanden sich nur er selbst, Mascant da Eskor und Toran Ebur.
»Bedauerlicher Zwischenfall. Ich hatte die Feier genossen. Auf jeden Fall hat der Mörder einiges gut bei mir.«
Jenmuhs widerliches Kichern ließ den beiden hohen Admirälen einen Schauer über den Rücken laufen.
»Meine Herren, die Operation GÖTTERDÄMMERUNG kann wie geplant anlaufen. Sind alle Vorbereitungen getroffen?«
»Ja, Begam!«, meldete Eskor.
Jenmuhs ließ sich bereits als Begam anreden. Das war der höchste militärische Rang, den nur der Imperator selbst innehatte. Eine Anmaßung von Jenmuhs, wie der Mascant fand. Doch Jenmuhs war in gewisser Weise der Imperator Arkons in Cartwheel. Eines Tages wollte er es auch in der Milchstraße sein.
Dennoch war seine offizielle Bezeichnung Gos'Shekur, also Dreisonnen-Kristallstatthalter, welches im Arkonidischen mit einem Kristallkönig gleich zu setzen war.
»Sehr gut. Am 07. November 1298 Neuer Galaktischer Zeitrechnung um 0:00 Uhr läuft die Operation GÖTTERDÄMMERUNG an.«
Die beiden Admiräle salutierten und verließen den Raum. In sich versunken, lachte Jenmuhs diabolisch. Bald würde er noch mehr Macht haben. In wenigen Tagen würde er damit beginnen, sich Cartwheel Untertan zu machen.
ENDE
Der Marques de la Siniestro hat den Pakt mit dem Teufel geschlossen. Er ist nun ein Sohn des Chaos. Als Gegenleistung erhielt er einen Zellaktivator. MODROR agiert längst in Cartwheel. Doch die Arkoniden wollen offenbar selbst ihre Macht erweitern.
Das Zyklusfinale schildert Jens Hirseland in Band 47: »Krisenfall Lingus«.
Kommentar
Don Philippe de la Siniestro ist einer der mächtigsten Politiker in Cartwheel. Unter seiner Führung wurde der Terra-Block zu einem der mächtigsten Staatsgebilde in der Galaxis überhaupt.
Da der Spanier aber zu einer Zeit geboren wurde, als die Lebenserwartung nicht so hoch war, neigt sich sein Leben dem Ende zu.
Doch als er auf seinem Sterbebett liegt, erscheint Cau Thon und macht dem Marquês ein Angebot. Er will ihm im Namen seines Meisters, MODROR, einen Zellaktivatorchip verleihen. Der Preis dafür? – Seine Seele.
Cau Thons Meister hat einen gewaltigen Plan ersonnen, um erst Cartwheel und dann diesen Teil des Universums zu unterwerfen. Einer seiner ersten Aufgaben soll es sein, nachdem er in sein Amt zurückgekehrt ist, Cauthon Despair zum Terramarschall zu ernennen. Danach beginnt dann seine eigentliche Aufgabe. Zusammen mit Uwahn Jenmuhs, Torsor und Nor'Citel soll er ein neues, mächtiges Imperium gründen. Cau Thon verspricht ihm sogar, dass er eines Tages über die Milchstraße herrschen wird.
Was für Wahlmöglichkeiten hat er? »Auf der einen Seite wartet der Tod, begierig ihn zu verschlingen, und auf der anderen Seite hatte er die Möglichkeit, ewig zu leben, auf einer Stufe mit Leuten wie Perry Rhodan und Atlan zu stehen, ja sogar Herrscher über eine Galaxis zu werden. Doch der Preis den er dafür zahlen sollte, war hoch. Er musste einen Pakt mit dem Teufel schließen und ihm seine Seele verkaufen. War dieser Preis nicht zu hoch?«
Der Marquês nimmt das Angebot an. Nach einem kurzen Kontakt zu seinem neuen Meister MODROR, der ihn zum fünften Sohn des Chaos ernennt, erhält er in Form eines Zellaktivatorchips das ewige Leben. MODROR sagt ihm auch, dass sich die anderen Söhnen des Chaos demnächst bei ihm melden werden.
Und so kommt es, das sich Cauthon Despair wenige Tage später als ein weiterer Sohn des Chaos zu erkennen gibt. Damit ist auch klar, dass das Angebot von MODROR nur eine Finte war. MODRORs Ziel ist ein unabhängiges und autarkes Cartwheel. Das haben sie nun erreicht. Damit können die Söhne des Chaos und die anderen Helfer von MODROR nun nach Belieben schalten und walten.
Auf Paxus, in der Residenz Nor Citels, fand dann für den Marquês das erste Treffen mit den anderen Söhnen des Chaos statt. Als da wären:
Cau Thon
Cauthon Despair
Goshkan
Nor'Citel (alias Leticron)
Marquês Don Philippe Alfonso Jaime de la Siniestro
Demnächst soll Cau Thon nach Dorgon fliegen, um auch diese Galaxis für MODROR Untertan zu machen. Dann sollen der Marquês und Uwahn Jenmuhs das Imperium Cartwheel gründen. Nach einer gewissen Aufrüstungszeit soll es dann mächtig genug sein, um die Milchstraße anzugreifen. Obwohl noch von Zweifeln geplagt, stimmt der Marquês den Plänen zu.
Eins wird aus dieser Situation ganz klar ersichtlich. Der Marquês besitzt zwar immer noch ein Gewissen. Er wird zum Anfang noch von Zweifeln geplagt. Allerdings was der Marquês ein Mann, der sich immer auf die Seite des Stärksten schlagen würde, da er den Willen zum Überleben hatte. Er stammte aus einer Zeit, in der Menschenleben wenig bedeuteten. Viele mussten ihr Leben lassen, nur damit es einem reichen Edelmann gut ging.
Diese Mentalität hatte Don Philippe de la Siniestro noch nicht abgelegt. Und doch hatte er ein schlechtes Gewissen gegenüber Perry Rhodan, der ihm ein Gönner gewesen war.
Allerdings war das Angebot von MODROR zu verlockend. Der Marquês ist sich ziemlich sicher, dass er, bevor das neue Jahrhundert beginnt, der absolute Herrscher über die Galaxis Cartwheel sein wird. Wir dürfen gespannt sein, ob er das schafft.
Björn Habben
GLOSSAR
Ian Gheddy
Alter: 35 Jahre
Geburtsort: Terrania-City
Gewicht: 90 kg
Augenfarbe: Blau
Haarfarbe: Rot
Beschreibung: Groß und kräftig, kurze rote Haare, wirkt finster und bedrohlich. Trägt ausschließlich schwarze Sachen und hat die raue Stimme seiner Mutter geerbt. Ist intelligent und gefährlich. Entschlossen jeden aus dem Weg zu räumen, der ihm im Weg steht. Liebt nur sich selbst und seinen jüngeren Bruder Charly.
Ian Gheddy wurde als Sohn von Dorys und Paul Gheddy in Terrania-City geboren. Nach der Scheidung seiner Eltern bleibt er mit seinem jüngeren Bruder Charly bei seiner Mutter. Da Dorys vorwiegend mit sich selbst beschäftigt ist, bleiben die Jungen sich selbst überlassen und entwickeln gewalttätige und kriminelle Neigungen. Sie terrorisieren Mitschüler und pressen ihnen "Schutzgeld" ab. Da sie dabei sehr geschickt vorgehen, kann ihnen nur selten etwas nachgewiesen werden. Als Ian jedoch in unbeherrschter Wut einen Lehrer zusammenschlägt, weil dieser ihn gedemütigt hatte, muss er sich einer psychologischen Therapie unterziehen. Nachdem er diese – zum Schein – erfolgreich absolviert hat, kann er die Schule erfolgreich abschließen und absolviert eine Ausbildung als Bürokommunikant, was ihn wenig zufriedenstellt.
Ian träumt davon Reich zu werden, dazu ist ihm jedes Mittel recht. Zusammen mit Charly betreibt er diverse dubiose Geschäfte. Als Dorys zur Insel aufbricht, folgen ihr Ian und Charly, in der Absicht sich etwas von dem Kuchen abzuschneiden.
Dorys Gheddy
Geboren: 29.8.1135 NGZ
Geburtsort: Trade City, Olymp
Gewicht: 70 Kg
Augenfarbe: Braun
Haarfarbe: Dunkelblond
Beschreibung: klein, träge, sehr nervige Ausstrahlung, raucht stark, ist langsam und unmotiviert. Ist Alkoholkrank, trinkt am liebsten Vurguzz-Amaretto-Schnaps, muss sich alle fünf Minuten setzen und dann eine Zigarette rauchen, einen Schnaps oder einen Kaffee trinken. Ihre Stimme ist rau. Dorys ist besitzergreifend und fordernd. Sie erwartet, dass man alles für sie tut, während sie nicht bereit ist, irgendetwas zu tun. Bei diversen Stürzen, verursacht durch ihren Alkoholismus, bricht sie sich hin und wieder einen Arm oder ein Bein. Ist in der Lage gute Laune innerhalb von Minuten zu zerstören.
Dorys Gheddy ist die zehn Jahre jüngere Schwester von Ottilie Braunhauer. Sie wurde am 29.8.1135 in Trade City, Olymp geboren. Als Nesthäkchen wurde sie von ihren Eltern mehr verwöhnt als ihre ältere Schwester Ottilie. Doch während diese folgsam und anspruchslos war, entwickelte sich Dorys als sie ins Teenageralter kam, zu einem Problemfall. Sie trank und rauchte übermäßig und hatte zahlreiche Affären mit diversen Jungen. Einen gut betuchten Verehrer wies sie jedoch, sehr zum Leidwesen ihrer Schwester, ab. Mit zwanzig schmiss Dorys ihre Ausbildung als Toilettenmanagerin hin und brannte mit ihrem Geliebten namens John Nessel nach Terra durch, welches sich nach der Monos-Diktatur wieder im Aufbau befindet.
Die beiden beginnen dort ein neues Leben. John arbeitet als Ingenieur, während Dorys die Rolle der Hausfrau übernimmt. Zwei Jahre später kommt Sohn Marv auf die Welt. Alles könnte bestens für Dorys sein, doch ihre Trunksucht, ihre Faulheit und ihre Penetranz lassen die Ehe mit John nach sieben Jahren zerbrechen. Dorys erhält das Sorgerecht für ihren Sohn, flüchtet sich jedoch immer wieder in neue Männerbekanntschaften, von denen sie noch vier weitere Kinder empfängt, die jedoch von ihr an die diversen Väter abgegeben werden. Allein Marv bleibt bei seiner Mutter. Er wird nun das bevorzugte Opfer seiner Mutter. Durch Dorys nicht enden wollende Penetranz wird der sensible Junge mit 21 Jahren in den Selbstmord getrieben. Dorys bleibt jedoch nicht lang allein. Sie lernt den Geschäftsmann Paul Gheddy kennen und lieben. Nach zwei Jahren heiraten die beiden und Dorys bekommt zwei Söhne – Ian und Charly. Doch nach einigen Jahren scheitert auch diese Ehe. Finanziell und nervlich ruiniert verläßt Paul Gheddy Dorys. Die beiden Söhne bleiben bei ihr, entwickeln jedoch mit der Zeit kriminelle Neigungen. Als Ian und Charly erwachsen sind, verlassen sie das Elternhaus. Dorys, die zusehends verfällt, bleibt allein zurück. Zum Sozialfall geworden sucht sie wieder Kontakt zu ihrer Schwester Ottilie und Schwager Karl-Adolf Braunhauer. Bei einem Besuch schafft es Dorys die ganze Familie gegeneinander aufzubringen. Bei einem Streit schüttet ihr Karl-Adolf ein Glas Vurguzz über den Kopf. Dorys kehrt nach Terra zurück und kommt in Detroit in einer Sozialwohnung unter. Dort fristet sie ihr Dasein, bis sie vom Schicksal ihrer Schwester erfährt und zur Insel aufbricht.
Terz da Eskor
Arkonide im Rang eines Mascant. Oberbefehlshaber der arkonidischen Raumflotte in Cartwheel.
Geboren: 14.10.1241 NGZ
Geburtsort: Arkon I, Kristallimperium
Größe: 1,85 Meter
Gewicht: 87 kg
Augenfarbe: rot
Haarfarbe: weißblond
Beschreibung: Mittelgroß, schlank, militärisches und strategisches Genie, loyal dem Kristallimperium ergeben.
Terz da Eskor entstammt einer adligen Familie zweiter Klasse. Er wurde auf Arkon geboren, auch wenn sein Vater Besitzer mehrere Systeme war, so war sein Hauptdomizil eine Luxusvilla nahe dem Kristallpalast auf Arkon I.
Terz da Eskor wurde von seinem Vater Ori da Eskor im jungen Alter in eine Militärakademie gesteckt. Terz hatte keine großen Möglichkeiten sich anders zu entwickeln. Aus ihm wurde schnell ein eingefleischter Soldat, der sich jedoch durch seine bestechende Intelligenz hocharbeitete. Er war noch keine dreißig Jahre alt, da hatte er bereits den Titel eines Pal'athor inne und kommandierte das 500 Meter Schlachtschiff ZOLTRAL.
Seine ersten Erfahrungen im Kampfeinsatz sammelte er bei Revolten von kleineren Systemen. Er konnte jede niederschlagen und wurde nur von dem späteren Mascant Prothon da Mindros überboten, dessen Tod durch Atlan da Eskor sehr bedauerte. Später bekam er auch Kampferfahrung im Tolkanderkrieg und stieg langsam die Karriereleiter hoch. Den Titel des Vere'athor bekam er bereits nach der ersten niedergeschlagenen Revolte. Im Kampf gegen IPRASA und Tolkander brachte er es zum Keon'athor. Terz da Eskor war ein wichtiger Soldat im Rang eines Vizeadmirals. Im Jahre 1294 NGZ wurde er in den Rang des Thek'athor, eines Admirals im Stab, erhoben. Terz da Eskor kannte die Familie der Jenmuhs und dadurch wurde er von Jenmuhs vorgeschlagen auf der Insel das Militär zu leiten. Während Jenmuhs den Titel eines Gos'Kurii, eines Kristallstatthalters, verliehen bekam, wurde Terz da Eskor die höchste Ehre zuteil, der Rang eines Mascant, dem Oberbefehlshaber der Flotte! Zwar war dies nur auf Cartwheel bezogen, doch die Ehre war ungeheuer. Ebenfalls hatte er den Titel Ka'Goris, Kriegsminister des Kristallreiches auf der Insel, inne.
Terz da Eskor strebte eine extreme Rüstungspolitik an. Er wollte eine gewaltige Flotte erschaffen und Arkon zum größten Machtfaktor in der Galaxis Cartwheel machen.
Mandor da Rohn
Geboren: 04.12.1212 NGZ
Geburtsort: Arkon I, Kristallimperium
Größe: 1,87 Meter
Gewicht: 95 kg
Augenfarbe: rot
Haarfarbe: weißblond
Beschreibung: Kurze, weißblonde Haare, Bierbauch, faltiges Gesicht, loyal dem Imperium ergeben, denkt jedoch mit und ist sehr liberal eingestellt.
Has'athor Mandor da Rohn ist ein alteingesessener Soldat. Er war bereits bei der Gründung des Kristallimperiums in der Armee und ein glühender Verehrer von Theta von Ariga gewesen. Jedoch stand er auch Imperator Bostich treu zur Seite. Der Has'athor, der Rang eines einfachen Admirals, wurde in letzter Zeit häufig im Stabsbereich eingesetzt, da er ein guter Stratege war.
Er selbst bat um die Versetzung nach Cartwheel, da er den nahenden Konflikt zwischen der LFT und dem Kristallimperium kommen sah. Has'athor da Rohn sagte einmal zu Vertrauten, dass es keine zehn Jahre mehr dauern würde und es gäbe einen Krieg zwischen der Liga Freier Terraner und dem Kristallimperium. Er wollte nicht dabei sein und hoffte, dass das Projekt von DORGON eine friedliche und weisere Galaxis formen würde.
Has'athor da Rohn ist auch hier im Stabsbereich und Vertrauter von Uwahn Jenmuhs.
Der Arkonide pflegt eine Freundschaft zu dem LFT- und Terrablock Kommandeur Henry »Flak« Portland.
Die DORGON-Serie ist eine nicht kommerzielle Publikation des PERRY RHODAN ONLINE CLUB e. V. — Copyright © 1999-2015
Internet: www.proc.org & www.dorgon.net • E-Mail: proc@proc.org
Postanschrift: PROC e. V.; z. Hd. Nils Hirseland; Redder 15; D-23730 Sierksdorf
— Special-Edition Band 46, veröffentlicht am 13.11.2015 —
Titelillustration: Stefan Lechner • Innenillustration: Lothar Bauer
Lektorat: Jürgen Freier und Jürgen Seel • Digitale Formate: Jürgen Seel